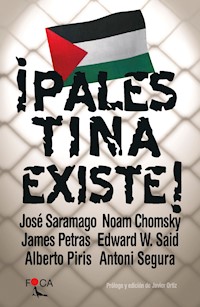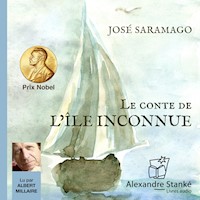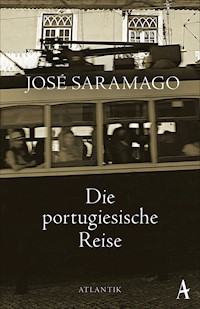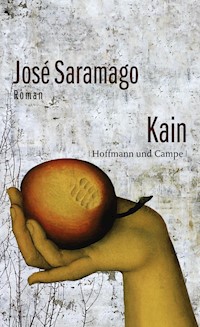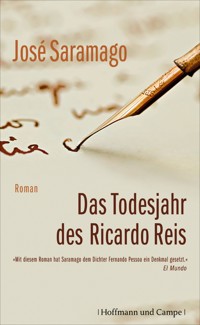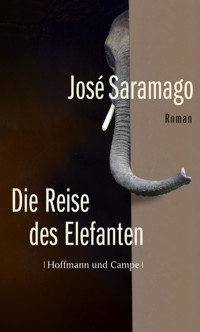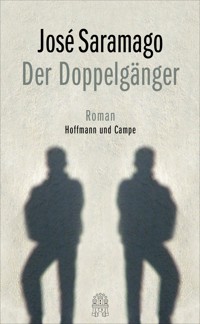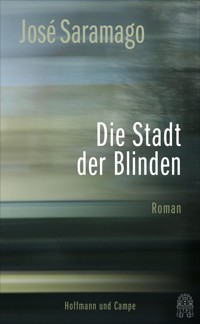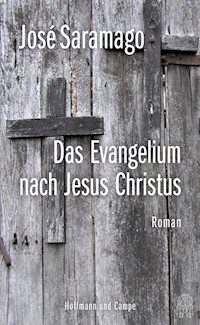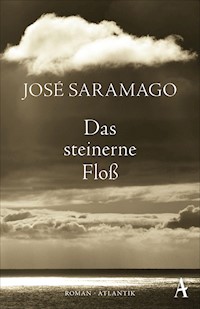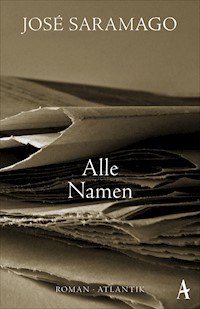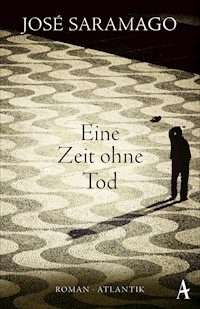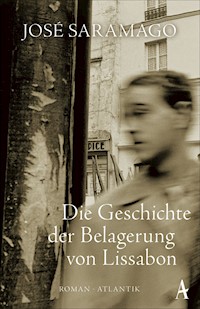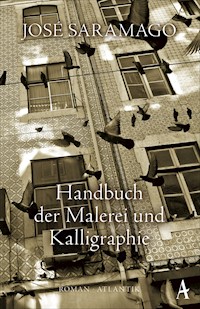
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Porträtmaler H. ist auch im Zeitalter der Fotografie noch gefragt. Die von ihm gemalten Porträts der Reichen und Mächtigen kommen gut an in den Unternehmen und Villen Lissabons. Doch eines Tages hat er genug davon, in den Porträts zu vertuschen, was nicht sichtbar werden soll. Der frühe Roman des Nobelpreisträgers José Saramago spielt in der Zeit der Diktatur in Portugal und setzt sich nicht nur mit der Kunst, sondern auch mit den politischen Verhältnissen und der Entwicklung eines Angepassten auseinander.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
José Saramago
Handbuch der Malerei und Kalligraphie
Roman
Aus dem Portugiesischen von Maria Eduarda Alvelos
Hoffmann und Campe
Unser Weg ist lang. Die bürgerliche Bildung, der intellektuelle Stolz.
Der Zwang, sich ständig zu hinterfragen. Beziehungen, die aufrecht bleiben.
Die Gefühle.
Die Vergiftung durch die gelenkte Kultur.
Paul Vaillant-Couturier
Ich werde am zweiten Bild weitermalen, ich weiß aber, dass ich es nie vollenden werde. Der Versuch misslang, und es gibt für diese Niederlage, dieses Scheitern oder diese Unmöglichkeit keinen besseren Beweis als dieses Blatt Papier, auf dem ich zu schreiben beginne: Bis der Tag kommt, früher oder später, werde ich von einem Bild zum anderen wandern und dann zu diesen Aufzeichnungen zurückkehren, oder ich werde die mittlere Etappe überspringen oder ein Wort unterbrechen, um auf der Leinwand des Porträts, das S. bestellte, oder auf dem zweiten, parallelen Bild, das S. nicht sehen wird, einen Pinselstrich auftragen. An diesem Tag werde ich nicht viel mehr wissen, als ich heute schon weiß (nämlich, dass beide Porträts unnütz sind), aber ich werde entscheiden können, ob es der Mühe wert war, mich von einer Ausdrucksform verführen zu lassen, die nicht meine eigene ist, obwohl diese Versuchung letzten Endes bedeutet, dass die Ausdrucksform, die ich bisher verwendete, derer ich mich mit so viel Fleiß bediente, als befolgte ich die festen Regeln eines Handbuchs, schließlich auch nicht die meine war. Ich will einstweilen nicht daran denken, was ich tun werde, wenn auch dieser Schreibversuch misslingt, wenn die weiße Leinwand und das weiße Blatt Papier für mich zu einer Welt geworden sind, die Millionen Lichtjahre entfernt kreist und in der ich nicht das geringste Zeichen setzen kann. Wenn, kurz gesagt, das einfache Greifen nach einem Pinsel oder einer Feder zu einem unehrlichen Geschäft geworden ist, wenn, noch einmal kurz gesagt (das erste Mal war ich nicht genau genug), ich mir selbst das Recht auf Kommunikation verwehren muss, weil ich den Versuch machte und dabei scheiterte und es dann keine weiteren Gelegenheiten geben wird.
Als Maler werde ich geschätzt von meinen Kunden. Sonst von niemandem. Die Kritiker sagten (als sie mich besprachen, für kurze Zeit und vor vielen Jahren), ich sei mindestens ein halbes Jahrhundert zurückgeblieben, was strenggenommen bedeutet, dass ich mich ähnlich einer Larve in einem Zustand zwischen Empfängnis und Geburt befinde: eine gebrechliche, missliche Andeutung eines Menschen, eine bittere, ironische Frage nach dem, was ich als Seiendes tun werde. »Noch nicht geboren.« Hin und wieder denke ich über diesen Zustand länger nach, der, für die Allgemeinheit nur vorübergehend, für mich aber endgültig wurde, und entgegen allen Erwartungen spüre ich dabei eine gewisse anregende Kante, schmerzhaft und doch angenehm wie die Schneide eines Messers, die man vorsichtig abtastet, während man im Taumel der Herausforderung das Fleisch der Fingerkuppen gegen die Gewissheit des Schnittes presst. Das ist es, was ich spüre (oder undeutlicher, ohne Messerschneide und verletzte Finger), wenn ich ein neues Bild anfange: Die weiße, glatte, noch unbehandelte Leinwand ist eine noch nicht ausgefüllte Geburtsurkunde, auf die ich (Beamter eines Standesamts ohne Archive) glaube neue Daten und andere Stammbäume eintragen zu können, die mich endgültig – oder zumindest für eine Stunde – aus der Unstimmigkeit des Nicht-geboren-Werdens herausholen. Ich tauche den Pinsel ein und nähere ihn der Leinwand, gespalten zwischen der Sicherheit der im Handbuch gelernten Regeln und dem Zögern vor dem, was ich wählen soll, um zu sein. Sodann, sicherlich verwirrt, fest gefangen in dem Zustand, derjenige zu sein, der ich seit so vielen Jahren bin (ohne zu sein), ziehe ich den ersten Pinselstrich, und im selben Augenblick bin ich vor meinen eigenen Augen verraten. Wie auf der berühmten Zeichnung Bruegels (Pieter) erscheint hinter mir ein grobschlächtiges Profil, und ich höre die Stimme, die mir aufs neue sagt, dass ich noch nicht geboren bin. Wenn ich es mir richtig überlege, bin ich ehrlich genug, um auf die Stimmen der Kritiker, Experten und Kenner verzichten zu können. Während ich die Proportionen des Modells gewissenhaft auf die Leinwand übertrage, höre ich, wie eine gewisse innere Stimme darauf insistiert, dass die Malerei etwas ganz anderes sei als das, was ich tue. Während ich den Pinsel wechsle und die zwei Schritte zurückgehe, die mir erlauben, das Knäuel, das ein »Porträt«-Gesicht immer ist, besser einzugrenzen und zu entwirren, antworte ich schweigsam: »Ja, ich weiß«, und ich fahre fort, irgendeine Landschaft zu gestalten, ein Blau, das nicht fehlen darf, und Weiß anstelle des Lichts, das ich nie werde einfangen können. Dies alles mache ich ohne Freude, nur weil es vorgeschrieben ist; im Schutz der Gleichgültigkeit, die die Kritik schließlich wie eine sanitäre Abriegelung um mich aufgerichtet hat, geschützt auch durch die Vergessenheit, in die ich langsam gesunken bin, und weil ich weiß, dass das Bild den Weg in Ausstellungen oder Galerien nie finden wird. Es wird direkt von der Staffelei in die Hände des Käufers gelangen, denn es ist mein Geschäft, auf Nummer sicher zu gehen, das Bargeld vor Augen. Arbeit habe ich mehr als genug. Ich fertige Porträts für Leute an, die genug von sich selber halten, um sie zu bestellen und in Hallen, Büros, Wohnzimmern oder Sitzungssälen aufzuhängen. Ich bürge für die Langlebigkeit, ich bürge nicht für die Kunst, man fragt auch nicht danach, auch wenn ich sie liefern könnte. Eine aufgebesserte Ähnlichkeit ist das höchste, was man von mir verlangt. Und da wir uns darin entgegenkommen können, wird niemand enttäuscht. Aber das, was ich mache, ist keine Malerei.
Trotz der Unzulänglichkeiten, die ich hier aus einer Laune heraus gebeichtet habe, habe ich schon immer gewusst, dass das wahrhaftige Porträt niemals das bestellte Porträt war. Und noch mehr: Ich glaubte schon immer zu wissen (ein sekundäres Zeichen von Schizophrenie), wie ich das getreue Abbild malen müsste, und ich habe mich immer gezwungen, darüber zu schweigen (oder ich vermeinte, mich zum Schweigen zu zwingen, wobei ich mich getäuscht und mitschuldig gemacht habe) vor dem entwaffneten Modell, das sich mir hingab, schüchtern oder ganz im Gegenteil mit vorgetäuschter Gewandtheit, sich eigentlich nur des Geldes sicher, das es mir zahlen würde, lächerlich verschreckt angesichts unsichtbarer Kräfte, die sich langsam zwischen der Oberfläche der Leinwand und meinen Augen entrollten. Ich allein wusste, dass das Bild bereits vor der ersten Sitzung fertig war und dass meine ganze Arbeit darin bestehen würde, das, was nicht gezeigt werden konnte, zu vertuschen. Die Augen – sie waren blind. Vor der weißen Leinwand stehen Maler und Modell immer komisch verschreckt da, der eine, weil er Angst hat, entlarvt zu werden, der andere, weil er weiß, dass ihm diese Entlarvung nie gelingen wird – oder noch schlimmer, er redet sich ein, mit der Selbstgefälligkeit eines kastrierten Demiurgen, der sich für männlich hält, er werde diese Entlarvung unterlassen, einfach aus Gleichgültigkeit oder Mitleid dem Modell gegenüber.
Gelegentlich denke ich und rede mir ein, ich sei der letzte übriggebliebene Porträtmaler, nach mir werde man keine Zeit mehr verschwenden mit ermüdendem Posieren auf der Suche nach Ähnlichkeiten, die einem ständig entwischen, da doch die Fotografie, heute mittels Filter und Emulsionen zur Kunst geworden, viel eher imstande scheint, die Haut bersten zu lassen und die erste innere Schicht des Menschen zu zeigen. Es macht mir Spaß zu erwägen, dass ich eine tote Kunst pflege, dass dank dieser Kunst und mit Hilfe meiner Fehlbarkeit die Leute glauben, eine bestimmte, angenehme Vorstellung von sich selber festzuhalten – eine in Gewissheiten geordnete Vorstellung, gekennzeichnet von einer Ewigkeit, die nicht erst mit der Fertigstellung des Porträts anfängt, sondern schon vorher – schon immer da war wie etwas, das immer da war, nur weil es jetzt da ist, einer Ewigkeit, die in Richtung null verläuft. Wenn ein Porträtierter den dicken, formlosen Brei seiner Gefühle und Gedanken untersuchen könnte oder wollte und wenn er dann die gängigen Worte fände, die diese Gedanken und Gefühle leicht und klar ausdrückten, dann wüssten wir, dass es für ihn tatsächlich so ist, als hätte es sein Porträt schon immer gegeben, als ein anderes, seinem gestrigen Ebenbild viel treueres Ebenbild, weil dieses – im Gegensatz zum Porträt – nicht mehr sichtbar ist. Daher kommt es nicht selten vor, dass das Modell bemüht ist, dem Porträt zu ähneln, wenn dieses es aus einer Sicht darstellt, aus der sich der Mensch lobt und akzeptiert. Es lebt der Maler für das Entdecken dieser Perspektive, es lebt das Modell für den Augenblick, in dem es zum einzigen und persönlichen Pfeiler von zwei Zweigen einer Ewigkeit wird, die unendlich vorbeizieht; da glaubt manchmal die menschliche Narrheit (Erasmus), diese Ewigkeit mit einem winzigen Knoten versehen zu können, einem Auswuchs, der imstande wäre, Kratzer zu hinterlassen auf dem riesigen Finger, mit dem die Zeit alle Spuren verwischt. Ich wiederhole: Die besten Porträts scheinen schon immer existiert zu haben, auch wenn mir der gesunde Menschenverstand sagt – wie eben jetzt –, dass der Mann mit den grauen Augen (Tizian) nicht von jenem Tizian zu trennen ist, der ihn in einem Augenblick seines ganz persönlichen Lebens malte. Denn, wenn in diesem jetzigen Augenblick etwas an der Ewigkeit teilnimmt, dann ist es das Gemälde und nicht der Maler.
Schlecht ist es allerdings um den Maler bestellt, oder, genauer gesagt, noch schlechter ist es um den Maler bestellt, wenn er ein Porträt zu malen hat und dann feststellt, dass alles, was er an die Leinwand geworfen hat, anarchische Farbe und wirre Zeichnung ist, dass die Gesamtheit der Flecken eine Ähnlichkeit mit dem Modell ergibt, die dieses zwar zufriedenstellt, nicht aber den Maler. Ich glaube, dass dies in den meisten Fällen geschieht; aber da die Ähnlichkeit schmeichelt und auch den Preis rechtfertigt, nimmt das Modell sein Bild – angeblich sein Ideal – mit nach Hause, und der Maler atmet vor Erleichterung auf, befreit von dem ironischen Spuk, der ihn bis dahin Tag und Nacht gejagt hatte. Wenn das fertige Bild länger wartet, ist es, als ob es sich um seine vertikale Achse drehe und seine anklagenden Augen auf den Maler richte: Man könnte es ein Hirngespinst nennen, wenn nicht schon gesagt wäre, es sei ein Spuk. Im Allgemeinen, wenn der Maler sein Handwerk gut genug beherrscht, sieht er gleich bei der ersten Skizze, dass er sich auf dem Holzweg befindet. Da es aber sehr viel Mühe kosten würde, dem Modell diesen Fehler zu erklären, und da sich das Modell meistens von Anfang an selbst gut gefällt und Angst hat, eine andere Richtung oder eine andere Perspektive könnte es in einem weniger vorteilhaften Licht zeigen oder es im Gegensatz wie einen Handschuhfinger von innen nach außen wenden (dies fürchtet es am meisten), lässt sich das Porträt widerstandslos weitermalen; und es wird immer sinnloser. Es ist so (ich sagte es bereits oben mit anderen Worten), als würden Maler und Modell zu Mittätern an der Zerstörung des Porträts: Man hat die Stiefel verkehrt angezogen, mit der Spitze nach hinten, und der zurückgelegte Weg, der nach den auf dem Boden der Leinwand hinterlassenen Spuren wie ein Voranschreiten erscheint, ist eigentlich ein Zurückweichen, die Flucht nach einer Niederlage, die von beiden kämpfenden Lagern gesucht und akzeptiert wurde. Der Tod, wenn er Maler und Modell aus dem Leben geholt hat; der Brand, wenn er durch einen glücklichen Zufall das Porträt zu Asche hat werden lassen, sie werden einige Lügen löschen und den Platz frei machen für neue Versuche und ein neues Ballett, den neuen Pas de deux, den andere unweigerlich wieder anfangen werden.
Auch ich wusste, als ich mit dem Porträt von S. anfing, dass meine Rechnung nicht stimmte (ein Bild ist nach meiner akademischen Auffassung immer eine arithmetische Divisionsoperation, die vierte und akrobatischste Operation). Ich wusste es sogar schon, bevor ich den ersten Pinselstrich auf die Leinwand setzte. Und trotzdem verbesserte ich nichts, noch begann ich neu, ich akzeptierte, dass die Stiefelspitzen nach Norden zeigten, während ich mich nach Süden treiben ließ, in das Sargassomeer, hin zum Untergang der Schiffe, hin zum Treffen mit dem Fliegenden Holländer. Aber mir wurde auch sofort klar, dass diesmal das Modell sich nicht hatte täuschen lassen, aber dass es bereit wäre, sich täuschen zu lassen, vorausgesetzt, ich nähme seine Bereitschaft deutlich wahr und ließe mich eben aus diesem Grund demütigen. So geschah es, dass ein Porträt, das eine gewisse förmliche Feierlichkeit ausstrahlen sollte, die Art Feierlichkeit, von der man erwartet, dass die Augen etwas sehen – und dann blind werden –, einen ironischen Zug bekam, den ich nirgends auf dem Gesicht von S. malte, der auf dem Gesicht von S. vielleicht nicht einmal vorhanden ist, der aber das Bild so entstellt, als ob es jemand gleichzeitig in zwei entgegengesetzte Richtungen zerrte, wie es unregelmäßige oder defekte Spiegel tun. Wenn ich für mich allein das Bild betrachte, sehe ich mich als Kind hinter den Fensterscheiben eines der vielen Häuser, in denen ich wohnte, und ich sehe die elliptischen Blasen der Scheiben von schlechter Qualität, wie sie in diesen Häusern gang und gäbe waren, oder diese kleinen Spitzen, die sich manchmal wie unreife Brustwarzen im Glas bilden – und draußen eine verzerrte Welt, die aus der Vertikalen geriet, wenn ich meinen Blick hinter der Scheibe hin- und herbewegte. Das Porträt – die Leinwand auf den Rahmen gespannt – schwankt vor meinen Augen, wellt sich und entflieht, und ich bin derjenige, der besiegt wegschaut, es ist nicht das erfasste Bild, das sich mir öffnet.
Ich rede mir nicht ein, dass die Arbeit nicht verloren ist, wie ich es andere Male tat, um betäubt und gleichgültig weiterzumalen. Das Porträt ist von seiner Vollendung so weit entfernt, wie ich es will, oder ihr so nahe, wie ich es bestimme. Zwei Pinselstriche könnten es vollenden, zweitausend werden für die Zeit, die ich brauche, nicht genügen. Bis gestern dachte ich noch, dass mir die Tage reichten, die ich brauche, um das zweite Porträt zu Ende zu malen, und ich glaubte, dass ich beide Porträts am gleichen Tag fertigstellen würde: S. würde das erste mitnehmen und das zweite dalassen, ich würde es behalten als Bestätigung eines Sieges, von dem zwar nur ich allein wusste, der aber meine Revanche wäre gegen den ironischen Zug, den S. an seiner Wand aufhängen würde. Aber heute, gerade weil ich vor diesem Papier sitze, weiß ich, dass meine Mühsal erst jetzt beginnt. Ich habe zwei Porträts auf zwei verschiedenen Staffeleien stehen, jedes in seinem eigenen Raum, das erste für jede eintretende Person sichtbar, das zweite verschlossen im Geheimnis meines misslungenen Versuchs; und obendrein sind diese Blätter ein neuer Versuch, den ich mit bloßen Händen, ohne Farben und Pinsel angehe, nur mit dieser Kalligraphie, diesem dunklen Faden, der sich auf- und abwickelt, der anhält bei Punkten und Kommata, der in kleinen weißen Lichtungen nach Atem schöpft und sich gleich weiterschlängelt, als liefe er durch das Labyrinth von Kreta oder die Eingeweide von S. (Interessant: Dieser letzte Vergleich fiel mir ein, ohne dass ich ihn erwartet oder gesucht hätte. Während der erste einfach eine banale klassische Reminiszenz war, macht mir der zweite, weil so einzigartig, doch noch einige Hoffnungen. Es bedeutete tatsächlich wenig, wenn ich sagte, dass ich versuche in den Geist, die Seele, das Herz, das Hirn von S. einzudringen: Die Eingeweide sind eine andere Art von Geheimnis.) Und wie ich bereits auf der ersten Seite gesagt habe, werde ich von einem Raum zum anderen hin- und hergehen, von einer Staffelei zur anderen, aber ich werde immer zu diesem kleinen Tisch zurückkehren, zu diesem Licht, zu dieser Kalligraphie, zu diesem Faden, der ständig reißt und den ich unter meiner Füllfeder zusammenbinde; der für mich trotzdem die einzige Möglichkeit der Erlösung und der Erkenntnis ist.
Was hat hier das Wort »Erlösung« zu suchen? Nichts ist rhetorischer an dieser Stelle und unter diesem Umstand, und ich hasse Rhetorik, obwohl sie zu meinem Beruf gehört, denn jedes Porträt ist rhetorisch: »Rhetorik (eine der Bedeutungen): jedes Mittel, das wir in der Rede benützen, um auf das Publikum zu wirken, um die Zuhörer zu überzeugen.« Schon besser steht es mit der »Erkenntnis«, weil danach zu streben, darum zu kämpfen schließlich Achtung gebietet, auch wenn man weiß, wie leicht man von dieser Ehrlichkeit in eine unerträgliche Pedanterie abrutscht: Oft genug verschanzt sich die Erkenntnis hinter den soliden Bastionen der Ignoranz und der Verachtung. Es hängt alles davon ab, ob man das Wort unbewusst oder allzu bewusst verwendet, und die einfache Verkettung der Laute, die das Wort wiedergeben, tritt (einfach durch einen leeren Knall der Atmosphäre, in der das Wort sich einnistet und auflöst) an die Stelle einer Arbeit, die – wenn richtig verstanden und ausgeübt – alles andere ausschließen sollte. Habe ich mich wohl verständlich gemacht? Habe ich wohl selbst verstanden? Erkenntnis ist der Vorgang des Erkennens: Das ist die einfachste Definition, und sie muss mir auch genügen, denn ich muss alles vereinfachen können, um weiterzukommen. Um Erkennen ist es bei den Bildern, die ich malte, eigentlich nie gegangen. Über die falsche Münze meines Wechsels habe ich schon genug gesagt, und mehr füge ich nicht hinzu. Wenn ich mich aber diesmal nicht einfach darauf beschränken konnte, die Leinwand nach dem Geschmack und dem Geld des Modells zu verschmieren, wenn ich zum ersten Mal anfing, ein zweites Porträt desselben Modells zu malen, und wenn ich, auch zum ersten Mal, indem ich schreibe, ein Porträt wiederhole oder dieses versuche, was mir mit den Mitteln der Malerei endgültig misslang, so liegt der Grund doch in der Erkenntnis. Als ich den ersten Strich auf die Leinwand setzte, hätte ich den Pinsel weglegen sollen; ich hätte dann die Extravaganz der Geste möglichst gut mit Entschuldigungen verdeckt, S. bis zur Wohnungstür begleitet und ihn beobachtet, wie er die Treppe hinuntergeht, gelassen oder tief einatmend, um die Ruhe wiederzugewinnen, in staunender Freude wie jemand, der einer großen Gefahr entgangen ist. Es hätte kein zweites Bild gegeben, ich hätte diese Blätter nicht gekauft, ich würde jetzt nicht so plump mit den Wörtern umgehen, sie sind härter als die Pinsel, in der Tönung schwieriger zu unterscheiden als die Farben, die dort drinnen nicht trocknen wollen. Es gäbe nicht diesen verdreifachten Mann, der zum dritten Mal versuchen will, das zu sagen, was ihm vorher zweimal nicht gelungen ist.
So war es: Das erste Porträt misslang, und dennoch gab ich nicht auf. Wenn S. sich mir entzog oder ich keinen Zugang zu ihm fand und er das wusste, so könnte das zweite, in seiner Abwesenheit gemalte Porträt die Lösung bieten. Eben das versuchte ich. Das Modell entsprach dem ersten Porträt und dem Unsichtbaren, das ich verfolgte. Die Ähnlichkeit genügte mir nicht, auch nicht die einfache psychologische Untersuchung, die jeder Lehrling leicht beherrscht und deren Grundlagen so banal sind wie die, die für ein äußerst naturalistisches und oberflächliches Bild maßgebend sind. Als S. mein Atelier betrat, wurde mir klar, dass ich alles lernen musste, wenn ich seine Sicherheit, seine Kaltblütigkeit, seine ironische Art, schön und gesund zu sein, seine jeden Tag geübte Überheblichkeit, die dort trifft, wo es am meisten wehtut, in ihre kleinsten Teile zerlegen wollte. Ich verlangte wesentlich mehr Geld als sonst, er war einverstanden und leistete sofort eine Anzahlung. Aber ich hätte den Pinsel gleich bei der ersten Sitzung weglegen sollen, als ich mich gedemütigt fühlte, ohne genau zu wissen, wodurch, ohne dass ein Wort gefallen wäre: Der erste Blick genügte, und ich fragte: »Wer ist dieser Mann?« Das ist genau die Frage, die sich kein Maler stellen sollte, trotzdem stellte ich sie. Sie zu stellen ist genauso gefährlich wie dem Psychoanalytiker zu sagen, er soll sich mehr, nur ein wenig mehr für den Patienten interessieren: Man kann jeden Schritt setzen bis an den Rand des Abgrunds – ein Schritt weiter kommt dann der unvermeidliche, hilflose, tödliche Absturz. Jede Malerei soll auf festem Boden betrieben werden, und ich glaube, die Psychoanalyse auch. Gerade um auf festem Boden zu bleiben, fing ich das zweite Porträt an: Es war meine Rettung im Doppelspiel, das ich betrieb, ich hatte einen Trumpf, der mir erlaubte, über dem Abgrund zu schweben, während ich vor den Augen aller Leute in der Niederlage, in der Demütigung des Gescheiterten unterzugehen schien. Aber das Spiel ist komplizierter geworden, und nun bin ich ein Maler, der zweimal einen Fehler beging und in dem Fehler verharrt, weil er nicht hinausfindet und nun den Umweg über eine Sprache versucht, deren Geheimnisse er nicht kennt: Egal, ob der Vergleich stimmt oder nicht, ich will versuchen, ein Rätsel zu lösen mit Hilfe eines Zeichensystems, das ich nicht kenne.
Erst heute beschloss ich, das endgültige Porträt von S. auf diese Weise zu versuchen. Ich glaube nicht, dass ich in den letzten zwei Monaten (es war gestern genau zwei Monate her, dass ich das erste Porträt anfing) je auf diesen Gedanken kam. Aber eigenartig, ich kam ganz natürlich darauf, ohne dass ich dabei überrascht war, ohne dass ich mich im Namen meiner literarischen Unfähigkeit damit auseinandergesetzt hätte; und das Erste, was ich daraufhin tat, war, dieses Papier zu kaufen, so unbefangen, als besorgte ich mir Farbtuben oder ein neues Set Pinsel. Den Rest des Tages verbrachte ich außer Haus (ich hatte keine weitere Sitzung vereinbart), ich fuhr aus der Stadt hinaus, den Stoß Papier auf dem Beifahrersitz, als führe ich eine neue Eroberung spazieren, die Art von Eroberung, für die das Auto schon Bettdecke ist. Ich habe allein zu Abend gegessen. Und als ich nach Hause zurückkehrte, ging ich stracks ins Atelier, nahm die Decke vom Porträt, trug einen beliebigen Pinselstrich auf, deckte die Leinwand wieder zu. Dann ging ich in das hintere Zimmer, in dem ich Koffer und alte Bilder aufbewahre, wiederholte die Gesten am zweiten Porträt, so automatisch intensiv, als triebe ich zum tausendstenmal einen bösen Geist aus; zuletzt ließ ich mich hier nieder, im kleinen Refugium meines Schlafzimmers, halb Bibliothek, halb Höhle, in dem Frauen nie gern verweilten.
Was will ich? Zuerst einmal nicht besiegt werden. Dann, wenn möglich, siegen. Und Siegen bedeutet, auf welche Wege mich beide Porträts auch sonst noch führen mögen, zu versuchen, die Wahrheit über S. zu erfahren, ohne dass er es ahnt, da ja seine Gegenwart und seine Bildlichkeit die Zeugen meiner bewiesenen Unfähigkeit sind, gleichzeitig zu befriedigen und mit mir selbst zufrieden zu sein. Ich weiß nicht, welche Schritte ich unternehmen werde, ich weiß nicht, welche Art von Wahrheit ich suche: Ich weiß nur, dass es für mich unerträglich wurde, nicht zu wissen. Ich bin fast fünfzig Jahre alt, ich habe das Alter erreicht, in dem die Falten nicht mehr den Gesichtsausdruck unterstreichen, sondern Ausdruck eines neuen Lebensabschnitts sind, nämlich des herannahenden Alters, und plötzlich, ich wiederhole, konnte ich es nicht mehr ertragen, zu verlieren, nicht zu wissen, im Dunkeln zu tappen, wie ein Automat zu sein, der jede Nacht davon träumt, aus den Lochstreifen seines Programms ausbrechen zu können: aus dem Bandwurmdasein zwischen Stromkreisen und Transistoren. Fragt man mich, ob ich den gleichen Entschluss gefasst hätte, wenn S. nicht erschienen wäre, dann weiß ich die Antwort nicht. Ich glaube, ich hätte ihn doch gefasst, aber ich kann es nicht schwören. Trotz allem, jetzt, da ich anfing zu schreiben, fühle ich mich, als hätte ich nie etwas anderes getan oder als wäre ich eigentlich dazu geboren.
Ich beobachte mich beim Schreiben, wie ich mich beim Malen nie beobachtet habe, und ich entdecke das Reizvolle an dieser Tätigkeit: In der Malerei kommt immer der Augenblick, in dem das Bild keinen einzigen Pinselstrich mehr verträgt (egal ob das Bild gut oder schlecht ist, es würde mit jedem Strich schlechter), während sich diese Zeilen ewig erweitern lassen, indem man Teilbeträge einer Summe, die nie addiert wird, aneinanderreiht – die Reihung selbst ist schon vollkommene Arbeit, schon endgültiges Werk, denn es ist bereits bekannt. Es ist vor allem der Gedanke der unendlichen Erweiterung, der mich reizt. Ich werde immer schreiben können, bis an mein Lebensende, während die Bilder, in sich geschlossen, zurückweisen, sie verselbstständigen sich in ihrer eigenen Haut, sie sind autoritär und – auch sie – hochmütig.
Ich frage mich, warum ich geschrieben habe, dass S. schön sei. Keines der beiden Bilder stellt ihn so dar, und zumindest das erste Bild sollte ihn von der vorteilhaften Seite zeigen oder wenigstens ein wahres, erkennbares Abbild sein, versehen mit all den schmeichelnden Zutaten eines gut bezahlten Porträts. Eigentlich ist S. nicht schön. Aber er hat die körperliche Gewandtheit, die ich mir immer gewünscht habe, wohlproportionierte Gesichtszüge, die die Sicherheit ausstrahlen, um die physisch schlaffe Männer wie ich sie einfach beneiden müssen. Er bewegt sich ungezwungen, er nimmt Platz, ohne auf den Stuhl zu schauen, und bleibt gleich richtig sitzen, er muss es sich nicht zwei- oder dreimal bequem machen, was in der Regel Verlegenheit oder Schüchternheit verrät. Man könnte sagen, er sei als Sieger geboren oder er verfüge über eine Truppe unsichtbarer Kämpfer, die an seiner Stelle kämpfen und dann nach und nach behutsam, leise, ohne große Reden sterben, die ihm den Weg ebnen, als wären sie selbst nur Besenreisig. Ich glaube nicht, dass S. ein Millionär ist, in dem Sinne, in dem man heute die Bezeichnung verwendet, aber er hat Geld zur Genüge. Das spürt man an der Art, wie er eine Zigarette anzündet, an der Art, wie er schaut. Der Reiche sieht nie, bemerkt nie, er schaut einfach und zündet die Zigarette so an, als erwarte er, dass sie bereits brenne: Der Reiche zündet eine beleidigte Zigarette an, das heißt, der Reiche zündet die Zigarette beleidigt an, weil zufällig niemand da ist, der sie ihm anzündet. Ich glaube, S. hätte es für selbstverständlich gehalten, dass ich mich beflissen hätte oder die Geste gemacht hätte. Ich rauche aber nicht und war stets scharfsichtig genug, um die prätentiöse Handbewegung zu demontieren, zu zerlegen; man greift nach dem Feuerzeug, drückt ab und lässt dann die Flamme ausgehen, die erste und die letzte Handbewegung eines Bogens, dessen Ziel je nachdem Schmeichelei, Unterwürfigkeit, Mittäterschaft oder eine subtile bzw. brutale Einladung ins Bett sein kann. Es hätte S. gefallen, wenn ich mich vor dem Geld, das er besitzt, und der Macht, die ich an ihm vermute, gebeugt hätte. Aus Tradition pflegen Künstler jedoch gewisse Privilegien, die sie, auch wenn sie davon keinen Gebrauch machen oder sie verdrehen, mit der Aura romantischer Unehrerbietigkeit umgeben, die dem Kunden das Gefühl von (provisorischer) Untergebenheit und eigentlicher Überlegenheit stärken. In dieser gewissermaßen theatralischen Beziehung spielt jeder seine Rolle. S. hätte mich im Grunde verachtet, wenn ich seine Zigarette angezündet hätte – und noch viel schlimmer: Ich hätte ihm etwas vorgetäuscht, wenn ich es getan hätte. Somit war keiner der Beteiligten überrascht, und alles verlief, wie es sich geziemte.
S. ist mittelgroß, fest, sehr gut in Form (wie mir scheint) für seine vierzig Jahre. Graue Haare hat er gerade so viel, dass sie seinem Gesicht schmeicheln, und er gäbe ein herrliches Modell für die Werbung ländlich-exquisiter Waren ab wie Pfeifen, Gewehre, Tweedanzüge (Tweed: englisches Wort, das einen recht dicken und sehr geschmeidigen Wollstoff bezeichnet, der in Schottland hergestellt wird), luxuriöse Nutzfahrzeuge, Winterurlaub oder Urlaub in der Camargue (Frankreich, Süden). Er hat einfach die Gesichtsbeschaffenheit, von der jeder Mann träumt, weil sie vom amerikanischen Film propagiert wurde und weil man damit einen bestimmten langhaarigen Frauentyp verbindet; es zahlt sich aber vielleicht nicht aus, dieses Gesicht (nicht die Frau) über den Augenblick der Momentaufnahme hinaus zu behalten. Denn das Leben besteht eher aus Banalitäten, blassen Gesichtern, schlecht rasierten oder wild gewachsenen Bärten, unfrischem Atem und dem Geruch nach ungewaschenen Körpern. Vielleicht ist S.’ Art, ein Gesicht zu sein, vielleicht sind seine Augen, sein Mund, sein Kinn, seine Nase, seine Haarwurzeln und sein Haar, seine Augenbrauen, sein Teint, seine Falten und sein Gesichtsausdruck daran schuld, dass ich nur einen einzigen wirren Farbklecks auf die Leinwand übertragen konnte, einen Klecks, der nicht einmal beim zweiten Porträt deutliche Gestalt annehmen wollte. Nicht dass da keine Ähnlichkeit bestünde, nicht dass das erste Porträt nicht das getreue, gewünschte, vorteilhafte Bild wäre, nicht zuletzt, dass das zweite Porträt als eine psychologische Analyse in der Form eines Bildes gelten könnte – in beiden Fällen weiß ich allein, dass die Leinwand noch leer ist, jungfräulich könnte man schreiben, ehrlich gesagt ist sie verschandelt. Ich frage mich jedoch wieder einmal, aus welchem Grund mich die Besessenheit ergriff, S. zu verstehen und zu erforschen, zumal er dieses Scheusal ist, das ich beschrieben habe, und mir unter den Männern und Frauen, die ich im Laufe so vieler Jahre mangelhafter Malerei porträtiert habe, viel interessantere Menschen durch die Hände gegangen sind. Ich finde keine andere Erklärung als die Alterswende, in der ich mich befinde, als die plötzlich entdeckte Demütigung, hinter den Anforderungen zurückzubleiben, nicht über die andere, schmerzhaftere Demütigung, von oben betrachtet zu werden, hinwegzukommen, nicht fähig zu sein, auf die Ironie mit Verachtung oder Sarkasmus zu antworten. Ich versuchte, diesen Mann zu zerstören, während ich ihn malte, und bin darauf gekommen, dass ich nicht zerstören kann. Das Schreiben ist kein neuer Zerstörungsversuch, es ist vielmehr der Versuch, das Innenleben zu rekonstruieren, jedes Getriebe, jedes Zahnrad dabei abmessend und abwiegend, jede Achse millimetergenau eichend, das lautlose Schwingen der Federn und das rhythmische Vibrieren der Moleküle im Stahlinneren überprüfend. Außerdem kann ich nicht umhin, S. zu hassen für den kalten Blick, den er auf mein Atelier warf, als er das erste Mal hereintrat, für das verächtliche Schnauben, für die Herablassung, mit der er mir die Hand entgegenstreckte. Ich weiß genau, wer ich bin, ein Künstler unteren Ranges, der zwar sein Handwerk versteht, dem aber das Talent fehlt, erst recht die Genialität, der lediglich über erlernte Fertigkeiten verfügt, der stets die gleichen Wege geht oder bei denselben Türen stehen bleibt, wie das Maultier eines Lieferanten, das den gewohnten Karren zieht; aber früher, wenn ich zum Fenster ging, schaute ich mir gern den Himmel oder den Fluss an, so wie Giotto es getan hätte oder Rembrandt oder Cézanne. Unterschiede waren für mich nicht besonders wichtig: Wenn eine Wolke langsam vorbeizog, so machte es keinen Unterschied, und wenn ich dann den Pinsel dem unfertigen Bild entgegenstreckte, konnte alles mögliche passieren, es konnte sogar geschehen, dass ich eine nur mir eigene Genialität entdeckte. Mein Frieden war gesichert, es konnte nur noch mehr Frieden kommen oder, wer weiß, der Aufruhr des großen Werkes. Diesen leisen, aber dennoch entschlossenen Groll kannte ich nicht, nicht dieses Wühlen im Inneren der Statue, nicht diesen scharfen und hartnäckigen Zahn, wie der eines Hundes, der in die Leine beißt, während er ängstlich um sich schaut aus Furcht, es könnte der zurückkommen, der ihn angebunden hat.
Über S.’ Physiognomie näher ins Detail zu gehen ist überflüssig. Es sind ja die beiden Porträts da, die genug aussagen über das, was am wenigsten zählt. Genauer gesagt: Sie sagen das aus, was für mich nicht ausreicht, stellen aber jeden zufrieden, der nur nach der Physiognomie schaut. Meine Arbeit wird von nun an eine andere sein: Im Leben von S. alles aufzudecken und darüber schriftlich zu berichten, ich muss zwischen der inneren Wahrheit und der glänzenden Haut unterscheiden, zwischen dem Duft und der Jauche, zwischen den gepflegten Fingernägeln und den abgeschnittenen Spitzen derselben Nägel, zwischen der mattblauen Pupille und der eingetrockneten Flüssigkeit im Augenwinkel, die einem in der Früh aus dem Spiegel entgegensticht. Meine Arbeit wird sein, zu unterscheiden, zu trennen, zu vergleichen, zu verstehen. Zu durchschauen. Genau das zu tun, was mir beim Malen nie gelang.
Wenn der Beruf einer Person über sie etwas aussagt oder etwas Neues über sie auszudrücken vermag, wenn Vorstandsvorsitzender neben einem Benefizium auch ein Offizium ist, dann halte ich fest, dass S. Vorstandsvorsitzender des Senatus Populusque Romanus ist. Was ist der Senatus Populusque Romanus? So wie ich ihn schreibe, ist er eine Maske und auch mein Spaß am Anachronismus (die beste Geschichte der Menschheit wäre die, die mit raffender Hand die Ähren, und zwar alle Ähren, am Boden umfassen könnte, den einen schnellen Schnitt vorbereitend und dann die Handbewegung, die sämtliche Zeitalter, reif, aber noch nicht zu Brot geworden, zum Himmel oder zu den Augen hochhält). Ich verkleide jedoch nicht alles, denn SPQR sind tatsächlich die Initialen des Namens des Unternehmens, in dem S. Herr ist. Ich vermische den Senat und das römische Volk mit unserem Kapitalismus und stelle fest, dass im Grunde alles derselbe Senat ist und dass sich beim Volk auch kaum etwas verändert hat. Ich habe noch einen zweiten, konfusen Grund – es mag ein forcierter Kunstgriff sein –, die Namen nicht auszuschreiben: In meinem Beruf (der Malerei) tragen wir die Farben zunächst so auf, wie sie aus der Tube kommen; sie tragen Namen, die auf immer und ewig festgelegt zu sein scheinen. Wenn wir sie aber auf der Palette oder auf der Leinwand vermischen, so ändern sie sich durch die geringste Beimischung oder durch das Licht, und eine Farbe bleibt noch als Grundton erhalten, geht dann in den nächsten Farbton über, wird zuletzt zur Mischung aus beiden, und die so neu entstandene(n) Farbe(n) kommt (kommen) zur ständig wechselnden Skala hinzu; der Vorgang, gleichzeitig Multiplikator und Multiplikand, kann wiederholt werden.
Das gilt auch für jeden Menschen, bis er stirbt (wenn er tot ist, kann man nicht mehr wissen, wer er war): Ihm einen Namen zu geben bedeutet, ihn in einem Augenblick seines Lebensweges festzuhalten, ihn vielleicht im Ungleichgewicht verharren zu lassen, ihn entstellt wiederzugeben. Die einfache Initiale lässt ihn unbestimmt, sie lässt ihn jedoch sich durch seine Bewegungen bestimmen. Ich gestehe, dass meine Phantasie etwas zu weit geht, vielleicht ist es die Faszination des einen, der gerade Schachspielen gelernt hat und glaubt, alle Kombinationsmöglichkeiten sofort ausschöpfen zu können (das Schreiben oder die Kalligraphie, die eigentlich zuerst kommt, ist mein neues Schachspiel): Es könnte auch schließlich die schlechte Angewohnheit des Kurzsichtigen sein, der aus nächster Nähe schauen muss, um genau wahrzunehmen, der nur aus diesem Grund und nicht aus eigener Leistung das entdeckt, was man nur aus der Nähe sehen kann. S. ist eine leere Initiale, die ich allein mit dem, was ich erfahren und erfinden werde, füllen kann, genauso wie ich den Senat und das römische Volk erfunden habe; aber in Bezug auf S. werde ich zwischen dem Erfahrenen und dem Erfundenen keinen Unterschied machen. Jeder beliebige Name, der mit diesem Buchstaben anfängt, kann S.’ Name sein. Alle sind bekannt, alle sind erfunden, und dennoch wird S. keinen Namen bekommen: Da ja jeder möglich ist, ist die Wahl eines bestimmten unmöglich. Ich habe meinen Grund und kann diesen sofort nachweisen. Man braucht nur die Laute der unten angeführten Namen zu zermalmen, um die Leere eines vollen Namens zu erkennen. Welchen könnte ich für S. (Es) wählen? Sá Saavedra Sabino Sacadura Salazar Saldanha Salema Salomo Sallust Sampaio Sancho Santo Saraiva Saramago Saul Seabra Sebastian Secundino Seleukos Sempronius Sena Seneca Sepúlveda Serafin Sergio Serzedelo Sidonius Sigismund Silvério Silvino Silva Silvio Sisenando Sisyphus Soares Sobral Sokrates Soeiro Sophokles Soliman Soropita Sousa Souto Sueton Suleiman Sulpicius. Ich könnte schon einen wählen, aber ich würde bereits klassifizieren, die Gattung bestimmen. Sage ich Salomo, ist es ein Mensch; sage ich Saul, ist es ein anderer; ich bringe ihn bei der Geburt um, wenn ich Seleukos oder Seneca vorziehe. Ein Seneca kann unmöglich Vorstandsvorsitzender des SPQR sein. (Seneca, Lucius Annaeus Seneca [4 v.Chr. bis 65 n.Chr.], in Córdoba geboren, lateinischer Philosoph; war Neros Erzieher, fiel dann in Ungnade und erhielt von diesem den Befehl, durch Aufschneiden der Pulsadern Selbstmord zu begehen. Traktate: Von der Ruhe des Herzens, Von der Kürze des Lebens, Naturwissenschaftliche Untersuchungen, Moralische Briefe an Lucilius.) Der Name ist wichtig, aber er verliert jede Bedeutung, wenn ich alle, die ich angeführt habe, in einem Zug, ohne Pause lese: Schon bei der zweiten Zeile werde ich ungeduldig, und bei der dritten fühle ich mich bestätigt, dass mir die Initiale durchaus genügt. Daher werde auch ich selbst ein einfaches H. sein, nicht mehr. Eine Leerstelle, könnte man sie von den Seitenrändern unterscheiden, würde genug über mich aussagen. Ich werde von allen der Geheimnisvollere sein und daher der, der am meisten über sich sagen wird (aus sich herausgehen wird). (Aus sich herausgehen: aus sich herausholen, schwanken.) Andere Menschen werden hier einen Namen tragen: Sie sind unwichtig. Von Adelina zum Beispiel werde ich den Namen sagen: Ich schlafe nur mit ihr, ich kenne sie nicht, ich will sie nicht (kennenlernen). Ich würde ihr aber den Namen wegnehmen, so wie ich sie entkleide oder sie bitte, sich zu entkleiden, an dem Tag, an dem dieser Name anfangen würde, für mich die Farbe in der Tube oder eine Blase in der Fensterscheibe zu sein. Ich würde A. sagen.
Wäre S. nicht Vorstandsvorsitzender des Senatus Populusque Romanus, hätte er mich nicht aufgesucht, um sein Porträt malen zu lassen. Er hatte die ironische Höflichkeit, es mir mitzuteilen, so wie man sich nebenbei für eine kleine Schwäche entschuldigt und sie auf willensfremde Gründe abschiebt, die man nur mit herablassendem Wohlwollen respektiert oder toleriert. Aber indem er es mir mitteilte, ließ er einen ersten Sprung an der Oberfläche erkennen, zu einer Zeit, als ich noch nicht einmal an das zweite Bild gedacht hatte. Im Sitzungssaal des SPQR hängen drei Porträts von verstorbenen Vorstandsvorsitzenden, und es war der Vorstand, der beschlossen hatte (um die Peinlichkeit zu vermeiden, wieder ein Porträt nach einem Foto in Auftrag zu geben: Dies war nach dem Tod von S.’ Vater geschehen, Maler war der große Medina[1]1), vom jetzigen Vorsitzenden noch zu seinen Lebzeiten ein Bild malen zu lassen, passend zum vierten Rahmen, der bereits an der rechten Wand, vom Eingang aus gesehen, angebracht war. S. akzeptierte es, seine Grabpyramide errichten zu lassen, und ich wurde dazu auserkoren (Medina kam nicht mehr infrage), die geheimen Kammern zu öffnen und dann zu versiegeln. Dies (weiteres fand ich später heraus) erzählte mir S. – natürlich mit anderen Worten –, damit ich es nicht auf anderen Wegen erfahren sollte, und während ich ihm zuhörte, mischte ich nachsichtsvoll die Farben auf der Palette; mir war das Lächerliche bewusst, aber das Lächerliche erträgt es nicht, angeschaut zu werden: Man braucht es gar nicht anzuschauen, um noch mehr zu hassen oder zu verachten: S. hatte sich um eine weitere Spur abscheulicher erwiesen. Ich, für mein Teil, stellte am nächsten Tag eine neue Leinwand auf die Staffelei in der Rumpelkammer und begann mit dem zweiten Porträt.
Hätte ich nicht die Skrupel eines Handwerkers, der Talent durch Genauigkeit ersetzt und aufblitzende Intuition durch langes Betrachten, so könnte ich nicht gleich die äußere Hülle des SPQR beschreiben, die sich wie bei einer Leidener Flasche nach innen fortsetzt und die Mechanik oder die Chemie, oder wie ich sonst das wahre Innere eines größeren Unternehmens bezeichnen könnte, verbirgt. Ich versuche, dies näher zu erläutern. Als ich mich zum SPQR begab, um den Raum, das Licht und die Umgebung, in der mein Bild seinen Platz finden sollte, zu studieren (die Zeit hätte ich mir ersparen können, wenn nicht meine besagten Handwerkerskrupel gewesen wären), schaute ich mir zunächst die Fassade des Hauses an, die ich von früher kaum kannte, und als ich hineinging, hatte ich das Gefühl, an einer inneren Fassade von Möbeln, Gesichtern von Angestellten, Teppichböden, schwarzen Telefonen, hellem Lack, wohliger Temperatur und sauberem Duft nach poliertem Holz vorbeizuziehen, die so undurchsichtig war wie die mit »Azulejos«[2] verkleidete Fassade, drei Stockwerke hoch, an einem Platz von nahezu provinzstädtischem Aussehen errichtet. Es war, als wäre ich in den Schlund eines schlafenden Riesen hineingestiegen, durch die Speiseröhre hinuntergeglitten, durch den Magen gewandelt und wieder hinausgeschlüpft, einfach durch das Hohle des Körpers, durch die Schleimhaut, so weit entfernt vom Kreislauf der Blutgefäße und dem Stoffwechsel der Drüsen, als würde ich von der sich dehnenden oberen Hautschicht abgestoßen. Deshalb füge ich hinzu, dass ich, auch wenn ich über das, was ich gesehen habe, berichten kann, noch nicht genau weiß, was ich gesehen habe, ich habe es noch nicht in Erkenntnis umgesetzt. Noch nicht.
Ich kann es nicht leiden, »Azulejo« zu sagen, und schon gar nicht, das Wort zu schreiben. Soweit mir bekannt (ich rede nicht von eigener Leistung, ich bin ja nur ein akademischer Maler), gibt es keine neuen Farben, die man noch erfinden könnte. Aus zwei mache ich tausend, aus drei eine Million, aus sieben das Unendliche, und wenn ich das Unendliche vermische, gewinne ich die ursprüngliche Farbe zurück und kann wieder neu anfangen. Es spielt keine Rolle, dass diese Farben keine Namen haben, dass man sie nicht benennen kann: Sie existieren und vervielfältigen sich. Aber ich kann dieses Wort nicht leiden (werde ich lernen, auch andere zu hassen?), das an etwas klebt, was ihm nicht entspricht: »Azulejo« klingt wie blau, bläulich, in Blautönen, hat nichts zu tun mit den Kacheln, die eben nicht blau sind, den Rechtecken aus bemaltem Ton, die die Fassade des SPQR verkleiden, in Gold-, Orange-, Rot- und Ockertönen, überzogen von einem ungleichmäßigen silbrigen Schimmer, der vielleicht von der Glasur herrührt. Zu bestimmten Tageszeiten ist diese Fassade sichtbar und unsichtbar: Wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel darauf scheint, verwandelt sie die zahlreichen Blumen in einen einzigen Spiegel; eine Stunde später gewinnt das Muster die Konturen zurück, die Farben erstrahlen wieder, als hätte die Glasur das Licht aufgenommen und zurückbehalten, genau auf das menschliche Auge abgestimmt, das nicht zu wenig sehen will, aber nicht zu viel sehen darf, es könnte sonst das, was es sehen wollte, übersehen und das, was es nicht sehen wollte, sehen. Zwischen dem Auge und der Haut, die das Auge sieht, besteht eine friedliche Beziehung: ob die Blindheit nicht der Schärfe des Falken in menschlichen Augenhöhlen vorzuziehen wäre? Wie schaut Julias Haut in den Augen des Adlers aus? Was sah Ödipus, als er sich mit den eigenen Nägeln blendete?
In den SPQR gelangt man durch eine Drehtür, die für mich die bürgerliche Version der Felswand ist, die der Höhle der vierzig Räuber als Eingang diente. Sie heißt nicht Sesam (krautige Pflanze) und stellt den höchsten Widerspruch in Sachen Tür dar: Sie ist immer offen und immer geschlossen. Sie ist der Schlund des Riesen, schluckend und spuckend, verschlingend und ausspeiend. Man fürchtet sich, wenn man hineingeht, ist erleichtert, wenn man herauskommt. Und man wird von plötzlicher Angst befallen, wenn man inmitten der Drehung nicht mehr draußen und noch nicht drinnen ist: Man reist durch das Innere eines Zylinders, als ginge man durch eine Luftwand, und diese Luft wäre schleimig wie der Grund eines Brunnens oder hart und zusammengepresst wie der Sockel eines Obelisken. In meiner Kindheit muss ich Erstickungsanfälle erlebt haben, Monster oder nur dunkle Gestalten (ein Neger würde weiße sagen), die in meinem Herzen saßen, sodass diese glänzende Trommel derartige Urängste in mir hervorzurufen vermag. Herauskommen ist in diesem Fall wirklich auftauchen, an die Oberfläche kommen, ausbrechen in die klare, atembare Luft.
Nun bin ich drinnen und gehe durch eine weite Halle, vorbei an einem langen wuchtigen Schalter, hinter dem die Angestellten den Kopf hochheben und langsam drehen, als wäre ihr Gesicht auch eine Drehtür voller Larven und Spinnweben. Niemand kennt mich. Am Ende der Halle, der Drehtür gegenüber, ist eine breite Treppe (»Gehen Sie gleich in den ersten Stock hinauf, und fragen Sie nach mir.«) mit ionisch gedrechseltem Holzgeländer (Erläuterung: Ein Längsschnitt würde die Voluten eines ionischen Kapitells zeigen), einem zweckmäßigen, von Messingstangen gehaltenen Teppich aus rauer Faser. Ich wundere mich über die altmodische Atmosphäre. Das Treppenhaus grenzt im oberen Stockwerk eine rechteckige Galerie ein, die auf drei Seiten von der Verlängerung des Treppengeländers eingerahmt wird. Ein Angestellter in blauer Uniform erhebt sich, sobald ich näher komme. »Ich möchte (ich verwende die höfliche Konjunktivform statt des befehlerischen Indikativs Präsens: ich will) Herrn Ing. S. sprechen.« – »Wen darf ich melden?« Ich sage meinen Namen. Für diesen Mann bin ich nur dieser Name, während er mich ins Wartezimmer führt, dennoch hält er mir die Tür auf und lässt mich allein mit den gepolsterten Stühlen, dem Teppichboden, den englischen Jagdbildern und dem schweren Kristallaschenbecher. Um bis hierher zu gelangen, ist jeder Name gut. Ab hier kann mich nur ein anderer Name führen: der Name oder die Person? Oder weder der Name noch die Person, sondern zum Beispiel S.’ Sekretärin, eine Person, die genauso privilegiert ist wie S.’ Handschuh oder Krawattenknoten? Ich setze mich nicht. In Wartezimmern, in denen ich nur kurz warten muss, setze ich mich ungern hin. Der Körper hat es sich im Sofa gerade bequem gemacht, oder er ist noch damit beschäftigt, die Schulterblätter bequem anzulehnen, für das eine Bein den richtigen Halt zu finden, damit sich das zweite natürlich darüberlege, in der künstlich ungezwungenen Art, die sofort bloßgestellt wird, wenn man länger warten muss und dazu verurteilt ist, die Beine mehrmals zu wechseln, kaum hat man es geschafft oder nur den Anfang gemacht, und schon geht die Tür auf – schroff, wenn die Person selbst kommt, schwingend, wenn ein Untergebener kommt –, man muss vom Sofa aufspringen, wird durch die übereinandergeschlagenen Beine behindert und verheddert sich in der Federung, die einen bösartig zurückhält. Und wenn die Person selbst kommt, mit ausgestreckter Hand, hat man keine Hand zum Entgegenstrecken, man ist ja völlig damit beschäftigt, ins Gleichgewicht zu kommen, in ein Gleichgewicht, das alles natürlich wirken lässt, das in dieser ersten Szene des ersten Akts keine Spur, akustisch oder visuell, von Peinlichkeit oder Unbeholfenheit hinterlässt. Ich begab mich zum einzigen Fenster des Raumes, das auf einen hässlich gestrichenen grauen Lichtschacht ging und von dem aus man im unteren Stockwerk ein weiteres Fenster sehen konnte, das – soweit ich mir den Grundriss vorstellen konnte – zur großen Halle gehören dürfte, durch die ich vorher gegangen bin. Ich konnte nur einen Mann erkennen, der an einem Schreibtisch saß, vor sich einen Haufen grüner Papierbögen (ich sage einen Haufen Papierbögen, aber ich verbessere: einen wohlgeordneten Stoß), auf der linken Seite im halbrechten Winkel zur Schreibtischkante eine Karteilade, die der Mann mit der linken Hand schnell durchging, während er in der rechten Hand einen Nummern- oder Datumstempel oder einen Stempel mit der Aufschrift »erledigt« oder einer sonstigen Aufschrift hielt. Und als der Mann beide Arme halboffen hielt, sah es aus, als hielte er sie offen für die Leere, die er vor sich hatte, die aber nur eine Leere war, weil