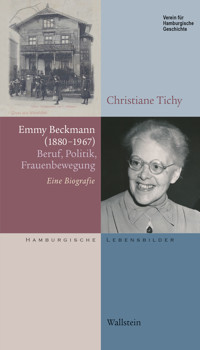Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zeithistorische Forschung und zugleich Familiengeschichte Die Historikerin Christiane Tichy schildert das Leben zweier Saatzüchter in der Weimarer Republik, im „Dritten Reich“ und in der DDR. Besonders untersucht sie, wie diese in den unterschiedlichen politischen Systemen berufliche Entscheidungen getroffen haben. Für die Zeit des „Dritten Reiches“ sind vor allem Familiendokumente als Quellen benutzt worden, für die Epoche der DDR konnten auch die Stasiakten der Betroffenen eingesehen werden. Das Buch erlaubt so einen Blick auf die Rolle der Landwirtschaft zwischen 1933 und 1945 und auf die Arbeitsweise der Stasi-Mitarbeiter auf dem Land, insbesondere in Mecklenburg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Entstehung dieses Buches, Fragestellung und Quellen
Erster Teil: 1919 bis 1945
Die Situation der Landwirtschaft, insbesondere der kommerziellen Saatzucht, in den 20er Jahren
Die Person Hans Lembke − der Ausgangspunkt
Der Saatzüchter
Der Mensch
Die Situation in Malchow 1919 bis 1933 − der Referenzrahmen von Hans Lembke in den 20er Jahren
Die vier Kinder von Hans und Luise Lembke
Die Rolle der Landwirtschaft im „Dritten Reich“
Die Saatzucht – ein Sonderfall
Umgang des Gutsbesitzers Hans Lembke mit Landarbeitern und Angestellten
Das Gut Neu-Buslar 1936 bis 1945
Biographie Rudolf Schicks bis 1936
Der Kauf des Gutes Neu-Buslar
Juden in der Landwirtschaft und die „Arisierung“ landwirtschaftlichen Besitzes
Die Romanversion
Der Kaufvertrag vom 26. Mai 1936
Ostgebiete I: Pläne für den Warthegau
Ostgebiete II: Ringuvele und Ringuvenai I und II in Litauen
Kurze Geschichte Litauens
Der baltische Feldzug der deutschen Wehrmacht
Pacht und Bearbeitung der litauischen Zweigstelle
Fremdarbeiter als Arbeitskräfte auf dem Hof
Fazit: Situation und Charakter I
Zweiter Teil: 1945 bis 1969
Malchow bei Kriegsende: Zuflucht und Verlust
Enteignung durch die Bodenreform
Rudolf Schick als Beobachtungsobjekt des Ministeriums für Staatssicherheit
Das Ministerium für Staatssicherheit
Zum Quellenbestand
Zeitraum 1950 bis 1952: Die Kartoffelsabotage
Allgemeine Erkenntnisse über MfS-Akten der Jahre 1950/52
Zeitraum 1955 bis 1959: Der Fall Dr. Baltzer
Einsichten aus den Akten I: Wie die Stasimitarbeiter vorgehen
Einsichten aus den Akten II: Der Charakter von Rudolf Schick
Charakter und Weltsicht von Rudolf Schick aus anderen Quellen
Zeitraum 1965 bis 1967: Der Konkurrenzkampf
Fazit: Situation und Charakter II
Danksagung
Anhang: Gutachten zur Wertermittlung des Gutshofs Neu-Buslar
Benutzte Quellen und Literatur
Archive
Gedruckte Quellen
Darstellungen
Abkürzungsverzeichnis
Entstehung dieses Buches, Fragestellung und Quellen
Dieses Buch ist ein Zwitter, denn es ist private Familiengeschichte und zeithistorische Forschung zugleich. Seinen Ursprung hat es darin, dass ich mich über das makellose öffentliche und private Heroenbild gewundert habe, das mir über meinen Großvater Hans Lembke (1877-1966) vermittelt wurde.1 Eine erste Möglichkeit, diesem Bild auf den Grund zu gehen, fand ich im Nachlass meiner Eltern. Durch die Lektüre ihrer Briefe und Selbstzeugnisse verwandelte sich meine vage Haltung in eine Recherche zu konkreten Fragen, die das Leben des Großvaters betrafen. Aus dem Plan einer „politischen Biographie“ entwickelte sich im nächsten Schritt das Projekt einer Doppelbiographie, da das Schicksal meines Großvaters eng mit dem seines Schwiegersohns Rudolf Schick (1905-1969) verknüpft war.
Die Ergebnisse dieser Recherche gehen letztlich über private Familiengeschichte hinaus und könnten von überindividuellem Interesse sein. Denn in der detaillierten Auswertung von bisher unbekannten Quellen trägt diese Doppelbiographie von zwei Saatzüchtern im „Dritten Reich“ und in der DDR auch zwei Puzzleteile dazu bei, wie (1) von 1933 bis 1945 der NS-Staat die Landwirte für seine Zwecke eingespannt hat und wie und aus welchen Gründen (2) in den 50er Jahren und (in diesem Einzelfall2) bis Mitte der 60er Jahre das Ministerium für Staatssicherheit das eigene agrarwissenschaftliche Führungspersonal intensiv beobachten ließ.
„Der Landwirt Prof. Dr. Lembke im Regime der DDR“ − so stand es also auf meinem Forschungsantrag an die BStU, die „Behörde für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit der ehemaligen DDR“. Sinngemäß erweitern könnte man auf: „Der Landwirt Prof. Dr. h.c. Hans Lembke in den deutschen Diktaturen im 20. Jahrhundert“, so ähnlich im analogen Antrag an das Bundesarchiv.
Zu Beginn des Projekts standen meine Fragen nach beruflichen Handlungen und Entscheidungen des Saatzüchters Hans Lembke unter zwei politisch sehr unterschiedlichen deutschen Regierungs- und Gesellschaftssystemen.
Das Besondere an seinem Lebenslauf ist nämlich, dass er offensichtlich ohne moralische Verfehlungen einerseits und trotzdem ohne Konflikte mit der Staatsmacht andererseits sein Leben in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts geführt hat und letztendlich als hoch geehrter, erfolgreicher, menschlich integrer und beruflich genialer Saatzüchter in Erinnerung ist, bei allen Menschen, die ihn kannten. Dieses Heldenbild war der Ausgangspunkt für meine Recherchen, der Grund, warum ich mich letztlich doch auf die Suche gemacht habe, obwohl ich weder Sinn für noch Kenntnisse über Landwirtschaft oder Saatzucht habe, also von der Sache, um die es Hans Lembke sein Leben lang ging, keine Ahnung habe. Meine Verbindung war rein persönlich: Ich bin die jüngste Enkelin dieses Saatzüchters, meine Mutter war seine zweite Tochter Gertrud Schröder-Lembke. Meine Qualifikation für dieses Projekt liegt darin, dass ich als Historikerin mit Quellen Erfahrung habe, seien sie auch ganz anderer Natur, und mich deshalb in die Materie „Saatzucht“ − begrenzt − einarbeiten konnte.
Zu einem Landwirt gehört das Land: das Gut Malchow auf der Insel Poel, einige Kilometer nördlich von Wismar in Mecklenburg in der Ostsee gelegen. Es geht aber nicht um eine Geschichte des Hofes Malchow, die gibt es schon, es geht auch nicht um eine umfassende Familiengeschichte Lembke-Schröder oder Lembke-Schick. Ich interessierte mich einzig für das Heroenbild, nämlich dafür, wie mein Großvater durch die Zeitläufte so heil hindurchgekommen ist.
Der Verdacht zu Beginn war natürlich: Da gibt es Brüche, die wir nicht kennen, Widersprüche im Leben und Handeln, die bisher unbekannt geblieben sind. Da wurden vielleicht Entscheidungen gefällt, die fragwürdig sind (von heute aus gesehen), die erzwungen wurden und die nur auf die damaligen Umstände zurückzuführen sind. An bisher ganz unbekannte Abgründe glaubte ich allerdings nicht. Kurz: Ich wollte ihn auf die Ebene der normalen Menschen holen.
Wie oben angedeutet, benutzte ich zunächst die privaten Quellen, die mir zur Verfügung standen, also zahlreiche Briefe und mehrere autobiographische Aufzeichnungen meiner Eltern aus den Jahren 1926 bis 1966, die mit ihrem Nachlass in meinem Haushalt gelandet waren. Die Lektüre dieser Papiere führte für die Zeit des „Dritten Reiches“ tatsächlich zu einer gewissen Irritation. Dort gab es plötzlich Hinweise auf Handlungsweisen von Hans Lembke, die auf den ersten Blick aus heutiger Sicht fragwürdig erscheinen mögen, weil sie nur unter den Lebensbedingungen im Nationalsozialismus und in der Situation des Zweiten Weltkrieges möglich waren. Konkret sind es drei Komplexe von Handlungen, die Fragen aufwarfen und die ich genauer untersucht habe.
Erstens: Auf welche Weise kaufte Hans Lembke 1936 von einem jüdischen Besitzer den Hof in Neu-Buslar, auf dem seine älteste Tochter Hanna und sein Schwiegersohn Rudolf Schick mit ihren letztlich sechs Kindern dann bis 1945 arbeiteten und lebten? War es eine „Arisierung“ oder ein normales Geschäft, wie es immer stattfinden kann?
Zweitens: Warum interessierte er sich 1940 für die Pacht oder den Kauf eines Hofes in Polen – genauer: im 1939 von deutschem Militär eroberten „Wartheland“?
Drittens: Wie kam Hans Lembke 1942/43 dazu im deutsch besetzten Litauen einen Hof und 750 ha Ackerland zu pachten und bearbeiten zu lassen?
Diese drei Fragen bilden den Kern des ersten Teils des Buches, der hauptsächlich die Zeit des „Dritten Reiches“ behandelt.
Als offizielle Quellen standen mir das Firmenarchiv der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG und Dokumente im Bundesarchiv zur Verfügung.
Für seine Lebenszeit in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR (1945 bis 1966) hat sich das Projekt in eine andere Richtung verschoben, und das hat ebenfalls mit den Quellen zu tun. Denn aus der Stasi-Unterlagenbehörde und aus dem Bundesarchiv bekam ich mit meiner Anfrage nach Hans Lembke fast ausschließlich Quellen über Rudolf Schick, Schwiegersohn und lange Zeit enger Mitarbeiter von Hans Lembke. Der Bericht über das Leben in der DDR ist dadurch in erster Linie seine Geschichte geworden. Im Bundesarchiv liegt außerdem seit dem Jahre 2008 Schicks Nachlass – umfangreich mit 117 Archiveinheiten, die drei laufende Regalmeter einnehmen. Da ich diesen Onkel und die Kartoffelzucht nicht kannte, wusste ich zunächst nicht viel mit den Akten anzufangen – fremdes Gelände war es. Jedoch erwies sich, dass ich im Laufe der Lektüre über ihn und seine herausragende Stellung in der Saatzucht Zugang zu einem wichtigen Teil des Lebens in der DDR bekommen habe. Meine Fragen beziehen sich auf die Arbeitsweise der MfS-Mitarbeiter in dieser frühen Zeit. Was interessierte sie und welche Quellen benutzten sie ihrerseits? Und als Ergebnis: Geben die Berichte und IM-Treffprotokolle „die Wahrheit“ wieder, auf welchem Gebiet auch immer man sie sucht? Wird die Persönlichkeit von Rudolf Schick nuanciert deutlich oder werden nur Klischees reproduziert?
Als eine Art Scharnier zwischen beiden Teilen kann man die Geschichte der Enteignung bzw. Bodenreform verstehen. Das Landgut Malchow als Saatzuchtbetrieb wurde im Oktober 1945 enteignet, der Besitzer Hans Lembke jedoch als Saatzuchtleiter und Geschäftsführer wieder eingesetzt. Damit hat Malchow eine Sonderstellung in der Geschichte der Bodenreform. Die Frage ist: Warum? Gab es besondere Umstände oder griffen einzelne Personen ein, so dass man eine Erklärung für diese sozusagen privilegierte Enteignung finden kann?
Es wird in diesem Buch also um zwei Saatzüchter in zwei Generationen gehen. Hans Lembke war zum Zeitpunkt der „Machtergreifung“ 1933 56 Jahre alt, selbstständiger Landwirt und Saatzüchter, der bereits die Anerkennung eines Ehrendoktors bekommen hatte, jedoch sich in schwierigen Zeitläuften behaupten musste. 1945 stand er mit 68 Jahren am Beginn des Rentenalters. Rudolf Schick war 1933 28 Jahre alt und konnte mit einer weiterhin bruchlosen wissenschaftlichen Karriere rechnen. Naturgemäß spielt deshalb Hans Lembke die Hauptrolle im ersten Teil; während Rudolf Schick von 1945 an im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Er war dann 40 Jahre alt und hatte einen erheblichen Teil seines Berufslebens noch vor sich.
Jeder Mensch, der versucht, das Leben eines Anderen darzustellen, muss sich mit einer Frage auseinandersetzen, die zwangsläufig auftaucht: Was ist wichtiger: der Charakter des Einzelnen oder die Situation, in die ihn das Schicksal gestellt hat? In den Worten des Sozialpsychologen Harald Welzer, der zugunsten der Situation Stellung nimmt:
Mithin scheint die Situation viel entscheidender für das, was Menschen tun, als die Persönlichkeitseigenschaften, die sie in diese Situation hineinbringen.3
Diese Behauptung ist die Gegenthese zu der häufigeren, populären Sichtweise, dass es Menschen mit schlechtem Charakter, mit sadistischen Trieben, mit einer Seele voller Ressentiments und Aggressionen waren, die Anhänger des Nationalsozialismus wurden und seine Verbrechen begangen haben. Ähnliche Sichtweisen sehen auch in den Protagonisten der DDR-Diktatur aggressive und verdorbene Charaktere.
Die Lebensläufe der beiden Protagonisten geben Gelegenheit, die These zu überprüfen. Denn alle bisherigen Aussagen über das Leben von Hans Lembke sind stets von der Individuums-These ausgegangen. Immer wurde seine außergewöhnliche Persönlichkeit ins Zentrum gestellt. Die Situationen, in denen er handelte, traten demgegenüber stark zurück, seine Entscheidungen wurden isoliert und nur in der abstrakten Doppelperspektive der Person als Saatzüchter und als Mensch betrachtet. Das Gleiche gilt für Rudolf Schick, wenn auch in abgeschwächtem Maße. Es ist symptomatisch, wenn seine Biographie, die von Fachkollegen geschrieben wurde, als „Biographisches Porträt“ bezeichnet wird: Der Charakter steht im Zentrum.
Zur Untersuchung der drei oben skizzierten Fragen des ersten Teils soll umgekehrt vorgegangen werden. Die Situation soll großen Raum einnehmen, wie nämlich die agrarische und bäuerliche Welt eines norddeutschen Saatzüchters zur Zeit der Weimarer Republik und des „Dritten Reiches“ aussah. Dadurch entsteht ein Raum für die Person, die ich nach meinen Quellen in diese Welt hineinsetzen und ihre Entscheidungen und Handlungen in sie einbetten und in ihrem damaligen Sinn erschließen kann. Im zweiten Teil, der die Landwirtschaft in der DDR zum Rahmen hat, soll der historische Kontext der Stasiakten ein Bild von der konkreten Situation der IMs und der Objekte ihrer Beobachtung zeichnen. Weder für die 20/40er noch für die 50/60er Jahre ist dabei Vollständigkeit angestrebt.
Für ein Verstehen (was nicht Akzeptieren oder Zustimmen bedeutet) wird es notwendig, sich in den Horizont der Jahre zwischen 1905 und 1945 bzw. 1949 und 1969 zurückzuversetzen. „Horizont“ meint den unreflektierten, unbewussten, als quasi natürlich und selbstverständlich empfundenen Orientierungsrahmen der „Lebenswelt“ der damals Lebenden, den Referenzrahmen. Das umfasst die Bewertung von Ereignissen oder Verhaltensweisen als „gut“ oder „böse“, das Empfinden, wo der eigene gesellschaftliche Ort im metaphorischen Sinne sich befindet und wo man Freunde und Feinde vermuten kann. Das sind stets überindividuelle Überzeugungen - was den Zeitgenossen als „wahr“ und als „falsch“ galt, z.B. welche Kategorien die Gesellschaft strukturierten oder vor welche Probleme sie sich gestellt sieht.4
Zeitlich und geographisch genauer müssen wir uns nun mit der Welt eines Landwirts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigen, im Industrieland Deutsches Reich.
1 Zur Entwicklung des Projekts innerhalb der Familie siehe unten die Danksagung.
2 Generell erfolgte die Überwachung natürlich bis 1989.
3 Sönke Neitzel/Harald Welzer, Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Frankfurt am Main, 2011, Prolog S. 44.
4 Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat diesen „Horizont“ als „Referenzrahmen“ bezeichnet und die Interpretationstätigkeit des Historikers als „Referenzrahmenanalyse“, siehe S. Neitzel/H. Welzer: Soldaten. S 16-82.
Erster Teil: 1919 bis 1945
Die Situation der Landwirtschaft, insbesondere der kommerziellen Saatzucht, in den 20er Jahren
Die Folgen des verlorenen Ersten Weltkrieges ab Herbst 1918 waren für die gesamte deutsche Bevölkerung dramatisch, umso mehr, als sie überraschend und entwürdigend kamen, also nicht als Konsequenz aus dem verlorenen Krieg akzeptiert wurden. Im Versailler Vertrag wurden große deutsche Gebiete, vor allem in Ostpreußen, zugunsten eines neuen Staates „Polen“ abgetrennt. Die Inflation vernichtete 1923 die Ersparnisse des Mittelstandes, die neue parlamentarische Verfassung kam von außen und stimmte nicht mit den bisherigen Vorstellungen von den Pflichten und Rechten von Bürgern und Staatsmännern überein. Die horrenden Reparationszahlungen wurden mit der für die Zeitgenossen unglaublichen Anschuldigung der Kriegsschuld begründet. Als eine ihrer Folgen besetzten Anfang des Jahres 1923 französische Truppen das Rheinland, in Thüringen gab es Aufstände der Kommunisten, in München versuchte eine Gruppe um Hitler einen Putsch, außerdem agitierten separatistische Bewegungen im Rheinland.
Die Landwirtschaft war damals ein bei weitem größerer und wichtigerer Wirtschaftssektor als heute. Obwohl man gemeinhin das Deutsche Reich dieser Jahre als Industriestaat ansieht, muss man sich doch klar machen, dass fast 30 % aller Arbeitskräfte (9,34 Millionen) auf dem Lande arbeiteten, wozu man noch Millionen von Nebenerwerbsbauern zählen muss. Ein Drittel der Bevölkerung lebte außerdem in Orten mit weniger als 2000 Einwohnern.5 Das wirtschaftliche Schicksal der Bauern war für jede Regierung ein zentraler Arbeitsbereich.
Bereits die Kriegswirtschaft und die Nachkriegsentwicklung hatten auf alle im Agrarsektor Arbeitenden katastrophale Auswirkungen gehabt.6 Die britische Blockade der Seehäfen ab Herbst 1914 hatte zur Folge gehabt, dass Kunstdünger und Kraftfutter für das Vieh nicht mehr importiert werden konnten, große Mengen Vieh mussten abgeschlachtet werden, was als „Schweinemord“ berühmt-berüchtigt wurde. Durch den fehlenden Dünger waren die Böden unfruchtbar geworden, die Erträge sanken erheblich. Der „Steckrübenwinter“ und die Erfahrung des Hungers prägten sich der Zivilbevölkerung als Kriegserfahrung ähnlich tief ein wie das Fronterlebnis den Soldaten. Verursacht wurde der Nahrungsmangel durch Fehlplanung: Es gab keinen Ersatz des nicht importierten Futtergetreides durch einheimische Ölfrüchte und Futterrüben, auch der Anbau von Kartoffeln und Zuckerrüben wurde eingeschränkt. Dazu kam ein eklatanter Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften, die vornehmlich als Soldaten eingezogen waren.7
Ab 1919 verschärfte sich der Nahrungsmangel durch den Verlust großer landwirtschaftlicher Gebiete im Osten Preußens. Die finanzielle Situation vieler Bauern wurde durch den Verdienstausfall im Krieg, niedrige Lebensmittelpreise, steigende Soziallasten und niedrige Produktivität existenzbedrohend. Die Einkommen entwickelten sich wesentlich langsamer als in anderen Wirtschaftsbereichen. Viele Höfe waren überschuldet, Zwangsversteigerungen häuften sich.8 Und die Situation verschlechterte sich weiter. Den allgemeinen Krisenjahren bis 1924 folgten nur zwei „normale“ Jahre, 1925 und 1926. Bereits 1927 wurden die ersten Auswirkungen der internationalen Agrarkrise spürbar. Dies war eine weltweite Überproduktionskrise mit rapidem Preisverfall und massiven Absatzproblemen für Agrarprodukte, die ab 1928 auch mit voller Wucht auf die Landwirte in Deutschland durchschlug.
Politisch gesehen waren vor 1914 traditionell Landwirte mit der Führungsschicht des Kaiserreichs verbunden gewesen, berühmt als „Klasse“ der Ostpreußischen Junker. Sie erwarteten also vom Staat immer finanzielle Unterstützung und Subventionen, auch vom neuen Staat der demokratischen Republik. Diese erhielten sie auch: Die Regierung richtete 1926 die „Osthilfe“ ein. Sie umfasste Preisstützungsaktionen, Umschuldungen, Verbilligung von Agrarexporten usw. Aber das alles löste die Probleme nicht. In der Folge kam es in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zu zahlreichen Protestkundgebungen der Bauern, die mit Steuerboykotten begannen und bis hin zu gesetzeswidrigen Gewaltaktionen gingen. Die Skepsis der Landwirte gegenüber der Parlamentarischen Demokratie vergrößerte sich, man sprach geradezu von „Bauernunruhen“. Es wurden agrarische Interessenparteien gegründet, die „Landvolkbewegung“ organisierte die Proteste insbesondere in Schleswig-Holstein. Die Weltwirtschaftskrise ab Oktober 1929 verschärfte das Schuldenproblem der Landwirte noch weiter, ebenso die bewusste Deflationspolitik des Reichskanzlers Heinrich Brüning. Es scheint deshalb folgerichtig, dass die Landwirte schon von 1930 an zu einem Wählerreservoir der NSDAP wurden. Ihr Protest und ihre Existenzangst wurden benutzt und systematisch verstärkt.9 Im Agrarland Mecklenburg-Schwerin erhielten die Nationalsozialisten bereits bei der Landtagswahl vom Juni 1932 eine absolute Mehrheit der Abgeordnetensitze im Landtag und bildeten die Regierung.
Wirtschaftsgeschichtlich betrachtet vollzog sich in den 20er Jahren in der Landwirtschaft der Übergang zur Industrialisierung der bäuerlichen Arbeit, es begann allmählich der Einsatz von Maschinen, die Elektrifizierung und Rationalisierung der Feld- und Erntearbeit. Eine gleiche Tendenz kann man für die Saatzucht feststellen. Die Neuzüchtung und Saatgutentwicklung wurde zunehmend von wissenschaftlich-technischen Spezialinstituten übernommen, die bisher führenden privaten Züchter wurden weniger wichtig. Diese Tendenz gehört in den welthistorischen Zusammenhang der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Naturwissenschaften einherging. In der Saatzucht begann die wissenschaftliche Züchtung von Nutzpflanzen. Mit den Erkenntnissen der Vererbungslehre Mendels, um 1900 wiederentdeckt, wollte man gezielter und sehr viel schneller zum gewünschten Zuchtresultat kommen. Aus der Verbesserung von Pflanzen ergab sich schnell die Zucht von Tieren, und in einer damals beliebten Analogie die Eugenik, die Verbesserung des menschlichen Erbgutes. Die Genetik wurde die Avantgarde der Biowissenschaften, der Schritt zur „Rassenbiologie“ war nicht weit.
Für den privaten Saatzüchter, der seine Arbeit als Handwerk, vielleicht sogar als Kunst, gewiss aber als Geschäft verstand, brachte dieser wissenschaftliche Ansatz eine neue Konkurrenzsituation. Ein prägnantes Beispiel dafür ist das 1928 – nach langen Vorarbeiten − gegründete Kaiser-Wilhelm-Institut für Züchtungsforschung in Müncheberg10, an dem Rudolf Schick von 1929 bis 1936 arbeitete. Sein Doktorvater, Erich Baur, war der führende wissenschaftliche Genetiker und Saatzuchtexperte und leitete das Institut bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1933.11
Die privaten Saatzuchtbetriebe waren zudem ein wichtiges Glied in der landwirtschaftlichen Produktionskette und litten dementsprechend zusätzlich. Denn die überschuldeten Bauern konnten sich kein Qualitätssaatgut mehr leisten, also fielen für den Züchter große Teile der Abnehmerschaft aus.12 Die Bauern wichen auf billigeres Saatgut aus, das sozusagen illegal von den Saatgutvermehrer-Betrieben angebaut wurde. Dies war möglich, da es kaum Sortenschutz und keine angemeldeten Patente für die je eigenen Züchtungen gab. So wurden dem privaten Züchter seine finanziellen Investitionen für die jahrelangen Züchtungen nicht entgolten. Vertreter der Saatgutindustrie, organisiert in der „Gesellschaft zur Förderung der privaten deutschen Pflanzenzüchtung e.V.“, drangen beim Reichstag und bei der Reichsregierung auf ein Saatgutgesetz, das den Züchter schützen sollte. Bis 1933 kam dieses aber nicht zustande. Zusammenfassend bezeichnet der Historiker Wieland die Situation der gesamten Saatgutindustrie als „im Dauertief“ seit dem Ersten Weltkrieg.13
5Adam Tooze: Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2006. S. 202.
6 Einen Gesamtüberblick gibt Ursula Büttner: Weimar. Die überforderte Republik. Stuttgart 2008, S. 213-221.
7 Eine detaillierte Analyse mit statistischem Material bei Kutz, Martin: Kriegserfahrung und Kriegsvorbereitung. Die agrarwirtschaftliche Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges in Deutschland vor dem Hintergrund der Weltkrieg I-Erfahrung, in: ZAA 32 (1984) Teil I, S. 59-82, hier S. 63-67.
8 Hans Beyer schildert den Kreislauf aus hohen Zinszahlungen, hohen Steuern, niedrigem Kapitalertrag zum Bankrott von zahlreichen Bauern, in: Agrarkrise und Ende der Weimarer Republik. In: ZAA 13 (1965), S. 65-92, hier S. 78-80.
9 Daniela Münkel zeichnet dies im Detail für den Landkreis Stade nach, in: D. Münkel: Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag, Frankfurt am Main, 1996, S. 68-85. Friedrich Grundmann beobachtet die bäuerliche Programmatik der NSDAP vor 1933, in: F. Grundmann: Agrarpolitik im Dritten Reich, Anspruch und Wirklichkeit des Reichserbhofgesetz. Hamburg 1979, S. 20-32.
10 Heute immer noch in der Saatzucht tätig, als Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. Müncheberg.
11 Näheres zur Biographie von Rudolf Schick siehe unten.
12 Prägnante Zusammenfassung der Situation bei Wieland: Wissenschaftliche Pflanzenzüchtung, S. 147-154.
13 Wieland: Wissenschaftliche Pflanzenzüchtung, S. 152.
Die Person Hans Lembke − der Ausgangspunkt
Hans Lembke begann im Jahre 1905 mit seiner Heirat mit Luise Wesenberg die selbstständige Arbeit auf dem vom Vater übernommenen Hof Malchow auf Poel. Ihre vier Kinder Hanna, Gertrud („Trude“), Hans-Georg und Adolf wurden 1906, 1908, 1910 und 1916 geboren. Von der Tradition des Kaiserreichs wurde er geprägt und erlebte den Ersten Weltkrieg in der Heimat – für den Kriegsdienst war er 1914 mit 37 Jahren bereits zu alt. Danach kam die Weimarer Republik mit ihren fortdauernden Krisen – 1918 die Niederlage, die Revolution, der Kaiser, der ins Exil gehen musste, 1919 der Versailler Vertrag mit seinen Demütigungen, die Inflation bis Ende 1923. Es folgte eine heftige Agrarkrise (ab 1927/28), die bereits die Weltwirtschaftskrise (von Oktober 1929 an) ankündigte. Mit all’ diesen Umbrüchen und neuen Herausforderungen musste er umgehen. Auch die Etablierung der NS-Herrschaft in den dreißiger Jahren brachte eine neue Lage für einen Landwirt. Die Kriegssituation ab 1939 änderte noch einmal seine Perspektive und die Katastrophe der Enteignung des eigenen Gutshofes und Saatzuchtbetriebes 1945 erforderte sowieso ein radikales Umdenken.
Trotz dieser vielen Brüche und Krisen kann man aber zwei Kontinuitäten, sozusagen Generalbasslinien, eine allgemeine und eine familienspezifische, verfolgen.
Denn auf die Ausgangsfrage nach den auf den ersten Blick so geglückten Lebensumständen von Hans Lembke war meine erste, spontane, leicht saloppe Antwort: Landwirtschaft braucht man immer. Dies formuliert der Historiker Josef Mooser wissenschaftlicher als Fazit der Untersuchung unterschiedlicher regionaler und historischer Zäsuren im 20. Jahrhundert für die Rolle der Landwirtschaft in Staat und Gesellschaft allgemein:
(...) jene Erwartungen auf gesteigerte Produktionsleistungen haben alle politischen Systeme an die Bauern herangetragen, selbstverständlich mit unterschiedlichen Methoden und allgemeinen Zielsetzungen. Es entspricht dem genannten allgemeinen Funktionswandel der Agrarpolitik im 20. Jahrhundert, dass sich aus bäuerlicher Sicht die politischen Zäsuren wohl in eigentümlicher Weise relativieren, weil Monarchie, Weimarer und Bonner Republik14, nationalsozialistische und kommunistische Diktatur mit jeweils ähnlichen Forderungen an sie herangetreten sind.15
Kurz gesagt: Man forderte und fordert weiterhin Wachstum. Die Bauern sollen mehr Weizen oder Raps ernten und mehr Schweine schlachtreif füttern – das ist gut für alles: für die Verbraucherpreise, für die Handelsbilanz, für die Devisen, die nicht für Agrarimporte ausgegeben werden müssen, nicht zuletzt für die Kriegführung. Immer jedenfalls diente die Landwirtschaft als Mittel zum Zweck der Beruhigung der Bevölkerung, gleichgültig ob von einer demokratisch gewählten oder einer diktatorischen Regierung eingesetzt.
Produktionssteigerung war damit auch für Hans Lembke das Grundelement der Kontinuität, das man voraussetzen kann. Und dies sogar in einem ausdrücklichen Sinne: Das Saatgut, das er zu bieten hatte, war eine Grundlage jeder landwirtschaftlichen Produktionssteigerung. Jeder Staat hatte darum ein enormes Interesse daran und handelte dementsprechend.
Ein zweites persönliches Moment der Kontinuität war die Erhaltung des Hofes Malchow, der seit 162716 im Besitz der Familie war, für ihn selbst und für seine vier Kinder und deren Nachkommen. Hier lagen wohl ein zentraler Antrieb seines Handelns und sein primäres Ziel, dem letztlich alles andere untergeordnet wurde. Viele Entscheidungen seines Berufslebens sind von diesem Motiv her zu verstehen.
Der Saatzüchter
Seine beruflichen Fähigkeiten werden als geradezu genial bezeichnet, z.B. „der Nestor, zählt zu den Größten seines Fachs“17. Solche Darstellungen spiegeln das traditionelle Idealbild des Saatzüchters bis Ende des 19. Jahrhunderts als Künstler mit einer besonderen Begabung, den ein instinktives Wissen von den Möglichkeiten einer Pflanze leitet, das man nicht lehren kann.
Ein prophetisch beanlagtes Auge, das Gefühl für den inneren Zusammenhang und das innerliche Werden... das kann niemand erwerben, (...) wo diese geniale Beanlagung fehlt, da werden auch (…) die Resultate entsprechen.
So drückte es einer der ersten wissenschaftlichen Pflanzenzüchter, Kurt von Rümker, im Jahre 1889 aus.18
Der Historiker Christoph Wieland vergleicht diesen „züchterischen Blick“ mit dem Wissen, das in anderen beruflichen Zusammenhängen in ähnlicher Weise als „implizites Wissen“ (tacit knowledge) bezeichnet wird.19 Damit ist der Sachverhalt umschrieben, dass es vor der wissenschaftlichen Pflanzenzucht des 20. Jahrhunderts kein objektives, von allen Experten übereinstimmend benutztes und exakt definiertes Vokabularium und keine objektiven wissenschaftlichen Methoden gab. Die Begriffe blieben als Beschreibung zufällig, nicht wirklich intersubjektiv identisch, die Arbeitsweise war intuitiv, deshalb individuell. Von daher kommt eine Beschreibung der Pflanzen durch den Züchter, die sich im Ungefähren, Bildhaften, quasi Künstlerischem bewegt. Seine Erfolge sind nicht technisch beliebig reproduzierbar. Das galt schon deshalb, weil die Wetter- und Bodenbedingungen ja sehr unterschiedlich waren.20
Ähnlich, aber doch ausgesprochen nüchtern und spürbar aus der lebenslangen Erfahrung heraus begann Hans Lembke selbst im Jahre 1947, im Alter von 70 Jahren, seine erste Universitätsvorlesung an der Universität Rostock mit einer Beschreibung des Berufs des Pflanzenzüchters. Nötig sei ein Auge für den Wuchs und die Eigenschaften der Pflanze, Geduld, langfristiges Denken und die Fähigkeit Enttäuschungen zu ertragen. Und wie bei bildenden Künstlern könne es sein, dass die Ergebnisse der Arbeit erst nach dem Tode anerkannt würden.21 Er schloss die Vorlesung mit einem Zitat von Herrmann von Helmholtz (1821-1894, als Physiologe und Physiker eine Art Universalgelehrter des 19. Jahrhunderts), mit dem dieser sein Lebensmotto umreißt:
Nicht der behagliche Genuß einer sorgenfreien Existenz und des Verkehrs im Kreise von Angehörigen und Freunden gibt eine dauernde Befriedigung, sondern nur die Arbeit, und zwar die uneigennützige Arbeit für ein ideales Ziel.
Er fügte hinzu: Wenn ihm dies zu vermitteln gelinge, dann sei die Universitätslehre ein guter Abschluss seiner Arbeit.
Der Mensch
In dem letzten Zitat scheint eine zentrale Selbstcharakterisierung auf: Arbeit. Protestantisch geprägtes Arbeitsethos nennen Soziologen diese Haltung, in Anspielung auf Max Webers Religionssoziologie. In einem Nachruf heißt es: „…dass das Leben Hans Lembkes von einer seltenen Gradlinigkeit, Zielstrebigkeit und Treue erfüllt war.“22 Das bündelt die Bewunderung und Verehrung von vielen Mitlebenden, in ähnlichen Worten drücken es Hunderte von Beileidskarten und -briefen im Nachlass aus.23 Erinnerungen von Studenten, die Lembke als Hochschullehrer erlebt haben, betonten die menschliche Gradlinigkeit und dass man Vertrauen haben konnte. So berichtet Horst Pätzold, dass er seinen Professor in einer ihn beschäftigenden Gewissensfrage – (in der DDR) bleiben oder gehen – um Rat fragte und dieser ihm riet zu bleiben – in der Hoffnung einer späteren Wiedervereinigung und um eine „Russifizierung Mitteldeutschlands“ zu verhindern. Pflichterfüllung als Lebensmotto.24
Last, not least war Hans Lembke Geschäftsmann. In seinen Briefen, auch in den Zitaten in den Tagebüchern seiner Tochter Gertrud, erscheint Hans Lembke sehr stark als rechnender Kaufmann. Ein klares Bewusstsein, dass Saatzucht sich nur mit Gewinn lohnt, und der Betriebsleiter deshalb mindestens genauso präzise auf die Einkaufs- und Verkaufspreise, auf Kosten und Erlöse achten muss, wie auf seine Zuchtergebnisse, kommt dort zum Vorschein. „Erfolg“ heißt dann: Gewinn machen, weil das eigene Saatgut so hervorragend ist, dass der Betrieb rentabel ist und auch Investitionen in die Zukunft erlaubt.
14 Es ist wohl kein Zufall, dass der erste Bereich der Integration innerhalb der damaligen EWG – sieht man von der französisch-deutschen Montanunion ein paar Jahre früher ab – von 1957 an die Landwirtschaft der sechs teilnehmenden Staaten war, die gemeinsam geschützt werden sollte.
15 Mooser, Josef: Kommentar (zu mehreren Darstellungen der Zäsuren in der Landwirtschaftsgeschichte), in: Frese, Matthias u. Prinz, Michael (Hrsg.): Politische Zäsuren und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert. Paderborn 1996, S. 389-398, hier: S. 395.
16 Dieses Datum bezieht sich auf die Bauernstelle, also das Land. Die familiären Vorfahren sind noch weiter bis zu einem „filius Lemeken“ 1357 zurückzuverfolgen, siehe Gertrud Schröder-Lembke: Malchow auf Poel. Geschichte eines Hofes. Hohenlieth bei Eckernförde. Ein Neubeginn. Frankfurt am Main 1978, S 9.
17 Z.B. Helmut Gäde, Beiträge zur Geschichte Pflanzenzüchtung und Saatgutwirtschaft in den fünf neuen Bundesländern. Berlin, Hamburg 1993, S. 41.
18 Zitiert von Thomas Wieland: „Wir beherrschen den pflanzlichen Organismus besser,...“ Wissenschaftliche Pflanzenzüchtung in Deutschland 1889-1945. München 2004, S. 11f.
19 Wieland: Wissenschaftliche Pflanzenzüchtung, S. 112, FN 295.
20 Diese Charakterisierungen stimmen auch mit der Tendenz überein, dass „große Männer Geschichte machen“, eine Überzeugung, die in der Geschichtswissenschaft und -didaktik vor dem Aufkommen von soziologischen Fragestellungen sehr verbreitet war.
21 BA N 2515/104: Vorlesungsmanuskripte, 1. Vorlesung, S. 18f.
22 Karl Grobbecken: In Memoriam Hans Lembke, in ZAA 15 (1967), S. 200f.
23 BA N 2515, 103.
24 Horst Pätzold: Nischen im Gras. Ein Leben in zwei Diktaturen. Hamburg 1997, S. 177f.
Die Situation in Malchow 1919 bis 1933 − der Referenzrahmen von Hans Lembke in den 20er Jahren
Am 2. Oktober 1928 notierte Gertrud Lembke in ihrem Tagebuch: