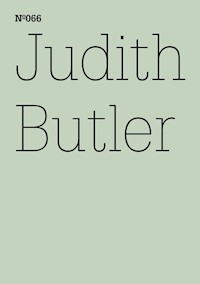15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Amerikanischen bezeichnet der Terminus hate speech jede verletzende Rede wie Beleidigung, Drohung, Schimpfnamen. Unter Rückgriff auf die Sprechakttheorie von J.L. Austin diskutiert Judith Butler einerseits die gegenwärtige Debatte der hate speech, um andererseits zu einer allgemeinen Theorie der Performativität des politischen Diskurses zu gelangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Im Amerikanischen bezeichnet der Termninus hate speech jede verletzende Rede wie Beleidigung, Drohung, Schimpfnamen. Unter Rückgriff auf die Sprechakttheorie von J. L. Austin diskutiert Judith Butler einerseits die gegenwärtige Debatte der hate speech, um andererseits zu einer allgemeinen Theorie der Performität des politischen Denkens zu gelangen. Es gelingt ihr zu zeigen, daß das Sprechen zwar durch den gesellschaftlichen Kontext definiert wird, aber dennoch durch die Fähigkeit ausgezeichnet ist, mit diesem Kontext brechen zu können. Diese ambivalente Struktur im Herzen der Performität beinhaltet, daß Widerstands- und Protestbewegungen innerhalb des politischen Diskurses teilweise von den Mächten erzeugt werden, denen man entgegentritt. Die Strategie, der man daher nach Butler folgen sollte, besteht darin, sich die Kraft des verletzenden Sprechens fehlanzueignen, um den verletzenden Verfahren entgegenzutreten.
Judith Butler, geboren 1956, lehrt Rhetorik, Komparatistik und Gender Studies in Berkeley, Kalifornien. Im Suhrkamp Verlag veröffentlichte sie zuletzt DieMacht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen (stw 1989) sowie Anmerkung zu einer performativen Theorie der Versammlung (stw 2258).
Judith Butler Haß spricht
Zur Politik des Performativen
Aus dem Englischen von Kathrina Menke und Markus Krist
Suhrkamp
Die englische Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel Exitable Speech. A Politics of the Performative bei Routledge (New York).
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 6. Auflage der Ausgabe der edition suhrkamp 2414.
© 2006, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
© Judith Butler 1997
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77362-8
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einleitung
Wie Sprache verletzen kann
Unerwartete Anrufe
Szenarien der Äußerung
Sprechakte als Anrufung
Benennung als verletzende Handlung
Schema
1. Flammende Taten, verletzendes Sprechen
Von hate speech zu Pornographie
2. Souveräne performative Äußerungen
MacKinnon und die Logik der pornographischen Äußerung
Angriff auf die Universalität
Der Staat spricht /Haß spricht
3. Das ansteckende Wort: Paranoia und »Homosexualität« in der amerikanischen Armee
4. Implizite Zensur und diskursive Handlungsmacht
Wider den Zensor
Sprechakte, politisch
Die stillschweigende Performativität der Macht
Nachbemerkung zur deutschen Taschenbuchausgabe
Register
»Das Verunglücken ist eine Krankheit, der alle Handlungen ausgesetzt sind, die in allgemein üblichen Formen oder zeremoniell ablaufen müssen, also alle konventionalen Handlungen.«
J. L. Austin
Einleitung
Wie Sprache verletzen kann
Welche Art von Behauptung stellt man eigentlich auf, wenn man sagt, durch Sprache verletzt worden zu sein? Im Grunde schreibt man der Sprache eine Handlungsmacht zu, nämlich die Macht zu verletzen, wobei wir uns selbst in die Position der Objekte dieser Verletzung versetzen. Man behauptet also, daß die Sprache handelt, und zwar gegen uns handelt. Und auch diese Behauptung ist ein sprachliches Geschehen, wie jenes erste der sprachlichen Verletzung; man will es deren Kraft entgegensetzen. Wir machen also auch dann von der Kraft der Sprache Gebrauch, wenn wir versuchen, ihr entgegenzutreten. Wir sind gefangen in einer Bindung, die keine Zensur zu lösen vermag.
Es stellt sich die Frage, ob Sprache uns verletzen könnte, wenn wir nicht in einem bestimmten Sinne »sprachliche Wesen« wären, die der Sprache bedürfen, um zu sein. Beruht unsere Verletzbarkeit durch die Sprache vielleicht darauf, daß es ihre Bedingungen sind, die uns konstituieren? Denn wenn wir sprachlich geprägt sind, dann geht diese prägende Macht jeder Entscheidung, die wir im Hinblick auf sie treffen, voraus und beleidigt uns sozusagen von Anfang an durch ihre vorgängige Kraft.
Doch enthüllt die Beleidigung ihr wahres Ausmaß erst mit der Zeit. Eine der ersten Formen sprachlicher Verletzung, die man kennenlernt, ist die Erfahrung, bei einem Schimpfnamen gerufen zu werden.1 Aber nicht jede Namensgebung ist verletzend. Einen Namen zu erhalten gehört auch zu den Bedingungen, durch die das Subjekt sich sprachlich konstituiert. Tatsächlich zählt die Benennung zu den Beispielen, die Althusser anführt, um die »Anrufung« zu erläutern.2 Folgt nun die Macht der Sprache, uns zu verletzen, aus ihrer Macht der Anrufung? Und wenn dem so ist, auf welche Weise schält sich aus dieser ermächtigenden Verletzbarkeit die sprachliche Handlungsmacht heraus?
Das Problem des verletzenden Sprechens wirft die Frage auf, welche Wörter verwunden und welche Repräsentationen kränken, wobei wir zugleich angewiesen sind, unsere Aufmerksamkeit auf die geäußerten, äußerbaren und ausdrücklichen Aspekte der Sprache zu konzentrieren. Allerdings ist die sprachliche Verletzung offenbar nicht nur ein Effekt der Wörter, mit denen jemand angesprochen wird, sondern ist der Modus der Anrede selbst, ein Modus – eine Disposition oder eine konventionelle Haltung –, der das Subjekt anruft und konstituiert.
Durch den Namen, den man erhält, wird man nicht einfach nur festgelegt. Insofern dieser Name verletzend ist, wird man zugleich herabgesetzt und erniedrigt. Doch enthält der Name auch eine andere Möglichkeit, da man durch die Benennung auch eine bestimmte Möglichkeit der gesellschaftlichen Existenz erhält und erst in ein zeitliches Leben der Sprache eingeführt wird, das die ursprünglichen Absichten, die der Namensgebung zugrunde lagen, übersteigt. Während also die verletzende Anrede ihren Adressaten scheinbar nur festschreibt und lähmt, kann sie ebenso eine unerwartete, ermächtigende Antwort hervorrufen. Denn wenn »angesprochen werden« eine Anrufung bedeutet, dann läuft die verletzende Anrede Gefahr, ein Subjekt in das Sprechen einzuführen, das nun seinerseits die Sprache gebraucht, um der verletzenden Benennung entgegenzutreten. Die verletzende Anrede übt ihre Kraft auf denjenigen aus, den sie verletzt. Doch um was für eine Kraft handelt es sich, und wie lassen sich ihre Bruchstellen ausfindig machen?
Um zu erkennen, was der Kraft3 einer Äußerung ihre Wirksamkeit und ihren performativen Charakter verleiht, muß nach J. L. Austin diese Äußerung zunächst innerhalb der »gesamten Sprechsituation« verortet werden.4 Allerdings ist nicht leicht zu erkennen, wie diese Gesamtheit am besten abzugrenzen ist. Untersucht man Austins eigene Theorie, so zeigt sich zumindest ein Grund für diese Schwierigkeit: Austin unterscheidet nämlich zwischen »illokutionären« und »perlokutionären« Sprechakten. Die ersteren tun das, was sie sagen, indem sie es sagen, und zwar im gleichen Augenblick. Die zweite Kategorie umfaßt Sprechakte, die bestimmte Effekte bzw. Wirkungen als Folgeerscheinungen hervorrufen: Daraus, daß sie etwas sagen, folgt ein bestimmter Effekt. Der illokutionäre Sprechakt ist also selbst die Tat, die er hervorbringt, während der perlokutionäre Sprechakt lediglich zu bestimmten Effekten bzw. Wirkungen führt, die nicht mit dem Sprechakt selbst zusammenfallen.
In solchen illokutionären Fällen müßte man für die Abgrenzung des »gesamten« Sprechaktes zweifellos untersuchen, wie im Augenblick der Äußerung bestimmte Konventionen aufgerufen werden; ob die Person, die sie aufruft, dazu autorisiert ist; und ob angemessene Umstände für die Äußerung vorliegen. Aber wie läßt sich die Art der »Konvention« abgrenzen, die illokutionäre Äußerungen voraussetzen? Die Äußerungen tun, was sie sagen, im Ereignis des Sagens; sie sind nicht bloß konventional, sondern, in Austins eigenen Worten, »rituell oder zeremoniell«. Sie funktionieren als Äußerungen nur, insofern sie in Form eines Rituals auftreten, d. h. in der Zeit wiederholbar sind und damit ein Wirkungsfeld aufrechterhalten, das sich nicht auf den Augenblick der Äußerung selbst beschränkt.5 Der illokutionäre Sprechakt vollzieht die Tat im Augenblick der Äußerung. Da dieser jedoch ritualisiert ist, handelt es sich niemals bloß um einen einzelnen Augenblick. Der ritualisierte Augenblick stellt vielmehr eine kondensierte Geschichtlichkeit dar: Er überschreitet sich selbst in die Vergangenheit und die Zukunft, insofern er ein Effekt vorgängiger und zukünftiger Beschwörungen der Konvention ist, die den einzelnen Fall der Äußerung konstituieren und sich ihm zugleich entziehen.
Austins Behauptung, daß die Kraft der Illokution nur erkennbar ist, wenn sich die »gesamte« Situation des einzelnen Sprechaktes bestimmen läßt, birgt also eine konstitutive Schwierigkeit. Wenn die Zeitlichkeit der sprachlichen Konvention – als Ritual betrachtet – den einzelnen Fall ihrer Äußerung übersteigt und wenn dieser Überschuß nicht vollständig identifizierbar oder faßbar ist (denn über Vergangenes und Zukünftiges läßt sich nicht mit Gewißheit berichten), dann wird offenbar die »gesamte« Sprechsituation u. a. gerade dadurch konstituiert, daß die Totalisierung jedes konkreten Falles scheitern muß.
So genügt es nicht, den entsprechenden Kontext für den fraglichen Sprechakt festzustellen, um seine Effekte einschätzen zu können. Die Sprechsituation ist keine bloße Spielart des Kontextes, der einfach durch sprachliche und zeitliche Grenzen zu definieren wäre. Durch das Sprechen verletzt zu werden bedeutet, daß man Kontext verliert, also buchstäblich nicht weiß, wo man ist. Vielleicht macht tatsächlich gerade das Unvorhersehbare des verletzenden Sprechens die Verletzung aus, der Adressat wird seiner Selbstkontrolle beraubt. Im Augenblick der verletzenden Anrede wird gerade die Fähigkeit gefährdet, die Situation des Sprechaktes abzugrenzen. Auf verletzende Weise angesprochen zu werden bedeutet nicht nur, einer unbekannten Zukunft ausgesetzt zu sein, sondern weder die Zeit noch den Ort der Verletzung selbst zu kennen und diese Des-orientierung über die eigene Situation als Effekt dieses Sprechens zu erleiden. In diesem vernichtenden Augenblick wird gerade die Unbeständigkeit des eigenen »Ortes« innerhalb der Gemeinschaft der Sprecher sichtbar. Anders gesagt: Man kann durch dieses Sprechen »auf seinen Platz verwiesen« werden, der aber möglicherweise gar keiner ist.
Man spricht von einem Überleben in der Sprache. Tatsächlich macht der Diskurs über hate speech immer wieder solche Andeutungen. Wenn behauptet wird, daß »Sprache verletzt« oder, um die Redewendung von Richard Delgado und Mari Matsuda zu zitieren, daß »Wörter verwunden«, so verknüpfen sich hier ein sprachliches und ein physisches Wortfeld.6 Der Gebrauch eines Ausdrucks wie »verwunden« suggeriert, daß man aufgrund bestimmter Handlungsweisen der Sprache das Hervorrufen eines körperlichen Schmerzes und die Verletzung parallel setzen kann. Charles R. Lawrence III beschreibt die rassistische Rede als »sprachlichen Angriff«, wobei er betont, daß der Effekt rassistischer Beschimpfungen »wie ein Schlag ins Gesicht ist. Die Verletzung erfolgt unmittelbar.« Einige Formen rassistischer Beschimpfung »rufen (auch) physische Symptome hervor, die das Opfer zeitweise außer Gefecht setzen«.7 Solche Formulierungen suggerieren, daß die sprachliche Verletzung wie eine physische Verletzung verfährt; doch weist gerade die Gleichsetzung darauf hin, daß es sich letztlich um zwei ungleiche Sachverhalte handelt. Der Vergleich könnte aber auch implizieren, daß beide nur metaphorisch gleichzusetzen sind. Allem Anschein nach gibt es für das Problem der sprachlichen Verletzung keine spezifische Sprache, so daß diese sozusagen gezwungen ist, ihr Vokabular der körperlichen Verletzung zu entlehnen. In diesem Sinne scheint die Verknüpfung zwischen physischer und sprachlicher Verletzbarkeit für die Beschreibung der letzteren selbst wesentlich zu sein. Die Tatsache, daß es keine eigentümliche Beschreibung der sprachlichen Verletzung gibt, macht es einerseits schwierig, die Besonderheit der sprachlichen Verletzbarkeit gegenüber der körperlichen zu bestimmen. Andererseits deutet die Tatsache, daß bei nahezu jeder Beschreibung sprachlicher Verletzungen auf körperliche Metaphern zurückgegriffen wird, auf eine besondere Bedeutung dieser somatischen Dimension für das Verständnis des durch Sprache erzeugten Schmerzes hin. Bestimmte Wörter oder Anredeformen wirken nicht nur als Bedrohungen des körperlichen Wohlbefindens; vielmehr gilt in einem strengeren Sinn, daß der Körper durch die Anredeformen wechselweise erhalten und bedroht wird.
Sprache erhält den Körper nicht, indem sie ihn im wörtlichen Sinn ins Dasein bringt oder ernährt. Vielmehr wird eine bestimmte gesellschaftliche Existenz des Körpers erst dadurch möglich, daß er sprachlich angerufen wird. Um das zu verstehen, muß man sich eine unmögliche Szene vorstellen, nämlich einen Körper, dem noch keine gesellschaftliche Definition verliehen wurde, der für uns also strenggenommen zunächst unzugänglich ist, aber im Ereignis einer Anrede, eines benennenden Rufs, einer Anrufung, die ihn nicht bloß »entdeckt«, sondern allererst konstituiert, zugänglich wird. Auch wenn wir glauben, daß man, um angeredet zu werden, zuerst anerkannt sein muß, scheint hier Althussers Umkehrung von Hegel zutreffend: Die Anrede selbst konstituiert das Subjekt innerhalb des möglichen Kreislaufs der Anerkennung oder umgekehrt, außerhalb dieses Kreislaufs, in der Verworfenheit.
Man könnte einwenden, daß die Situation alltäglicher ist: Ein bestimmtes bereits konstituiertes, leibliches Subjekt wird bei dem einen oder anderen Namen gerufen. Doch warum scheinen diese Namen, die es erhält, beim Subjekt eine Todesangst wachzurufen bzw. die Frage aufzuwerfen, ob es überleben wird oder nicht? Warum sollte eine bloße sprachliche Anrede eine solche Angstreaktion hervorrufen? Ist diese Angst nicht u. a. darauf zurückzuführen, daß die gegenwärtige Anrede jene anderen, prägenden hervorruft und reinszeniert, die die Existenz verliehen und weiter verleihen? Angesprochen zu werden bedeutet also nicht nur, in dem, was man bereits ist, anerkannt zu werden; sondern jene Bezeichnung zu erhalten, durch die die Anerkennung der Existenz möglich wird. Kraft dieser grundlegenden Abhängigkeit von der Anrede des anderen gelangt das Subjekt zur »Existenz«. Das Subjekt »existiert« nicht nur dank der Tatsache, daß es anerkannt wird, sondern dadurch, daß es im grundlegenderen Sinne anerkennbar ist.8 Die sprachlichen Bezeichnungen, die die Anerkennung ermöglichen, sind ihrerseits konventional, d. h. die Effekte und Instrumente eines gesellschaftlichen Rituals, die oftmals durch Ausschluß und Gewalt über die sprachlichen Bedingungen einer Überlebensfähigkeit der Subjekte entscheiden.
Wenn die Sprache den Körper erhalten kann, so kann sie ihn zugleich in seiner Existenz bedrohen. Die Frage, in welcher spezifischen Art und Weise die Sprache Gewalt androht, scheint an die primäre Abhängigkeit gebunden, die jedes sprachliche Wesen durch die anrufende oder konstitutive Anrede des anderen erfährt. In ihrem Buch The Body in Pain stellt Elaine Scarry die These auf, daß die Androhung von Gewalt eine Bedrohung für die Sprache in ihrer welt-schaffenden und sinnkonstituierenden Möglichkeit ist.9 Ihre Formulierung stellt tendenziell Gewalt und Sprache als Gegensätze gegenüber. Doch was, wenn Sprache in sich selbst ihre eigene Möglichkeit der Gewalt und Zerschlagung der Welt birgt? Scarry begreift den Körper nicht nur als der Sprache vorgängig, sondern legt überzeugend dar, daß der körperliche Schmerz sprachlich nicht auszudrücken ist, daß er die Sprache zersetzt und daß zugleich die Sprache dem Schmerz entgegentreten kann, selbst wenn sie ihn nicht zu fassen vermag. Durch die Unrepräsentierbarkeit des Schmerzes, den man repräsentieren möchte, wird das moralisch gebotene Bemühen, den Körper in seinem Schmerz zu repräsentieren, unterlaufen (wenn auch nicht ganz unmöglich). Nach Scarry besteht eine der verletzenden Folgen der Folter darin, daß der Gefolterte die Fähigkeit einbüßt, das Geschehen der Folter sprachlich zu bezeugen. Die Folter hat also unter anderem den Effekt, das eigene Zeugnis auszulöschen. Scarry zeigt, wie bestimmte Diskursformen, z. B. das Verhör, den Folterprozeß unterstützen und ihm Vorschub leisten. Hier kommt die Sprache der Gewalt zu Hilfe, ohne offenbar ihre eigene Gewalt auszuüben. Damit stellt sich die Frage: Wenn bestimmte Formen der Gewalt die Sprache gleichsam außer Kraft setzen, wie läßt sich dann die spezifische Form von Verletzung erklären, die Sprache selbst ausübt?
In ihrer Rede zur Verleihung des Literaturnobelpreises 1993 nimmt Toni Morrison speziell auf »die Gewalt der Repräsentation« Bezug. »Die repräsentative Sprache«, schreibt sie, »repräsentiert nicht nur Gewalt; sie ist Gewalt.«10 In einer Parabel, in der diese Figur weder falsch noch irreal ist, sondern etwas Wahres über die Sprache aussagt, stellt Morrison die Sprache selbst als »etwas Lebendiges« dar. In der Parabel spielen einige kleine Kinder einer blinden Frau einen grausamen Streich: Sie fordern sie auf, zu raten, ob der kleine Vogel, den die Kinder in den Händen halten, lebendig oder tot ist. Die blinde Frau antwortet, indem sie die Frage zurückweist und verschiebt: »Ich weiß es nicht, doch ich weiß, daß es in eurer Hand liegt . . . Es liegt in eurer Hand.«11
In ihrer nachfolgenden Deutung entschließt sich Morrison, die Frau in der Parabel als erfahrene Schriftstellerin und den Vogel als Figur für die Sprache zu lesen. Sie stellt Vermutungen darüber an, was diese erfahrene Schriftstellerin wohl über die Sprache denkt: »Sie denkt die Sprache sowohl als System wie auch als etwas Lebendiges, größtenteils jedoch als Handlungsmacht, als eine Handlung, die Folgen hat. Somit ist die Frage, die die Kinder stellen, ›Ist er tot oder lebendig?‹, nicht irreal, weil die Frau die Sprache als dem Tod und der Auslöschung unterworfen denkt.«12
Morrison beschreibt hier in Form von Mutmaßungen, was die erfahrene Schriftstellerin mutmaßt: eine Spekulation sowohl in als auch über die Sprache und ihre konjekturellen Möglichkeiten. Ferner verkündet Morrison, weiterhin innerhalb des figurativen Rahmens, dessen »Realität«, und zwar in figurativen Begriffen. Wenn die Frau die Sprache als etwas Lebendiges denkt, führt Morrison uns die Ausführung dieses Akts der Ersetzung vor, jene Gleichsetzung, durch die Sprache als Leben vorgestellt wird. Das »Leben« der Sprache wird also durch den Vollzug der Gleichsetzung veranschaulicht. Doch wie geschieht diese Gleichsetzung?
Sprache wird »größtenteils als Handlungsmacht gedacht, als eine Handlung, die Folgen hat«, ein erweitertes Tun oder Performatives mit bestimmten Effekten. Das ist eine recht knappe Definition. Schließlich wird die Sprache als Handlungsmacht »gedacht«, d. h. als solche gesetzt oder konstituiert. Doch wird sie als Handlungsmacht gedacht; der Gedanke von der Handlungsmacht der Sprache wird erst durch eine figurative Ersetzung möglich. Und insofern diese Formulierung ihrerseits in der Sprache dargeboten wird, ist die »Handlungsmacht« der Sprache nicht nur das Thema dieser Formulierung, sondern ihr eigenes Tun. Diese Setzung und diese Figuration erläutern also die sprachliche Handlungsmacht.
Man mag einwenden, daß man der Sprache keine Handlungsmacht zuschreiben kann, da nur Subjekte »Dinge mit der Sprache tun« können und die Handlungsmacht in den Subjekten wurzelt. Ist aber die Handlungsmacht der Sprache dieselbe wie die des Subjekts? Oder gibt es eine Möglichkeit, beide voneinander abzuheben? Morrison beschreibt nicht nur die Handlungsmacht als Figur für Sprache, sondern umgekehrt auch Sprache als Figur für die Handlungsmacht, deren »Realität« unbestreitbar sei. Sie schreibt: »Wir sterben, und darin liegt vielleicht der Sinn des Lebens. Doch wir ›tun die Sprache‹, und hierin liegt möglicherweise das Maß unseres Lebens.«13 Morrison stellt nicht einfach fest: »Sprache ist Handlungsmacht«, denn diese Art von Behauptung würde der Sprache gerade die Handlungsmacht entziehen, die Morrison vermitteln will. Durch ihre Weigerung, auf die grausame Frage der Kinder zu antworten, verschiebt die blinde Frau nach Morrison »die Aufmerksamkeit von den Behauptungen der Macht hin zu dem Instrument, mittels dessen diese Macht ausgeübt wird«.14 In ähnlicher Weise weigert sich Morrison, dogmatische Aussagen über das Wesen der Sprache aufzustellen, weil diese verschleiern würden, auf welche Weise das »Instrument« der Aussagen am Wesen der Sprache teilhat. Gerade weil keine Aussage auf ihr Instrument reduzierbar ist, wird Sprache als »in sich geteiltes« Wesen begründet. Das Scheitern der Sprache daran, ihre eigene Instrumentalität abzuschütteln, d. h. ihre Rhetorizität, ist im genauen Sinn das Unvermögen der Sprache, sich selbst auszulöschen, sei es im Erzählen einer Geschichte oder in der Referenz auf eine existierende Sache oder aber in den flüchtigen Szenarien des Gesprächs.
Bezeichnenderweise bedeutet »Handlungsmacht« für Morrison weder dasselbe wie »Kontrolle« noch eine Funktion des Systemcharakters der Sprache. Anscheinend kann man nicht zuerst von menschlichem Handlungsvermögen berichten, um dann, im zweiten Schritt, die besondere Form der Handlungsmacht zu bestimmen, die die Menschen in der Sprache innehaben. Wir »›tun die Sprache‹, und hierin liegt möglicherweise das Maß unseres Lebens«.
Wir tun Dinge mit der Sprache, rufen mit der Sprache Effekte hervor, und wir tun der Sprache Dinge an; doch zugleich ist Sprache selbst etwas, was wir tun. Sprache ist ein Name für unser Tun, d. h. zugleich das, »was« wir tun (der Name für die Handlung, die wir typischerweise vollziehen), und das, was wir bewirken; also die Handlung und ihre Folgen.
In der Parabel, die Morrison erzählt, wird die blinde Frau mit einer erfahrenen Schriftstellerin gleichgesetzt. Diese Deutung weist darauf hin, daß das Schreiben in gewissem Maße blind ist, weil es nicht wissen kann, in welche Hände es fallen wird, wie es gelesen und gebraucht werden wird oder aus welchen letzten Quellen es sich herleitet. Die Szene in der Parabel ist eine Gesprächssituation, in der die Kinder die Blindheit der Frau ausnutzen, um sie vor eine Wahl zu stellen, die sie nicht treffen kann; während die Frau gerade die Kraft dieser Anrede liest und damit eine Handlungsmacht ausübt, die die Anrede ihr absprechen wollte. Die blinde Frau trifft also keine Wahl, sondern lenkt die Aufmerksamkeit auf »das Instrument, mittels dessen die Macht ausgeübt wird«, wodurch sie deutlich macht, daß die Wahl in den Händen ihrer Gesprächspartner liegt, die sie nicht sehen kann. Nach der Interpretation von Morrison kann die Frau nicht wissen, ob die Sprache in den Händen derer, die sich des Sprechens mit grausamer Kraft bedienen, leben oder sterben wird. Sowohl in der Parabel als auch in der Lesart von Morrison ist die Frage der Verantwortung von zentraler Bedeutung, bildlich dargestellt in den »Händen« der Kinder bzw. derer, die die Verantwortung dafür übernehmen, ob die Sprache leben oder sterben wird. Die Schriftstellerin ist blind für die Zukunft der Sprache, in der sie schreibt. Somit wird Sprache »größtenteils als Handlungsmacht« gedacht, im Unterschied zu den Formen der Beherrschung oder Kontrolle einerseits und der Geschlossenheit des Systems andererseits.
Morrisons Analogie beinhaltet, daß die Sprache wie etwas Lebendiges lebt oder stirbt und daß die Frage des Überlebens von zentraler Bedeutung für das Problem ist, wie die Sprache gebraucht wird. Morrison behauptet, daß die »repressive Sprache [. . .] Gewalt ist« und nicht bloß eine Repräsentation von Gewalt darstellt. Die repressive Sprache vertritt nicht die Stelle der Erfahrung von Gewalt; sie übt ihre eigene Form von Gewalt aus. Die Sprache bleibt dann lebendig, wenn sie es ablehnt, die Ereignisse und Leben, die sie beschreibt, »einzuschließen« oder »einzufangen«.15 Wenn sie dies versucht, verliert die Sprache nicht nur ihre Lebendigkeit, sondern erlangt eine eigene Gewaltsamkeit, die Morrison durch ihre ganze Lektüre hindurch mit einer statischen Sprache und der Zensur assoziiert. »Die Lebendigkeit der Sprache liegt in ihrer Fähigkeit, das aktuelle, imaginierte und mögliche Leben ihrer Sprecher, Leser und Schreiber zu veranschaulichen. Auch wenn sie manchmal gelassen die Erfahrung verschiebt, ist sie nicht deren Ersatz. Sie zielt auf den Ort, wo die Bedeutung liegt.«16 Und Morrison fährt fort: »Ihre Kraft, ihre Glückseligkeit besteht in ihrem Verlangen nach dem Unsagbaren.«17 Die Gewalt der Sprache liegt in ihrem Bemühen, das Unsagbare einzufangen und damit zu zerstören bzw. das zu fassen, was der Sprache gerade entzogen bleiben muß, wenn sie als lebendige Sache wirksam sein soll.
Die Frage der Kinder ist nicht deshalb grausam, weil feststeht, daß sie den Vogel getötet haben, sondern weil der Sprachgebrauch, der der blinden Frau eine Wahl abverlangt, selbst ein sprachlicher Zugriff ist, dessen Kraft sich der evozierten Vernichtung des Vogels verdankt. Die hate speech der Kinder versucht, die blinde Frau im Moment der Erniedrigung zu fangen und die dem Vogel zugefügte Gewalt auf die Frau selbst zu übertragen, wobei diese Übertragung zu der besonderen Zeitlichkeit der Drohung gehört. Denn in gewissem Sinne vollzieht die Drohung bereits, was sie androht. Doch indem sie diese Handlung nicht vollständig ausführt, versucht sie, die Zukunft, in der die Drohung ausgeführt werden wird, mittels der Sprache als Gewißheit festzuschreiben.
Obgleich die sprachliche Drohung nicht unmittelbar die Handlung ist, auf die sie hinweist, ist sie immer noch ein Akt, nämlich ein Sprechakt. Dieser Sprechakt kündigt nicht nur die kommende Handlung an, sondern zeigt eine bestimmte Kraft in der Sprache auf, eine Kraft, die eine nachfolgende Kraft sowohl ankündigt wie bereits einleitet. Während die Drohung normalerweise eine bestimmte Erwartung erzeugt, zerstört die Gewaltandrohung jede Möglichkeit von Erwartungen. Denn sie eröffnet eine Zeitlichkeit, in der man gerade die Zerstörung der Erwartung erwartet und damit zugleich gar nicht erwarten kann.
Auch wenn die Drohung eine Handlung ankündigt, wäre es ein Fehlschluß zu sagen, daß die Drohung lediglich in der Sprache stattfindet, während die angedrohte Handlung in einem materiellen Feld jenseits der Sprache zwischen und unter den Körpern ausgetragen würde. Es liegt in der geläufigen Vorstellung von einer Drohung, daß die sprachliche Äußerung ankündigt, was der Körper tun könnte; die Handlung, auf die sich die Drohung bezieht, ist eine, die man wirklich vollziehen könnte. Diese Sichtweise verkennt jedoch, daß das Sprechen selbst eine körperliche Handlung ist.
In ihrem Buch Le Scandale du corps parlant erinnert Shoshana Felman daran, daß das Verhältnis zwischen Sprechen und Körper skandalös ist, eines, das »sowohl durch Inkongruenz als auch durch Untrennbarkeit gekennzeichnet ist [. . .]. Der Skandal besteht darin, daß der Akt nicht wissen kann, was er tut.«18 Felman behauptet also, daß der Sprechakt als Handlung eines sprechenden Körpers immer in bestimmtem Maße unwissend gegenüber dem ist, was er ausführt, bzw. daß er immer etwas Unbeabsichtigtes sagt und somit keineswegs als jenes Emblem von Herrschaft und Kontrolle gelten kann, als das er gelegentlich erscheint. Felman macht darauf aufmerksam, in welchen Formen der sprechende Körper Zeichen setzt, wobei diese nicht darauf reduzierbar sind, was der Körper »sagt«. In diesem Sinne ist der Sprecher ebenso »blind« wie die erfahrene Schriftstellerin bei Morrison: Die Bedeutungen, die der Körper ausführt, fallen nicht genau mit denen zusammen, die gerade vorgetragen werden oder überhaupt vorgetragen werden können. Während Morrison die Aufmerksamkeit auf das »Instrument« lenkt, »mittels dessen Behauptungen gemacht werden«, setzt Felman dieses Instrument mit dem Körper gleich, der die Rede äußert. Der Körper wird zum Zeichen der Unwissenheit, weil seine Handlungen niemals vollständig bewußt gesteuert oder willentlich bestimmt sind. Nach Felman läßt sich das, was in einer körperlichen Handlung wie dem Sprechen unbewußt bleibt, als »Instrument« auffassen, mittels dessen die Behauptung aufgestellt wird. In ähnlichem Sinne markiert der unwissende Körper die Grenze der Intentionalität des Sprechaktes. Der Sprechakt sagt immer mehr oder sagt es in anderer Weise, als er sagen will.
Dies bedeutet für Felman jedoch nicht, daß Sprechen und Körper radikal getrennt werden können, sondern nur, daß die Vorstellung von einem vollkommen intentionalen Sprechakt fortwährend von jenem Moment im Sprechen unterhöhlt wird, das die Intentionalität unterläuft: »Wenn das Problem der menschlichen Handlung im Verhältnis zwischen Sprache und Körper liegt, begründet sich dies darin, daß – sowohl in der performativen Analyse als auch in der Psychoanalyse – die Handlung als etwas gilt, was im selben Augenblick die Trennung und Gegensätzlichkeit beider problematisiert. Die Handlung, ein rätselhaftes und problematisches Erzeugnis des sprechenden Körpers, zerstört die metaphysische Dichotomie zwischen dem Gebiet des ›Geistigen‹ und dem Gebiet des ›Physischen‹; sie zerschlägt den Gegensatz zwischen Körper und Geist, zwischen Materie und Sprache.«19
Doch zieht dieser Zusammenbruch des Gegensatzes zwischen Materie und Sprache für Felman keine schlichte Einheit der beiden Terme nach sich. Sie bleiben in inkongruenter Weise aufeinander bezogen. Im Sprechen wird die Handlung, die der Körper ausführt, nie vollständig verstanden. Der Körper ist gleichsam der blinde Fleck des Sprechens: das, was über das Gesagte hinaus, jedoch gleichzeitig in ihm und durch es agiert. Die These, daß der Sprechakt eine körperliche Handlung ist, bedeutet, daß er sich im Augenblick des Sprechens verdoppelt: Neben dem, was gesagt wird, gibt es eine Weise des Sagens, die das körperliche »Instrument« der Äußerung ausführt.
So ist eine Äußerung denkbar, die auf der Basis einer rein grammatikalischen Analyse nicht als Drohung erscheint. Die Drohung tritt erst genau durch die Handlung in Erscheinung, die der Körper ausführt, indem er den Sprechakt spricht. Oder die Drohung tritt als sichtbarer Effekt eines performativen Aktes in Erscheinung, nur um durch dessen Körpersprache unschädlich gemacht zu werden (wie jede Theorie des Handelns weiß). Die Drohung kündigt nicht nur eine körperliche Handlung an oder verspricht sie, sondern ist selbst bereits ein körperlicher Akt, der in seiner Gestik die Umrisse der kommenden Handlung entwirft. Auch wenn sich selbstverständlich die Handlung der Drohung und die angedrohte Handlung unterscheiden, sind sie in der Form eines Chiasmus miteinander verknüpft. Obgleich nicht identisch, sind beide körperliche Handlungen: Die erste, d. h. die Drohung, macht nur Sinn in Hinblick auf die Handlung, die sie ankündigt. Die Drohung eröffnet einen zeitlichen Horizont, innerhalb dessen die angedrohte Handlung das organisierende Ziel bildet. Sie eröffnet die Handlung, durch die möglicherweise die Erfüllung des angedrohten Aktes erreicht wird. Allerdings kann eine Drohung abgelenkt oder entschärft werden oder die Ausführung der angedrohten Handlung verfehlen. Obgleich die Drohung die drohende Gewißheit einer anderen bevorstehenden Handlung behauptet, kann sie diese nicht wie einen notwendigen Effekt produzieren. Dieses Scheitern, die Drohung auszuführen, stellt jedoch nicht den Status des Sprechakts als Drohung in Frage, sondern nur dessen Wirksamkeit. Die Selbsttäuschung, die der Drohung ihre Macht verleiht, besteht darin, daß der Sprechakt der Drohung die angedrohte Handlung vollständig verkörpern soll. Dagegen ist dieses Sprechen verwundbar, anfällig für ein Mißlingen – und genau diese Verletzlichkeit muß man ausnutzen, um der Drohung entgegenzutreten.
Damit die Drohung funktioniert, bedarf es einer Reihe von bestimmten Umständen. Dazu gehört ein Schauplatz der Macht, damit sich die performativen Effekte verwirklichen können. Die Teleologie der durch die Drohung beschworenen Handlung ist anfällig für Störungen verschiedenster Art. Nichtsdestoweniger wird die Drohung durch das Phantasma einer souveränen Handlung strukturiert, nach dem eine bestimmte Art des Sagens zugleich die Ausführung der Handlung ist, auf die sich die Aussage bezieht. Dies entspräche der illokutionären Äußerung Austins, die unmittelbar tut, was sie sagt. Allerdings kann die Drohung auch eine völlig unvorhergesehene Antwort hervorrufen und damit unbeabsichtigt einen Widerstand miterzeugen, angesichts dessen sie das souveräne Gefühl der Erwartung verliert. Statt jede Möglichkeit der Erwiderung auszulöschen und den Adressaten vor Angst erstarren zu lassen, kann sich die Drohung einem andersartigen performativen Akt gegenübersehen, der ihre eigene Ambivalenz (d. h. den Gegensatz zwischen dem intentionalen und dem nichtintentionalen Aspekt jedes Sprechens) ausnutzt, um den einen Teil gegen den anderen zu wenden und damit die performative Macht der Drohung zu verwirren.
Da die Drohung als Sprechakt zugleich ein körperlicher Akt ist, entzieht sie sich bereits zum Teil ihrer eigenen Kontrolle. Genau darauf weist Morrison hin: Die blinde Frau sendet die von den Kindern ausgesprochene, implizite Drohung zurück, indem sie auf die »Hände« derjenigen, die den Vogel halten, verweist, d. h. indem sie den Körper des Sprechenden beleuchtet oder der Drohung mit einem Akt entgegentritt, der gerade das beleuchtet, was den Übermittlern der Drohung am unbekanntesten ist. Die blinde Frau beleuchtet damit die Blindheit, die den Sprechakt der Kinder motiviert. Oder anders formuliert: Sie wirft die Frage auf, was die Kinder im körperlichen Sinne tun werden, angesichts dessen, was sie bereits körperlich getan haben, indem sie sprachen, wie sie gesprochen haben.
Die Vorstellung, daß Sprechen verwundet, scheint also auf der ebenso unlösbaren wie inkongruenten Beziehung zwischen Körper und Sprechen und damit auch zwischen dem Sprechen und seinen Effekten zu beruhen. Wenn der Sprecher seinen oder ihren Körper an den Adressaten richtet, dann bringt er nicht nur den eigenen Körper, sondern ebenso den des Adressaten ins Spiel. Der Sprecher spricht nicht nur, sondern wendet den eigenen Körper an den anderen und enthüllt damit, daß der Körper des anderen durch die Anrede verletzbar ist. Als »Instrument« einer gewaltsamen Rhetorik übersteigt der Körper des Sprechers die ausgesprochenen Worte und enthüllt den angesprochenen Körper, insofern dieser nicht mehr unter der eigenen Kontrolle steht (und niemals gänzlich stand).
Unerwartete Anrufe
Um die Frage zu entscheiden, was eine Drohung ist oder was ein verwundendes Wort, reicht es nicht, die Wörter einfach zu prüfen. Deshalb scheint eine Untersuchung der institutionellen Bedingungen erforderlich, um zu bestimmen, mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Wörter unter bestimmten Umständen verwunden werden. Doch auch die Umstände allein bewirken nicht, daß Worte verwunden. So drängt sich die These auf, daß jedes Wort verwunden kann, je nachdem wie es eingesetzt wird, und daß die Art und Weise dieses Einsatzes von Wörtern nicht auf die Umstände ihrer Äußerung zu reduzieren ist. Letzteres erscheint sinnvoll, doch vermag eine solche Sichtweise nicht zu erklären, warum bestimmte Wörter so verwunden, wie sie es augenscheinlich tun, oder warum bestimmte Wörter schwerer als andere von ihrer Macht, zu verwundern, abzulösen sind.
Tatsächlich scheitern neuere Versuche, die unbestreitbar verwundende Macht bestimmter Wörter zu begründen, offenbar an der Frage, wer diese Interpretation vornimmt, was diese Worte bedeuten und welche Sprechakte sie vollziehen. Neuere Bestimmungen zur Regelung der lesbischen und schwulen Selbstdefinition in der Armee oder neuere Kontroversen um die Rap-Musik weisen darauf hin, daß kein eindeutiger Konsens über die Frage möglich ist, ob es eine klare Verbindung zwischen den geäußerten Worten und ihrer mutmaßlichen verletzenden Macht gibt.20 Die These einerseits, daß der anstößige Effekt der Wörter vollständig vom Kontext abhängt und daß dessen Verschiebung diesen Effekt vergrößern oder verringern könnte, enthält noch keine Aussage über die Macht, die solche Worte angeblich ausüben. Die Behauptung andererseits, daß diese Äußerungen immer, d. h. unabhängig vom Kontext, anstößig sind und gleichsam so mit ihrem Kontext verwoben, daß sie ihn kaum abschütteln können, bietet immer noch keine Möglichkeit zu verstehen, wie der Kontext im Augenblick der Äußerung aufgerufen und neu inszeniert wird.
Keine dieser Thesen trägt der Reinszenierung und Resignifizierung der anstößigen Äußerung Rechnung, d. h. jenen Einsatzformen der Sprachmacht, die versuchen, den beleidigenden Sprachgebrauch sowohl vorzuführen als auch ihm entgegenzutreten. Diesen Aspekt werde ich ausführlicher in den folgenden Kapiteln untersuchen, möchte jedoch kurz zu bedenken geben, wie oft solche Ausdrücke einer Resignifizierung ausgesetzt sind. Die Verdoppelung des verletzenden Sprechens findet nicht nur in der Rap-Musik und in den verschiedenen Spielarten der politischen Parodie und Satire statt, sondern auch in der politischen und gesellschaftlichen Kritik an diesem Sprechen, in der das »Anführen«21 der verletzenden Ausdrücke für die jeweils vorgetragene Beweisführung von zentraler Bedeutung ist. Dies gilt selbst für die juristische Argumentation, die nach der Zensur ruft und zugleich unweigerlich die beanstandete Rhetorik im Kontext des rechtlichen Sprechens vervielfältigt. Paradoxerweise bemerken namentlich juristische und politische Argumentationen, die das verletzende Sprechen in bestimmte Kontexte einbinden möchten, daß dieses Sprechen selbst im eigenen Diskurs zum Zitat wird und mit seinen früheren Kontexten bricht bzw. neue Kontexte erhält, für die es ursprünglich nicht bestimmt war. Der kritische und der juristische Diskurs über hate speech ist also selbst eine Reinszenierung der Performanz der hate speech. Der gegenwärtige Diskurs bricht zwar mit den vorhergehenden Diskursen, jedoch nicht im absoluten Sinne. Im Gegenteil, der gegenwärtige Kontext und sein scheinbarer »Bruch« mit der Vergangenheit sind selbst nur unter dem Vorzeichen dieser Vergangenheit lesbar. Der gegenwärtige Kontext arbeitet zwar einen neuen Kontext für dieses Sprechen aus, der aber als zukünftiger noch nicht beschreibbar und damit noch gar kein Kontext im eigentlichen Sinne ist.
Die Argumente, die für eine Gegen-Aneignung oder Reinszenierung des beleidigenden Sprechens gelten können, werden also offenbar von jener Position unterhöhlt, die besagt, daß der beleidigende Effekt des Sprechakts notwendigerweise mit dem Sprechakt, d. h. seinem ursprünglichen oder fortbestehenden Kontext oder seinen ursprünglichen Absichten oder Einsatzformen, verbunden ist. Die Neubewertung eines Ausdrucks wie z. B. »queer« deutet allerdings darauf hin, daß man das Sprechen in anderer Form an seinen Sprecher »zurücksenden« und gegen seine ursprünglichen Zielsetzungen zitieren und so eine Umkehrung der Effekte herbeiführen kann. Allgemeiner bedeutet dies, daß die veränderliche Macht solcher Ausdrücke eine Art diskursiver Performativität markiert, die nicht aus diskreten Reihen von Sprechakten, sondern aus einer rituellen Kette von Resignifizierungen besteht, deren Ursprung und Ende nicht feststehen und nicht feststellbar sind. In diesem Sinne stellt eine »Handlung« kein singuläres Geschehen dar. Vielmehr ist sie ein Netz von zeitlichen Horizonten bzw. die Kondensierung einer Iterabilität, die den Augenblick ihres Geschehens übersteigt. Die Möglichkeit, daß ein Sprechakt einen früheren Kontext resignifiziert, hängt ihrerseits von dem Spalt ab, der sich zwischen dem ursprünglichen Kontext bzw. der ursprünglichen Intention einer Äußerung einerseits und den Effekten andererseits auftut, die die Äußerung hervorruft. Damit beispielsweise eine Drohung eine Zukunft hat, die nie beabsichtigt war, damit sie in anderer Form zu ihrem Sprecher zurückkehren und durch diese Rück- und Umkehr entschärft werden kann, müssen die Bedeutungen, die der Sprechakt erlangt, und die Effekte, die er ausübt, seine beabsichtigten Bedeutungen und Effekte übersteigen. Außerdem darf der Kontext, den er erhält, sich nicht genau mit dem Kontext decken, dem er ursprünglich entstammt (wenn sich ein solcher Ursprung überhaupt bestimmen läßt).
Es werden wohl alle Theoretiker, die versuchen, mit letzter Gewißheit eine Verbindung zwischen Sprechakten und verletzenden Effekten festzustellen, die zeitliche Offenheit des Sprechakts beklagen. Daß kein Sprechakt die Verletzung als Effekt vollziehen muß, beinhaltet auch, daß keine Erforschung des Sprechakts einen Maßstab liefern kann, anhand dessen sich die Verletzungen durch das Sprechen letztendlich beurteilen lassen. Diese Auflösung des Bandes zwischen Akt und Verletzung eröffnet indes die Möglichkeit eines Gegen-Sprechens, eine Art von Zurück-Sprechen, das durch die Feststellung einer solchen festen Verbindung ausgeschlossen wäre. Somit hat die Kluft, die den Sprechakt von seinen künftigen Effekten trennt, auch günstige Auswirkungen: Sie eröffnet nämlich eine Theorie der sprachlichen Handlungsmacht, die eine Alternative zu der endlosen Suche nach rechtlichen Gegenmitteln darstellt. Das Intervall zwischen den einzelnen Fällen der Äußerung ermöglicht nicht nur eine Wiederholung und Resignifizierung der Äußerung. Vielmehr zeigt es darüber hinaus, wie die Wörter mit der Zeit von ihrer Macht zu verletzen abgelöst und als affirmativ rekontextualisiert werden. Es ist hoffentlich deutlich geworden, daß »affirmativ« hier die »Eröffnung der Möglichkeit einer Handlungsmacht« meint und nicht bedeutet, eine souveräne Autonomie im Sprechen wiederherzustellen oder die konventionellen Modelle der Beherrschung zu kopieren.
Das Hauptanliegen dieses Buches ist sowohl rhetorischer als auch politischer Art. Juristisch versteht man unter excitable speech (»erregtes Sprechen«) solche Äußerungen, die unter Zwang erfolgen, d. h. normalerweise Geständnisse, die vor Gericht nicht verwendet werden können, weil sie nicht den ausgeglichenen Geisteszustand ihres Sprechers widerspiegeln. Meine These ist nun, daß das Sprechen sich stets in gewissem Sinne unserer Kontrolle entzieht. In einer Formulierung, die Felmans Lesart des Sprechakts vorwegnimmt, schreibt Austin, »daß Handlungen im allgemeinen (nicht immer), zum Beispiel unter Zwang oder versehentlich oder auf Grund eines Fehlers oder in anderer Weise ohne Absicht getan werden können«. Anschließend ergreift Austin die Gelegenheit, den Sprechakt in bestimmten Fällen vom Subjekt abzukoppeln: »In vielen derartigen Fällen werden wir auf keinen Fall sagen, daß der Mensch das und das ›getan‹ habe.«22 Diese Ablösung des Sprechakts vom souveränen Subjekt begründet einen anderen Begriff der Handlungsmacht und letztlich der Verantwortung, der stärker in Rechnung stellt, daß die Sprache das Subjekt konstituiert und daß sich das, was das Subjekt erschafft, zugleich von etwas anderem herleitet. Während einige Theoretiker die Kritik der Souveränität als Zerstörung der Handlungsmacht mißverstehen, setzt meiner Ansicht nach die Handlungsmacht gerade dort ein, wo die Souveränität schwindet. Wer handelt (d. h. gerade nicht das souveräne Subjekt), handelt genau in dem Maße, wie er oder sie als Handelnde und damit innerhalb eines sprachlichen Feldes konstituiert sind, das von Anbeginn an durch Beschränkungen, die zugleich Möglichkeiten eröffnen, eingegrenzt wird.
Das Trugbild der Souveränität taucht im Diskurs der hate speech in vielfältiger Gestalt auf. Wer hate speech spricht, wird im Besitz einer souveränen Macht vorgestellt, zu tun, was er gesagt hat. Ähnlich nimmt das »Sprechen« des Staates eine souveräne Form an; beispielsweise ist das Aussprechen einer Erklärung oft wörtlich ein »Gesetzes-Akt«. Allerdings sah sich Austin bei dem Versuch, solche illokutionären Fälle des Sprechens zu verorten, bestimmten Schwierigkeiten gegenüber, so daß er eine Liste von Vorbehalten und neuen Unterscheidungsmerkmalen aufstellte, um der Vielschichtigkeit des performativen Feldes Rechnung zu tragen. Denn nicht alle Äußerungen, die die Gestalt des Performativen (sei es illokutionärer oder perlokutionärer Art) haben, funktionieren auch tatsächlich. Diese Einsicht hat gewaltige Konsequenzen für die Einschätzung der vermeintlichen Wirksamkeit von hate speech.
Rhetorisch betrachtet setzt die Behauptung, daß ein Sprechen nicht nur ein Haßgefühl vermittelt, sondern einen verletzenden Akt darstellt, nicht nur voraus, daß die Sprache handelt, sondern zudem, daß sie sich in verletzender Weise gegen einen Adressaten richtet. Hierbei handelt es sich freilich um zwei höchst unterschiedliche Behauptungen; denn nicht alle Sprechakte wirken sich mit solcher Kraft auf einen anderen aus. Wenn ich beispielsweise sage: »ich verurteile dich«, kann ich zwar einen Sprechakt äußern, der in Austins Sinn durchaus illokutionär ist. Doch wenn ich nicht die Position innehabe, daß meine Worte als bindend gelten können, habe ich nur einen Sprechakt geäußert, der in Austins Sinn »unglücklich« oder »verunglückt« ist, d. h. der Adressat entkommt ihm unversehrt. Viele solcher Sprechakte sind also im engen Sinne ein »Verhalten«, ohne daß alle die Macht hätten, Effekte hervorzurufen oder eine Kette von Folgen auszulösen. Tatsächlich erscheinen viele Sprechakte unter dieser Perspektive betrachtet eher komisch, und man könnte Austins How to do Things with Words (dt. Theorie der Sprechakte) auch als amüsanten Katalog von solch verfehlten performativen Äußerungen lesen.
Ein Sprechakt kann also eine Handlung sein, ohne unbedingt effektiv zu sein. Wenn ich eine verfehlte performative Äußerung ausspreche, also einen Befehl erlasse, und niemand hört zu oder gehorcht, oder wenn ich ein Versprechen gebe, und es existiert niemand, dem oder vor dem dieses Versprechen gegeben wird, führe ich dennoch eine Handlung aus, allerdings nur mit einem geringen oder gar keinem Effekt (oder zumindest nicht mit dem Effekt, den dieser Sprechakt vorstellt). Eine geglückte performative Äußerung ist dadurch definiert, daß ich die Handlung nicht nur ausführe, sondern damit eine bestimmte Kette von Effekten auslöse. Sprachlich zu handeln bedeutet nicht zwangsläufig, auch Effekte hervorzurufen, und in diesem Sinne ist ein Sprechakt nicht immer ein effektiver Akt. Oder anders formuliert: Die Gleichsetzung von Sprechen und Handeln beinhaltet nicht unbedingt, daß Sprechen auch effektiv handelt.
Austin bietet eine vorläufige Typologie der verschiedenen Arten von Lokutionen performativer Art an. Der illokutionäre Akt ist dadurch bestimmt, daß jemand, indem er etwas sagt, gleichzeitig etwas tut. Der Richter, der sagt: »ich verurteile Sie«, äußert nicht eine Absicht, etwas zu tun, und beschreibt auch nicht, was er tut; seine Aussage ist vielmehr selbst ein Tun. Illokutionäre Sprechakte rufen also Effekte hervor und werden nach Austin durch sprachliche und gesellschaftliche Konventionen gestützt. Perlokutionäre Akte hingegen sind solche Äußerungen, die eine Kette von Folgen auslösen: Für einen perlokutionären Sprechakt gilt: »Wenn etwas gesagt wird, dann wird das [. . .] gewisse Wirkungen [. . .] hervorrufen«,23 ohne daß das Sagen und die hervorgerufenen Wirkungen zeitlich zusammenfallen. Die Folgen sind nicht dasselbe wie der Sprechakt, sondern eher die Ergebnisse oder das »Nachspiel« der Äußerung. Während illokutionäre Akte sich mittels Konventionen vollziehen, vollziehen sich perlokutionäre Akte mittels Konsequenzen.24 Diese Unterscheidung beinhaltet also, daß illokutionäre Sprechakte ohne zeitlichen Aufschub Effekte hervorrufen, daß hier das »Sagen« dasselbe ist wie das »Tun« und daß beide gleichzeitig erfolgen.
Austin stellt ferner fest, daß einige Folgen einer Perlokution unbeabsichtigt sein können. Als Beispiel führt er die unbeabsichtigte Beleidigung an, womit er die verbale Verletzung in den Horizont der Perlokution einordnet. Austin legt also nahe, daß die Verletzung nicht in den Konventionen wurzelt, die ein gegebener Sprechakt aufruft, sondern in den spezifischen Folgen, die er hervorruft.
In neuerer Zeit wurde Austins Werk von Juristen und Philosophen (u. a. Catharine MacKinnon und Rae Langton25) zitiert, um den performativen Charakter pornogra