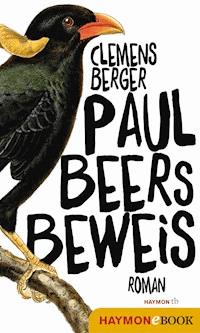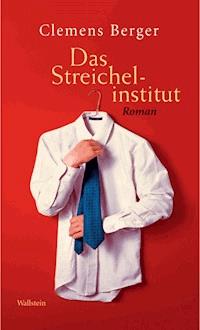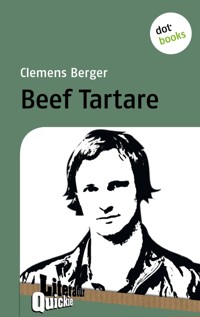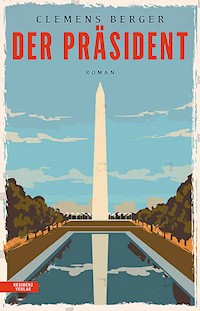Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Babys brauchen Milch – Muttermilch oder Pulvermilch. Hier setzt Clarissa mit dem "Haus des flüssigen Goldes" an: Frauen wie Maya, die als alleinerziehende Mutter bislang von Gelegenheitsjobs gelebt hat, pumpen in sicherer Umgebung ihre überschüssige Milch ab und werden am Verkauf gewinnbeteiligt. Das geht gut, bis der größte Milchpulverfabrikant nicht mehr liefern kann und zugekaufte Muttermilch überlebenswichtig wird. Als Maya sich auf die Seite der verzweifelten Frauen mit ihren hungrigen Babys stellt, wird sie zur Social-Media-Ikone: Sie wird gefeiert und mit Shitstorms überzogen, sie erhält Millionenangebote und Morddrohungen. Clemens Bergers neuer Roman ist mehr als ein irrwitziges Bild unserer Gesellschaft: Auf anrührende Weise erzählt er von Solidarität, Überlebenskampf und Mutterliebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clemens Berger
Hausdes flüssigenGoldes
Roman
© 2024 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: boutiquebrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Ekke Wolf, typic.at
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4725 2
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1791 0
Throw the stone meant for your head.Make it a present.
Insomniac
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
1
Ich musste lachen, wenn ich daran dachte, wie viel wertvolle Milch ich in meinem kurzen Leben als Mutter in die Toilette gekippt hatte. Ich hatte keine Ahnung gehabt, was ich mit dem stetig anwachsenden Vorrat für die ohnehin immer gestillte Mia anfangen sollte. Nach ein paar Tagen war die Milch im Kühlschrank nicht mehr genießbar, das Eisfach zum Bersten voll, ich schüttete die Milch weg und warf Gefrierbeutel in den Müll, mein Busen war wieder voll und meine Tochter so satt, dass das Surren des Kühlschranks wie höhnisches Gelächter klang. Ich hatte nicht gewusst, dass ich damit Geld verdienen konnte. Als ich es wusste, hatte ich einen Kunden. Ich blickte in den Rückspiegel und bog in den Parkplatz vor dem Haus des flüssigen Goldes ein.
2
In der Nähe des Eingangs stand ein gutes Dutzend Menschen, die nicht wie Kunden aussahen; ihretwegen hatte uns Clarissa in der Früh angewiesen, die Hintertür zu nehmen. Ich wollte nicht die Hintertür nehmen. Ich parkte meinen Wagen, holte Mia aus dem Kindersitz und die Kühlbox aus dem Kofferraum. Ich hatte zu Hause vorgearbeitet.
Mit Mia auf dem linken Arm und der Kühlbox in der rechten Hand machte ich mich zum Eingang auf, vor dem unsere Sicherheitsmänner mit verschränkten Armen standen. Der Himmel war blau, ein paar Wolken zogen schnell darüber, die Sonne schien, einer unserer Männer eilte auf mich zu und bedeutete mir, stehenzubleiben. Ich blieb nicht stehen. Die Menschen, die keine Kunden waren, hatten sich um ein Transparent versammelt, auf dem Haus der Gier stand, ein paar von ihnen hielten Zettel in den Händen, um sie Kunden anzudrehen, die so schnell wie möglich an ihnen vorbeizuhuschen versuchten.
»Maya, ich bring euch hinten rein«, sagte der Sicherheitsmann. »Wenn’s nach uns ginge, würden wir mit denen nicht so zimperlich verfahren.«
»Ich gehe beim Eingang rein.«
Ich ging unbeirrt weiter, der Mann folgte mir, unschlüssig, ob er vor, neben oder hinter mir gehen sollte. »Wir brauchen keinen Schutz«, sagte ich Mia, die mit ihren Fingerchen in meinem Gesicht herumtappte, »wir haben auch bisher alles ohne geschafft.«
Die Aufgeregten, etwa zur Hälfte Männer und zur Hälfte Frauen, waren zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt. Sie sahen nicht nur aufgeregt, sie sahen auch überaus ernst und empört aus. Die einen waren bunt und eher abgerissen gekleidet, die anderen ganz in Schwarz, schwarze Hosen, schwarze Kapuzenpullover, schwarze Sonnenbrillen. In losen Grüppchen standen sie etwa zehn Meter vom Eingang entfernt, ich nickte ihnen lächelnd zu, als ich auf die gläserne Schiebetür und die beiden anderen Sicherheitsmänner zuschritt. Ich wusste nicht, ob es an mir lag oder an dem Mann, der mir nun folgte, dass auf einmal ein Raunen anhob, in das sich grelle Pfiffe mischten. Jemand blies in eine Trillerpfeife, Mia zuckte zusammen, ein lautes Buh folgte, das in einen Buh-Chor mündete.
»Schäm dich!«
»Pfui!«
»Haus der Gier! Haus der Gier!«
Wenige Schritte vor dem Eingang lächelte ich den Sicherheitsmännern zu. Ich fühlte mich an die Zeit erinnert, in der ich Basketball gespielt hatte; so ähnlich hatte es geklungen, wenn wir auswärts angetreten waren.
»Deine Mutter ist eine Schande für alle Mütter!«
Ich blieb stehen und drehte mich um. Der Mann, der mir gefolgt war, blieb ebenfalls stehen. Mit einem Kopfnicken forderte er mich auf, endlich ins Haus zu gehen. Ich blickte in die überschaubare, wütende Menge. Pfiffe gellten mir entgegen, Mia blickte mich mit großen Augen an; es war noch nicht ausgemacht, ob sie amüsiert oder verängstigt war.
»Wer hat das geschrien?«
Ich sagte es leise und bestimmt, blickte von einem zur anderen. Die meisten funkelten mich an, einige mieden meinen Blick. Eine Frau hatte ein Baby umgehängt, ein Mann die Faust geballt. Eine Zeitlang war es still, ehe eine Frau buhte, woraufhin der Krawall wieder anschwoll. Zwei junge Männer hielten das Transparent, stießen die Stöcke, an denen es befestigt war, rhythmisch von oben nach unten, der Schriftzug Haus der Gier wellte und spannte sich, die Aufgeregten skandierten: »Haus der Gier!, Schande über euch!«
Ich ging in die Knie, stellte die Kühlbox ab, richtete mich auf, zeigte den Aufgeregten meinen Mittelfinger, ging wieder in die Knie, hob die Box hoch, drehte mich um und schritt ins Haus des flüssigen Goldes. Die Sicherheitsmänner am Eingang nickten mir zu.
3
Auf dem großen Flachbildschirm über der Kassa im Verkaufsraum entdeckte ich meinen Namen an erster Stelle. Was ich einmal für einen Fluch der Natur gehalten hatte, hatte sich in eine sprudelnde Einnahmequelle verwandelt. Seit drei Tagen war meine Milch die teuerste.
Ich wusste nicht, wie lange ich das noch durchhalten konnte; aber jeden Monat, den ich dabeiblieb, konnte ich eine schöne Summe beiseitelegen, zumal ich gar nicht dazu kam, viel Geld auszugeben. Ich aß hier besser als zu Hause, auch besser als in den Lokalen, in denen ich vor Mias Geburt gegessen hatte, Mias Betreuung war kostenlos, ihre Kleidung kam von meinen Freundinnen, deren Kinder aus den kleinen Größen herausgewachsen waren, ich hatte sogar meine sterilisierte Pumpe verkauft, weil wir Pumpen von der Firma bekamen, die das Haus ausrüstete.
Ich hätte gerne gewusst, warum ausgerechnet ich eine Schande für alle Mütter sein sollte. Ich sah keine Schande darin, für meine Tochter zu arbeiten. Natürlich hätte ich meine überschüssige Milch einer Milchbank spenden können; aber wer hätte dann unsere Miete, unser Essen und alles andere bezahlt? Da draußen hatte ich mehr als Wut und Verachtung gespürt. Da war auch Hass gewesen, echter, giftiger Hass. Der Ruf hatte in erster Linie Mia gegolten. Sie sollte spüren, dass ihre Mutter abzulehnen war, ein schlechter Mensch. Das war anders als die Pfiffe und Schmähungen beim Basketball, die etwas Eingeübtes hatten.
Ich übergab Mia den beiden Pädagoginnen. Es war eine Wohltat, wie Mia sich freute, von ihnen in Empfang genommen zu werden, wie sie aus meinen Armen in die Arme einer anderen Frau überging und dabei strahlte. Anfangs hatte Mia geheult und geschrien, sich an mir festgekrallt; ich hatte mich jedes Mal elend gefühlt, wenn ich sie von mir hatte reißen und für eine Viertelstunde vor der Tür hatte warten müssen, während ich meine Tochter verzweifelt brüllen hörte. Jetzt drehte sich Mia nicht einmal mehr nach mir um, wenn sie zu den anderen kam. Allein dafür, dachte ich, würde ich Clarissa ewig dankbar sein.
Als ich in meinem Zimmer die Milchpäckchen aus der Kühlbox in den Kühlschrank schlichtete, vibrierte mein Mobiltelefon. Genau meine Geste, Kuss, C.
Jemand hatte ein Foto gemacht, das bereits hunderte Male geteilt worden war. Da stand ich, Maya, im schwarzen Trainingsanzug, mit knallgelben Turnschuhen, eine Sonnenbrille im Gesicht, mit meiner Tochter, deren Gesicht man zum Glück nicht sehen konnte, auf dem Arm, vor dem Eingang zum Haus des flüssigen Goldes, hinter mir zwei grimmige Sicherheitsmänner, neben meinem rechten Turnschuh eine große Kühlbox – und streckte formvollendet meinen Mittelfinger in die Luft. Ich sah weder verärgert noch wütend aus. Ich hatte ein leises Lächeln um die Mundwinkel.
Das hat diese Frau euren hungrigen Babys zu sagen.
So verhöhnt sie eure Kinder.
Ein Stinkefinger für eure Not.
Keine Milch für Arme.
Verhungert, ihr Verlierer!
Sätze wie diese begleiteten das Bild oder standen in fetten Lettern darauf geschrieben. Um die Zeit nicht unnütz verstreichen zu lassen, hatte ich eine Pumpe angesetzt, während ich die Fotos betrachtete und die Kommentare las, in denen mir, meinem Kind und dem Haus des flüssigen Goldes alles Schlechte dieser Welt gewünscht wurde. Ich verstand, warum mich Clarissa in einer weiteren Nachricht eindrücklich davor gewarnt hatte, die Kommentare zu lesen. Ich überflog die Kommentare, las die Beleidigungen, sah auch die Bilder, auf denen der Preis meines Trainingsanzugs, der Preis meiner Schuhe, der Preis meiner Sonnenbrille verzeichnet waren. Meine Milch solle versauern, meine Brüste sollten verschrumpeln, meine Tochter solle an der Gier des Hauses ersticken – das waren noch die gemäßigteren Wünsche für eine Person, die ich nicht mit mir in Verbindung bringen konnte.
Das wahrhafte Ausmaß des Irrsinns entdeckte ich erst auf meinem eigenen Profil. Ein bösartiger Sturm war über es hinweggezogen und hatte kein einziges Bild, das ich im letzten halben Jahr veröffentlicht hatte, unberührt gelassen. Ich las auch die wohlwollenden Kommentare, die Sätze und Worte, die zu meiner Verteidigung geschrieben wurden, als meinten sie eine andere. Mein digitaler Briefkasten schien zu platzen. Ich öffnete ihn nicht.
Ich hatte auch nicht die Zeit, um all die haarsträubenden Kommentare zu löschen, abgesehen davon, dass auf eine gelöschte Beleidigung zwei neue kamen. Ich legte mein Mobiltelefon beiseite und schloss die Augen. Das Fläschchen war beinahe voll, ich hörte es am Plätschern der Milch, schraubte es von der Pumpe, leerte die Milch in ein Päckchen und brachte es zum Kühlschrank.
»Die Hintertür hätte gewisse Vorteile gehabt.«
Clarissa lehnte lachend an der offenen Tür, ihr Haar war noch nicht trocken. Sie musste mich beobachtet haben. Ich wollte mich für meine locker sitzenden Gliedmaßen entschuldigen, sie schnitt mir das Wort ab und fragte, wofür ich mich entschuldigen wollte, ich hätte denen doch überaus elegant den Finger gezeigt. Ich wollte erklären, warum ich das getan hatte, sie unterbrach mich. Ich müsse mich nicht erklären, heute aber mit Mia im Haus oder in einem Hotel übernachten. Man könne nicht wissen, wozu diese Leute fähig seien. Im Grunde seien sie Feiglinge. Aber die Meute da draußen wachse.
Ich fragte Clarissa, was sie zu tun gedenke. Nichts, entgegnete sie. Mit jedem Aufruf zur Empörung wüssten mehr Menschen, wo sie die beste Milch bekämen. Sie rufe auch nicht die Polizei. Sie zwinkerte mir zu. Sie unterdrücke doch nicht die freie Meinungsäußerung.
»Du hast mir beim Training gefehlt.«
»Ich habe auch gepumpt«, sagte ich.
Clarissa lachte. Sie forderte mich auf, nachher oben bei Anna vorbeizuschauen, die sich um die Hasskommentare auf meinem Profil kümmern würde. Ich dankte Clarissa und nannte sie wie immer, wenn wir einander nahe waren, Boss.
»Ich habe zu danken«, sagte sie. »Die Nachfrage nach deiner Milch explodiert.«
4
Am frühen Nachmittag empfing mich Anna oben in ihrem Büro, in das man über eine breite Treppe gelangte. Die Tür zu Clarissas Büro nebenan war wie immer angelehnt. Sie saß auf ihrem roten Yogakissen und atmete tief ein und aus. Clarissa fing Vögel. Eine halbe Stunde, jeden Tag, aufrecht auf dem roten Kissen, die Augen geschlossen, die Konzentration auf den Atem und die Nasenlöcher gelenkt, die Gedanken ziehen lassen, sie leidenschaftslos beobachten und weitertreiben lassen – biochemische Abläufe, auf die man sich gern so viel einbildete. Ein Stirnband maß dabei die Aktivität ihrer Gehirnströme. Wenn sie auf dem roten Kissen saß und ihr Gehirn ruhte, hörte man Vögel auf ihrem Mobiltelefon. Ich lauschte kurz. Ihr Büro war ein zwitscherndes Vogelnest.
Auf dem Bildschirm sah Clarissa ihre Kunden am liebsten. Hier waren sie in Zahlen und Statistiken verwandelt. Hier kauften sie pro Tag soundso viele Liter Renata und soundso viele Liter Mariella, wobei sie für das Geld, das sie für Renata ausgaben, um einiges mehr von Mariella bekommen hätten. Hier formten sie eine Linie, die im Zickzack verlief, sank oder anstieg, hier sprachen sie ein eindeutiges Urteil über das Haus des flüssigen Goldes.
Seit seiner Eröffnung stieg die Linie kontinuierlich an, unterbrochen nur von gelegentlichen flachen Phasen und minimalsten Verirrungen nach unten. In der letzten Woche waren die Verkäufe um sagenhafte sechzig Prozent gestiegen, Clarissa hatte zehn neue Frauen angestellt, ich war noch dabei, mir ihre Namen zu merken, trotzdem fand sie sich zum ersten Mal in einer Situation, in der es schwierig zu werden drohte, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Das sei die Krise, hatte sie mir auf der Hantelbank gesagt und sich den Schweiß von der Stirn gewischt, ein Geschenk des Himmels, also des Zufalls. Es gebe aber keine Zufälle. Als sie das Haus in ihrem Kopf erschaffen habe, müsse sie geahnt haben, was komme. Sie habe sich so tief in die Materie versenkt, dass deren verborgenste Zusammenhänge ihr die Gewissheit eingegeben hätten, ihre Idee würde Früchte tragen. Die Krise, hatte sie gesagt, stecke tatsächlich in den Kinderschuhen. Die Lage sei ausgezeichnet.
Anna hatte ich noch nie so aufgeregt, beinahe leidenschaftlich gesehen. Sie schien die Beleidigungen, die mir galten, persönlich zu nehmen. Ich meldete mich an ihrem Laptop auf meinem Profil an, sie versprach mir, die widerlichen Kommentare zu löschen und ihre Urheber zu blockieren. Sie verzog das Gesicht, deutete angewidert auf den Bildschirm und machte sich unverzüglich an die Arbeit. »Bestien«, murmelte sie, »elende Arschgesichter.«
Auf dem Weg nach unten, ich war auf der Hälfte der Treppe angelangt, hörte ich sie meinen Namen rufen. Ich drehte mich um. Anna lehnte an der gläsernen Brüstung und rief mir zu, sie habe vergessen, mir zu sagen, dass ich das letzte Schulungsvideo noch nicht angeklickt hätte.
5
In diesem Video wirkte Renata abgeschlagen, auch wenn sie sich um ein Lächeln bemühte. Clarissa wies auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, Renata nahm Platz. Sie trug ihren grünen Jogginganzug und weiße Turnschuhe, das gelockte schwarze Haar hatte sie zu einem dicken Knäuel auf dem Kopf zusammengebunden, um den Hals hingen ihre großen gepolsterten Kopfhörer, die sie wahrscheinlich nicht einmal beim Schlafen abnahm. Sie lehnte sich zurück, überschlug die Beine und blickte Clarissa besorgt an.
»Du warst in den letzten drei Monaten Goldene des Monats. Das ist historisch, Renata.«
»Ich hab alles rausgeholt.«
Renata schien darauf zu warten, dass Clarissa lachte. Clarissa lachte nicht. Sie blickte sie freundlich und nachdenklich an.
»Daher haben wir dich vor allen ausgezeichnet. Du weißt, was du vorher verdient hast?«
Renata nickte.
»Und jetzt verdienst du was im Monat? Das Zehnfache?«
»Etwas mehr.«
»Und musst nichts für Essen ausgeben, nichts für Babybetreuung, nichts für Yoga oder Fitnessstudio.«
»Bis auf die Kommission.«
»Aber ohne dieses Haus und ohne diese Kommission könntest du nicht arbeiten, wie du arbeitest.«
»Das habe ich nicht gemeint, Clarissa. Ich bin dir mehr als dankbar.«
»Wenn ich sage, du verdienst das Zehnfache, dann ist das nicht ganz korrekt. Du verdientest das Zehnfache. Vergangenheitsform. Jetzt?«
Renatas Daten wurden eingeblendet, sie blickte betreten auf den Bildschirm.
»Du warst drei Monate lang die unangefochtene Nummer eins, davor im oberen Fünftel. Jetzt bist du im unteren Mittelfeld, sowohl was die Menge als auch was die Qualität betrifft, Wochentendenz abwärts. Was ist los, Renata?«
Renata schloss kurz die Augen und fuhr sich mit beiden Händen übers Gesicht.
»Der psychische Druck.«
»Welcher psychische Druck?«
»Die Anfeindungen, die Proteste.«
»Nichtsnutze, meine Liebe. Haben sich noch nie in ihrem Leben angestrengt.«
»Mich zerreißt das. Was mir zu schaffen macht, also, ich –«
Clarissa bedeutete ihr unwirsch, fortzufahren.
»Ich finde es unter den gegebenen Umständen nicht richtig, Milch an Bodybuilder und Männer zu verkaufen, bei denen man nicht wissen will, wozu sie die Milch brauchen.«
»Hast du dich an der Supermarktkasse jemals gefragt, ob du diesem Kunden jene Ware nicht geben solltest, weil er sie nicht verdient hat oder verantwortungslos damit umgehen könnte?«
»Das ist nicht dasselbe.«
»Doch, meine Liebe, das ist der freie Markt.«
»Das mit dem Muskelaufbau bei Erwachsenen ist doch Humbug. Die brauchen das nicht.«
»Das entscheiden nicht wir. Du erinnerst dich an meine Rede?«
Renata nickte.
»Menschen, die Muttermilch brauchen. Brauchen kann vieles bedeuten. Wir können nicht entscheiden, wer sie dringender benötigt. Wie sollen wir feststellen, ob eine Bestellung an einen Bodybuilder oder einen Perversen geht?«
»Aber die Regale mit Milchpulver sind so gut wie leer.«
»Das ist die Aufgabe des Staates, der Politik.«
»Die meisten Leute können sich unsere Milch nicht leisten.«
»Das ist eine Frage der Prioritäten. Warum, meinst du, sind die Bestellungen um sechzig Prozent gestiegen? Wir sind Frauen, wir wissen, wie viel Arbeit das bedeutet – erst recht, welche Arbeit du hier leistest: vierhundert Liter Milch pro Monat, dreimal hintereinander! Unglaublich! Wir haben ewig darum gekämpft, dass die unbezahlte, ungewürdigte, ins Haus verbannte Arbeit der Frauen, die ihre Kinder pflegen und ernähren und aufziehen – die sich vielleicht auch noch um einen Mann kümmern –, entgolten wird. Hier wird diese Arbeit gefeiert. Wir dürfen uns von digitalen Kommunisten kein schlechtes Gewissen einreden lassen. Wir können nichts dafür, dass sich die Regale mit dem Babymilchpulver leeren. Wir sorgen dafür, dass viele Menschen – in erster Linie die Kleinsten – hochwertige Milch bekommen. Hat das Kind einer wohlhabenden Familie oder einer Frau, die auf anderes verzichtet, um unsere Milch zu kaufen, weniger Anrecht auf gesunde Ernährung?«
Renata schüttelte den Kopf.
»Du bist keine Arbeiterin mehr, du bist jetzt Unternehmerin. Von einer solchen erwartet man mehr. Von einer solchen solltest auch du mehr erwarten. Du bist Unternehmerin, weil du herausragst, weil du vorangehst, weil du hart arbeitest, weil du etwas willst vom Leben, weil du mutig bist. Du bist ein Vorbild für so viele Goldene, Renata, und für so viele, die eine werden wollen. Es ehrt dich, wenn du dir moralische Gedanken über die Ungerechtigkeiten dieser Welt machst. Die Regale werden bald wieder voll – und wir weiterhin der Goldstandard sein.«
Clarissa stand auf und bedeutete Renata, sitzen zu bleiben.
»Ich sage dir noch etwas über unsere Kritikerinnen. Das sind Frauen, die sagen: Jetzt hab ich mich neun Monate lang kasteit, nicht geraucht, nicht getrunken, keine Drogen zum Tanzen genommen, hab unter Schmerzen ein Kind geboren, und jetzt soll ich weiter stillen und der Mann nicht? Ich bin eine fortschrittliche Frau, warum soll ich mich quälen, wozu gibt es das Fläschchen und die Industrie? Ich will das gar nicht moralisch bewerten. Aber die wollen deine Milch zum Schleuderpreis oder am besten gratis?!«
»Hast du die letzte Drohung gesehen?«
Clarissa nickte.
»Mit solchen Leuten haben wir es zu tun. Unsere Zufahrtswege blockieren. Was heißt das?«
»Dass die Kunden nicht reinkommen und die Milch nicht rauskommt.«
»Und was heißt das?«
»Dass sie nicht bei den Empfängern ankommt.«
Clarissa blickte Renata und gleichzeitig uns alle an.
»Dass Babys, die nach Milch schreien, diese nicht bekommen. Das heißt es.«
»Und –«
»Ein paar Bodybuilder, die um ihren Placeboeffekt kommen und unleidlich für ihre Umgebung werden. Das wollen unsere Weltverbesserer. Aber dazu wird es nicht kommen. Hier« – Clarissa tippte auf ihre Schläfe, dann auf ihr Herz – »lassen wir die nicht rein. Wir helfen Menschen. Du hast bislang sehr vielen Menschen geholfen. Jetzt sind es bedeutend weniger. Lass es wieder sehr viele sein.«
Renata nickte.
»Ich geh dann mal an die Pumpe.«
»Das ist meine Renata!« Clarissa klatschte. »Übrigens habe ich dieses Gespräch zu Schulungszwecken aufgezeichnet. Und jetzt freue ich mich auf den Tag, an dem ich dich wieder als Goldene des Monats auszeichnen darf.«
Renata stand auf, Clarissa ging ihr entgegen und umarmte sie. Renata atmete tief ein, ehe sie den Kopf schüttelte, als wüsste sie nicht mehr, was in sie gefahren war.
Mia lag quer über unserem Sofa. Im Haus des flüssigen Goldes war es still. Es tat gut, Clarissa in ihrem Büro über uns zu wissen. Außer uns Dreien war niemand mehr im Haus. Vor meinem hatte die Polizei eine kleine Menschenmenge zerstreuen müssen, nachdem meine Adresse neben dem Foto mit dem ausgestreckten Mittelfinger im Netz veröffentlicht worden war. Ich versuchte, mir eine riesige Schaukel auf der Spitze eines Berges vorzustellen, auf der ich immer höher und höher schaukelte. Das, hatte mir Clarissa erklärt, beruhige.
6
Ob er mich etwas fragen dürfe, das bestimmt seltsam klinge, hatte Peter vor über einem Jahr auf einer Parkbank gefragt.
Es war ein milder Herbsttag, und ich war mir sicher, Peter werde mich auf ein Getränk einladen. Ich fragte mich, ob ich einwilligen sollte und was er sich davon erhoffte. Ich tendierte zu einem Ja, weil ich ihn interessant, aber nicht anziehend fand. Ich sah ihn beinahe jeden Vormittag in dem weitläufigen Park, in dem ich mit der vor die Brust geschnallten Mia spazierenging und in dem Peter mit seinem vor die Brust geschnallten Sohn spazierenging, wenn er ihn nicht joggend in einem teuren Kinderwagen schob.
Peter war Journalist, und wenn er nicht über die Kleinen sprach, wurde mir bewusst, wie viel ich nicht wusste und dass mich das störte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich beeindrucken wollte. Er schien vorauszusetzen, dass ich über das unterrichtet war, worüber er betont nebenbei sprach. Wenn ich Mia stillte, hielt er seinen Blick so lange auf unsere Kinder gerichtet, bis ich fertig war. Er war, das zeigte er, ein zivilisierter Mann.
Er wollte mich aber nicht auf ein Getränk einladen. Seine Frau, sagte er und blickte auf seine wippende Fußspitze, habe kaum Milch und plage sich beim Pumpen, und ich hätte doch unlängst darüber gestöhnt, viel zu viel Milch zu produzieren, und weil Muttermilch für die Kleinsten erwiesenermaßen weitaus besser als Pulver sei, würde er mich darüber nachzudenken bitten, also – ob ich ihnen nicht hin und wieder ein Fläschchen verkaufen könnte?
Er strich seinem Sohn über den Kopf und blickte mich erleichtert an. Er schien kein Mensch zu sein, der oft um etwas bitten musste. Sie hätten schon überlegt, im Netz Muttermilch zu kaufen, aber zu viele Bedenken gehabt. Ich musste lachen. Er sagte, ihm sei das Lachen mittlerweile vergangen, ich solle mal Mia und Benjamin vergleichen, Kraft, Lebendigkeit, dergleichen. Meine Entscheidung war gefallen. Dennoch bat ich um einen Tag Bedenkzeit.
So begann mein Leben als Milchverkäuferin. Tag für Tag brachte ich Peter vier Päckchen mit, er zahlte gut, ich musste noch immer Milch in die Toilette kippen, verdiente aber ein überlebenswichtiges Taschengeld. Bald würde ich mich ohnehin um eine Arbeit umsehen und eine erschwingliche Betreuung für Mia finden müssen; die Aussicht erfüllte mich nicht mit Freude. Nach wenigen Tagen begann Peter, sofort nach der Übergabe ein Päckchen Milch in ein Fläschchen zu füllen, um es Benjamin zu geben. Er blickte mich verlegen an, wenn etwas danebenging oder auf seinen Fingern landete; sofort zückte er ein Taschentuch und säuberte seine Hände. Vor allem aber sah ich, wie gierig und beglückt der Kleine trank. Eine selige Erlösung legte sich über ihn, und wenn er nicht sofort danach einschlief, krabbelte er neben Mia in der Sandkiste herum, und jedes Mal, wenn Mia endlich bereit war, Benjamin etwas zu geben, worum er zuvor vergeblich gebettelt hatte, war er längst mit etwas anderem beschäftigt. Mir war es, als wäre das ein Sinnbild des Lebens.
Ohne Peter hätte ich mich nicht weiter für den Aufruf des Hauses des flüssigen Goldes interessiert, ihn wahrscheinlich nicht einmal wahrgenommen. Zuerst beeindruckte mich Clarissa durch ihre Eloquenz, ihre Eleganz, ihren Tatendrang, bald aber vor allem durch ihre physische Stärke. Wir trainierten gemeinsam und lachten über die verblödeten Muskelprotze, die sich einbildeten, ihre Muskeln mit Muttermilch weiter aufpumpen zu können, wir schickten einander Videos von den beeindruckendsten Exemplaren dieser Gattung, die fachmännisch die Vorzüge einer Flüssigkeit priesen, die für das Wachstum eines Kleinkinds, aber nicht für jenes eines männlichen Bizeps bestimmt ist. Clarissa hatte starke Schultern, ihre Muskeln waren definiert, beim Trainieren hatte sie ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, zwischen die Schulterblätter war eine strahlende Sonne tätowiert, die man niemals unter ihren makellos weißen Hemden vermutet hätte. Sie kam nicht zum Plaudern; sie war konzentriert. Die Gewichte, die sie auf der Bank stemmte, hätte ich auch vor der Schwangerschaft nicht gestemmt. Clarissa hatte all meine Probleme auf einmal gelöst.
7
»Pumpen können alle.«
Damit hatte Clarissa an einem Spätnachmittag ihre Rekrutierungsrede begonnen. Sie legte eine Pause ein, alle blickten sie gespannt an.