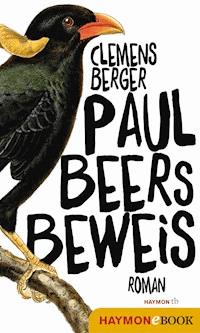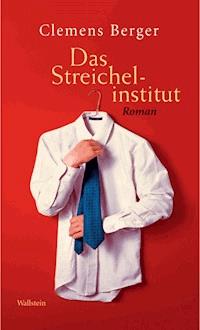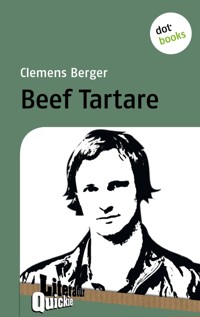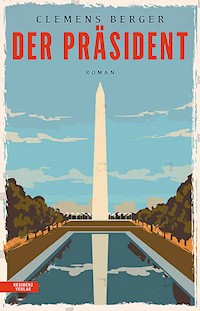Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Clemens Bergers Erzählungen handeln von Leidenschaften. Von der Liebe zu einer französischen Philosophin in Rom etwa, die bald aber nur noch per Brief, E-Mail oder Traum erreichbar ist. Die Titelgeschichte erzählt von Alfred, der in einer Laienaufführung der Passionsspiele den Judas spielen soll. Ohne es zu wollen, wird er von der Figur, in die er schlüpft, völlig absorbiert. Die Fragen, die er sich stellt, um seine Rolle möglichst glaubwürdig auszufüllen, stürzen ihn in immer heftigere Verwirrung. Ist nicht der Verräter im Grunde der verlässlichste Verbündete des Verratenen, weil ohne ihn die ganze Geschichte nicht aufgehen würde? Aber ist er dann überhaupt noch ein Verräter? Alle Zuordnungen entgleiten ihm auf immer umfassendere Weise. In der Erzählung "Schwere Geburt" geht es um eine Künstlerin, die sich aufs Land zurückgezogen hat, weil ihr die zeitgenössische Kunst auf einmal inhaltsleer vorkam und sie im Stil der Alten Meister in Altarbildern Relevantes für die Gegenwart malen will. Aber das bewahrt sie nicht vor Missverständnissen und gar Skandalen. Und auf ganz und gar ungeplante Weise und ohne ihr Zutun führt der Weg zurück ins Museum für Moderne Kunst. Die Liebesgeschichten Bergers sind brüchig, leidenschaftlich, philosophisch und modern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clemens Berger
Und hieb ihmdas rechte Ohr ab
Erzählungen
Inhalt
Eine schwere Geburt
Just because the sky
Und hieb ihm das rechte Ohr ab
So warm im Kopf
Aufreizendes Geplapper
Eine schwere Geburt
1
»Das wahrste Bild von allen, und das revolutionärste«, sagte Iris am Telefon, »ist noch nicht gemalt worden. Glaub mir, einmal werde ich es malen.« Dann erzählte sie vom Herbst am Eisenberg, vom warmen Grün ringsum, von der Wärme der verschiedenen Grüns, die es im Frühling und Herbst, vor allem aber im Herbst gebe. Von ihren einsamen Spaziergängen erzählte sie, von der unsichtbaren Grenze nach Ungarn, die sie für den Inbegriff der Grenze überhaupt hielt. Da wie dort sehe es gleich aus, da sei nichts, was eine Grenze hätte sinnvoll erscheinen lassen, kein Berg, hinter dem die Landschaft plötzlich verändert wäre, kein Gewässer, das unterschiedliche Ufer trennte, nur Weite, braun, ocker, gelb, von grünen Waldinseln unterbrochen, die je weiter entfernt, desto blauer würden. Die Grenze sei gezogen worden, einmal so, dann wieder so, und immer hätten die einen wie die anderen Gründe gefunden, sich denen jenseits der Atlaslinie überlegen zu fühlen. Von den Buschenschänken erzählte Iris, die wochentags nur von Einheimischen, Bauern, Rentnern und Tratschsüchtigen besucht seien und sich wie selbstverständlich an die Weinhügel anschmiegten, und man könne, wie Iris in einem ihrer seltenen Anrufe erklärte, gar nicht anders, als sich hinzusetzen und ein Achtel Rot zu bestellen, schweres, erdiges Dunkelrot, das den Kopf so angenehm verzaubere, die Gedanken so heiter Ringelreih tanzen lasse. Und beim Trinken, beim Schauen, beim Bildersehen werde sie beobachtet, begafft, besprochen. Wer sie diesen Leuten sei, wollte sie wissen, von mir, der ich die Gegend seit Kindesbeinen kenne, von mir, der sie vor einigen Sommern erstmals dorthin geführt hatte, um Wein zu trinken, auf der Wiese zu liegen und jenes Gefühl auszukosten, das der jäh aufblitzenden Erkenntnis entspringt, allein zu sein auf dieser Welt, und zu zweit in diesem Augenblick, der schön ist und bleiben soll, weil morgen ein anderer Tag ist. »Eine Künstlerin«, sagte ich, »die seltsam spricht, seltsam gekleidet ist, aber auch nur ein Mensch, will heißen, alles, nur nichts Besseres.« Sie seufzte und sagte: »Ich hab es so satt.« Sie musste nicht weitersprechen. Ich wusste, was sie meinte.
Iris hatte die Kunst satt. Nicht die Kunst überhaupt, sondern die zeitgenössische, die Kunst am Puls der Zeit, der man doch, wie sie heute meint, den eigenen entgegenpochen lassen sollte. Das Abstrakte, die Installationen, die Fotos, die Videos, die Beipackzettel, die Selbstverstümmelungen, kurz, was sie Scharlatanerie nannte, widerte sie an. Der erste Staubsauger im Museum, sagte sie einmal, sei noch interessant, vor allem wenn ein Kübel mit Putzlappen daneben stehe, der zweite öd, der dritte eine Gemeinheit, für die man, sie meine es zwar nicht todernst, aber eigentlich doch, eingesperrt gehöre. Und all das Weiß, all die leeren Flächen, all die Linien und Quadrate und Kreise, all die abgedrückten Hände und abgeschmackten Selbstbespiegelungen, die verborgen zur Schau gestellte Depression – das hatte sie satt. Dabei hatte Iris selbst so begonnen und war erfolgreich gewesen mit ihren Arbeiten. An der Akademie, wenn Interessierte durch die Klassen schlenderten, blieben sie in neun von zehn Fällen vor ihren Bildern stehen, die eine Rastlosigkeit ausdrückten, ein Irren und Suchen und Verwerfen, eine Anklage der Welt im Namen einer gefeierten, die nicht war und doch. »Und doch«, hatte sie im Café Prückel mit zusammengekniffenen Augen gesagt, kurz nachdem wir einander zum ersten Mal begegnet waren, »gibt es diese andere Welt immer schon, weißt du, wir leben in ihr, aber der Glassturz darüber, der Glassturz.« Also viel Glas, viel Glassturz, Kugeln wie jene, über die Wahrsagerinnen sich beugen, um den Leuten zu sagen, was sie hören wollen und was ihnen ohnehin ins Gesicht geschrieben steht. Und diese Glaskugeln hatte Iris, eifrige Studentin des durchsichtigen Leitfadens, wie man’s macht, mit Rasierklingen gefüllt, mit Kondomen, Rosenkränzen, Embryos, mit zerrissenen Geldscheinen, zerschnipselten Fotos aus der Geschichte des Grauens, mit kleinen Zetteln, auf die sie im Rausch Sinnloses gekritzelt hatte. Und dann, zwei Jahre nachdem wir ineinander eingezogen waren, flog sie nach Barcelona, um einen Freund zu besuchen, einen blutleeren Hasenfuß, der sich als verletzlicher Künstler verkleidete, der Angst vorm Leben hatte, vorm Geruch der Menschen in der U-Bahn, vorm Lärm der Menschen am Strand, vorm Lachen, Essen, Trinken und Nasedrehen, kurz, ein Prachtexemplar dessen, was sie satt hatte nach Barcelona, nach ihrem Ausflug auf den Montserrat.
An einem sonnigen Maimorgen, an dem sie wahrscheinlich neben dem verletzlichen Künstler erwacht war, verließ Iris allein seine Wohnung, trank einen Kaffee auf dem nächstgelegenen Plätzchen, hielt den Kopf in die Sonne, die Arme im Genick verschränkt, dass man, dass ich sie am liebsten in die Achselhöhlen geküsst hätte. Beim Zahlen scherzte sie mit dem Kellner, winkte leutselig zum Abschied und schlenderte durch die verwinkelten Gassen des Barri Gòtic, um doch wieder in die Ramblas einzubiegen, an all den Gauklern, Schaustellern und Randexistenzen vorbei, auf ihrem Weg zum Hafen und zum steinernen Kolumbus, dessen Hand in die Neue Welt weisen sollte, in Wirklichkeit aber, wie sie mir schrieb, in die falsche Richtung weise. An diesem Vormittag aber kam sie nicht so weit. »Wovor bleiben die Leute stehen?«, fragte sie in ihrer ersten E-Mail aus Barcelona. Richtig, vor den Karnickeln, die in ihren engen Käfigen gar nicht anders könnten als rammeln; vor Charlie Chaplin, der eine Gemeinheit sei, und zwar Chaplin gegenüber, anzüglich und dummdreist zeige er mit seinem Stock ins Irgendwo, spitze den Mund, düm dürüm düdüm, kratze sich verstohlen die Eier, bevor er Frauen entgegenpfeife, sich vor ihre Männer schiebe, seinen Stock nach hinten und in deren Eier stoße, ihn einhole und naserümpfend daran rieche – unterm Strich die ödesten Scherze von der Welt, und alle jubelten und klatschten. Sie schilderte ihren Ekel sehr eindringlich.
An diesem Vormittag blieb Iris selbst lange vor einem Gaukler stehen. Ein feingliedriger Mann in weißer Unterhose und weißem Sakko mit viel zu kurzen Ärmeln, der ansonsten nackt war, aber nicht fleischfarben, sondern weiß. Weiß geschminkt das Gesicht, weiß geschminkt die Beine, weiß geschminkt der Oberkörper. Auf einem Podest stand eine Klomuschel, auf der Klomuschel saß der Weiße Mann, las in einem Buch und kümmerte sich weder um die Straße noch um ihr Treiben. Klirrte eine Münze in dem kleinen weißen Topf vor dem Podest, blickte er wie ertappt von seinem Buch auf, presste schrecklich, blähte die Backen, ehe er sich über die Stirn wischte, erleichtert ausatmete, sich abermals wie nach gerade noch überstandenem Entsetzen übers Gesicht fuhr, um seinen Blick erneut den Buchstaben zuzuwenden. Iris stand da, schaute begeistert, »das gibt’s ja nicht«, murmelte sie vor sich hin, mit dieser wunderbar auf- und abhüpfenden, ungemein begeisterungsfähigen Stimme, »großartig«. Sie blieb in einiger Entfernung stehen und beobachtete ihn. Die Vorbeigehenden hielten kurz inne, kratzten sich am Kopf, lachten und kramten nach Münzen. Auf dem Podest stand [email protected], und Iris schrieb mir in ihrer zweiten E-Mail, in der sie den verletzlichen Künstler wohlweislich nicht mehr erwähnte, vom Weißen Mann. Wie er Geld verdiene, indem er auf die Welt scheiße. Wie er nicht nur auf die Welt scheiße, sondern auch auf sich selbst, auf seine Zeit, die er anders besser verbringen könnte als auf einer Klomuschel mit einem Buch in der Hand. Wie sie ihm das, nur genauer, gleich jetzt schreiben werde, also damals, nachdem sie in irgendeinem Internetcafé oder Computerraum einer Universität oder in der Wohnung des Abziehbildes, auf dem verletzlicher Künstler stand, die Nachricht an mich abgeschickt haben würde. So kam Francis zu uns. So wurde Francis Teil unseres Netzes, das uns zu stützen dient, unsere Sprache auszubilden, unsere Einsätze zu verhandeln, unsere Einsamkeiten zu verbinden und unsere Welten denen gegenüberzustellen, in denen wir nicht mehr leben wollen. »Wer sind wir?«, sagt Iris dann gereizt. »Ich weiß nicht«, antworte ich.
Tagsüber saß Francis auf seiner Muschel, las, was ihm gerade Freude bereitete, las sich ein Englisch gegen das Englisch seiner Herkunft an, und unterhielt sich nach Arbeitsschluss in verrauchten Bars im chinesischen Viertel mit anderen Gauklern, lauter, allen Abschminkversuchen zum Trotz, immer noch weiß, grau, silbern, golden schimmernden Gesichtern. Sie sprachen über ihren Tag, was sie verdienten, erzählten einander, was sie sonst wollten vom Leben und wie sie sich durchschlugen. Gab es nichts mehr zu sagen, verbeugte sich Francis, rief »Goodbye, ladies and gentlemen, what a pleasure to meet you, I wish you a dazzling journey!«, nahm seinen Hut von der Bar, setzte ihn lächelnd auf und ging nachhause. Von zuhause konnte er, wie er mir einmal schrieb, nicht sprechen. Er sprach von dem Ort, an dem er meistens übernachtete. An diesem Ort ruhte er sich aus, kochte, trank Kaffee, legte eine Platte auf den Plattenteller und sich aufs Bett, rauchte eine selbstgedrehte Zigarette, sprang irgendwann auf, zog seine schönsten Kleider an und verschwand im Habana Barcelona, ganz nah am Hafen. Francis war aus Birmingham geflohen. Die Backsteinbauten, der schreckliche Dialekt, den die Dummköpfe in den soap operas sprachen, die Industrieruinen, das Grau in Grau, der Regen, wie er mir anderthalb Jahre später im verschneiten Volksgarten erzählte, das lächerliche Wirsindauchdabei der Bond Street, die billigen Lokale am Kanal, der Vodka, one pound a shot, das Bier, die Fußballspiele in den Pubs – all das hatte er satt gehabt. In den Süden wollte er. Und so kam er nach Barcelona, wo er nicht heimisch wurde. Wo er fremd bleiben konnte. Wo ihm nicht jeder Satz an einem Nebentisch schon wie tausendmal gehört und im Endeffekt schrecklich vorkam. Wo er nicht an jeder Intonation schon erkannte, wer jemand war. Er vermied es, Engländer zu treffen, hatte nicht einmal Lust, sich mit einer gut aussehenden Frau oder einem hübschen Mann länger als nötig zu unterhalten, sobald er bemerkte, dass sie oder er von der Insel kam. Selbst in Barcelona wollte er in den Süden, und dieser Süden war das Habana Barcelona, ganz nah am Hafen. Dorthin bestellte er Iris, zu einem Treffen, auf einen Cocktail, wie er in seiner prompten Antwort auf ihre Nachricht geschrieben hatte. An irgendeinem Tag war er in seine Wohnung gekommen, das Stiegenhaus unverändert, die Eingangstür, die beiden Zimmer, die angebrannten Pfannen, sein Schatten an der weißen Wand – alles gleich. Er schaltete seinen Computer ein, rief seine E-Mails ab, und neben den üblichen Be- und Verwunderungsbekundungen, neben einer Nachricht von einem alten Freund, der in Los Angeles saß und ununterbrochen von seinem unbeschreiblichen Glück schrieb, fand er ihre Zeilen, die Bemerkung, dass er auf sich selbst scheiße. Francis lachte. Er drehte sich eine Zigarette, schenkte sich ein Glas Rotwein ein und prostete sich im Wandspiegel zu. Dann setzte er sich an den Computer. Er mache bloß, was alle anderen auch machten, um leben zu können, vor allem jene, die gut leben wollten: Er schiss auf die Welt und lächelte, solange das Geld im Topf klang. Keine Seele sprang aus dem Feuer, Ωniemand hatte die Befriedigung, einem Blinden, einer Witwe, einem Landminenopfer, einem Aidskranken, einer zur Steinigung Verurteilten, einer unschuldig zum Handkuss Gekommenen, einem aufrechten Kämpfer im Dienst einer ehrbaren und gerechten Idee, einer geschundenen, bedrängten, verächtlichen Kreatur zu helfen. Er sei, schrieb mir Francis später, die Wahrheit unserer Zeit. Und die sehe so aus.
In einem hellen Leinenanzug, einem schwarzen Hemd, die halblangen brünetten Haare streng nach hinten gekämmt, die Beine übereinander geschlagen, saß Francis am äußersten Rand eines langen Tisches vor einem Caipirinha, genau so, wie er es Iris angekündigt hatte. Der Engländer im Habana Barcelona unter all den südamerikanischen Männern und Frauen, die ihre Hüften so wunderbar schwangen und ihre Füße so sicher wie leicht im Takt bewegten. Aber Francis saß nicht mit einer Hand in der Hosentasche da, hatte die andere nicht ums Glas gekrallt, beobachtete nicht verkrampft, was ihn anzog und faszinierte, weil es ihm fehlte. Er habe es, schrieb Iris in ihrer letzten E-Mail, eine wunderbare Unmittelbarkeit, eine beneidenswerte Leichtigkeit. Sie hatten sich absatzlos unterhalten, warme Köpfe, offene Gesichter, als er aufstand, ob sie mitkomme, wenn nicht, müsse sie kurz warten. Und Francis tanzte. Tanzte fünf Minuten, tanzte zehn, tanzte, als sei die Welt ganz anders und viel näher an der richtigen, und als er nach einer knappen halben Stunde etwas außer Atem und leicht verschwitzt ihr gegenüber Platz nahm, war er keinen Moment lang belustigt beäugt worden, hatte niemand auf die Bewegungen seiner Füße, niemand auf eine Ungelenkigkeit hingewiesen. »Du bist eine schöne Frau«, sagte er Iris, die mich die Reihenfolge zu beachten bat, »du bist witzig, du bist klug, du bist charmant, aber du bist traurig. Was du mir von deinen Bildern erzählt hast, klingt traurig. Tanz«, sagte er, »lach und wart nicht auf Erlösung! Die Revolution hat immer schon begonnen.« Und weil das nicht nur seine Worte waren, sondern auch ihre, tanzten sie, bis die Lichter angedreht wurden. Ich saß in Wien, las von ihrem Abend und tat es ihnen ein wenig grimmig nach.
Nachdem Iris den Weißen Mann lange beobachtet und ihm zu schreiben beschlossen hatte, spazierte sie – oder das kleine staunende Wesen, das sie einmal gewesen und so gern immer noch war – weiter, die Schritte langsam, federnd, den Kopf hierhin und dorthin gewandt, immer wieder innehaltend, schauend, vormalend. So kam sie in ein Museum, fuhr Rolltreppen abwärts in einen riesigen lichtdurchfluteten Bau, viele Stockwerke, viel Glas, viel Weiß, viel Transparenz in einer undurchsichtigen Welt. Iris schlenderte durch die Ausstellung eines US-amerikanischen Fotografen, der zu denen unten gegangen war, die Vagabunden abgelichtet, Kohlenarbeiter und Illegale wenigstens fürs kurze Gedächtnis gerettet hatte. Im nächsten Raum ein Streifzug von Renoir bis Picasso, den sie gemächlich an sich vorbeiziehen ließ, und im Folgenden das Heutige. Sie ging weiter, die Arme vor der Brust verschränkt, sah sich hier ein Bild an, blieb dort vor stacheldrahtumzäunten alten Zeitungen stehen, vergilbte Berichte von einer Krise im Irgendwo der Welt, ehe sie den letzten Raum betrat, in dem nichts ihre Aufmerksamkeit erregte. Iris sieht würdig aus, wenn sie mit verschränkten Armen, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, durch Ausstellungen spaziert – ich habe sie oft begleitet. In dieser Würde, in ihrer freudigen Genauigkeit, durchquerte sie mit langsamen, vorsichtigen Schritten den Raum. An der abschließenden Wand gingen zwei Nischen weiter in die Tiefe. In der linken lehnte ein Staubsauger, der wirklich, wie sie später erzählte, ein von Putzfrauen stehen gelassener Staubsauger war, zumindest habe sie keine Signatur entdeckt. In der rechten fand Iris eine angelehnte Tür. Sie schob die Tür auf und konnte nichts sehen, ein Kasten verstellte die Sicht. Iris zwängte sich in einen absinthgrün gestrichenen Raum, ein paar Holzstühle standen herum, als sei man gerade von ihnen aufgesprungen, eine Lampe brannte, als brenne sie schon sehr und daher nicht mehr lange, ihr Licht fiel auf ein aufgeschlagenes Buch, das auf einem Tischchen lag. In eine Ecke war eine Couch mit aufgewühltem Überwurf gerückt, auf die hastig Decken geschmissen worden waren. An den Wänden erzählten großformatige Bilder vom Leben in einem sich sozialistisch nennenden Staat, ein von weißen Laken umhüllter Kasten stand in der Zimmermitte quer – überhaupt gab es viele in Weiß gehüllte Gegenstände, ein paar sorglos herumliegende Bücher, offene Kommodenladen, aufgerissene Schranktüren. Und obwohl Iris wusste, wo sie sich befand, stutzte sie. Und obwohl sie sich in ihren Bahnen bewegte, blieb sie regungslos stehen. Durfte sie weitergehen? Die Seiten im Buch umblättern? Sich auf die Couch legen? Gegenstände abtasten? Iris kam gegen das Gefühl nicht an, dass da gerade noch jemand gelebt hatte, dass die hier gelebt und gestritten und geliebt hatten, weg waren. Aber wohin? Und warum? Und weshalb so überstürzt? Wer waren die Leute, die ein so heimeliges, so verschworenes Zimmer verlassen hatten? Hatten verlassen müssen? Hatten sie Westeuropa im Atlas wie die Speisekarte eines Haubenlokals studiert? Und erst als sich ein junger Mann am Kasten vorm Eingang vorbeizwängte, ihr scheu zulächelte, getraute sie sich herumzugehen, konnte sie schauen, anfassen, prüfen. Der Zauber war verpufft, die Aura verzogen, sie musste weiter. Das ist es, dachte Iris auf dem Weg zur Wohnung des verletzlichen Künstlers, das ist wirklich gut. Nachts träumte sie von der Installation als ihrem Werk – sie unheimlich stolz, der Tag der Präsentation, viele Menschen bei der Vernissage, die wohlwollende Rede eines Kunstkritikers, nach der sie die Tür aufstößt. Aber schon nach kurzer Zeit laufen alle mit Taschentüchern vor den Nasen und angewiderten Blicken heraus. Iris wollte Leichengeruch im Zimmer.
Am nächsten Morgen nahm Iris einen Zug zum Montserrat, dem gesägten Berg, und versuchte, ihren Traum zu entziffern, während sie die anderen Menschen beim Tratschen, Küssen, Reiseführerlesen beobachtete. Mit einer Seilbahn fuhr sie zum Klosterbezirk, sah die bizarren Felsen, die sich übereinander türmten, ihr schimmerndes Blaugrau im Gegenlicht, betrachtete wohlwollend die Leute ringsum, ihre Körper, ihre Glieder, ihre Gesichter. Mit einemmal spürte sie den Drang, wieder Menschen zu malen, Touristinnen etwa, mit Digital- und Videokameras, mit Mobiltelefonen und luftgepolsterten Schuhen bei ihrer Seilbahnfahrt zum Kniefall vor einer schwarzen Madonna und ihrem schwarzen Kind. Das alles sah sie selbst, ein wenig später, nachdem sie unendlich lange in einem Seitenschiff der Kirche hatte anstehen müssen, Schritt für Schritt von einem düsteren Raum in den nächsten geschoben worden war, bis sie endlich auf den Stufen stand, die zum Heiligtum führten. Erstaunt beobachtete sie das Niederknien, das flehende Blicken, die Kreuzzeichen, die Tränen, das Küssen der Glasscheibe; sie blieb kurz stehen, sah die Statuen an, wunderte sich über das so schelmische Victoryzeichen des kleinen Jesus und ging weiter. Vor der Kirche musste sie sich setzen, eine Zigarette rauchen, einen Schluck Wasser trinken. Die gleichen Menschen, die eben noch mit feuchten Augen die Heilige Jungfrau verehrt hatten, spazierten völlig verändert, lachend und scherzend, über den Platz. Dann ging sie weiter.
Es war ein schöner Tag, warm, sonnig, so fern vom Bekannten, und sie, Iris, ganz allein in den Ausläufern der Pyrenäen. Sie wanderte schwitzend einen Pfad entlang, irgendwo da hinten, von Bergen verdeckt, lag Barcelona, und irgendwo in dieser Vagheit stand ein Haus, in dessen drittem Stock eine Wohnung war mit einem Zimmer, in dem sie schlafen konnte, und irgendwo da, auf der anderen Seite, war schon Frankreich. Im Aufwärtsgehen, keuchend, näherte sie sich einer Kapelle, hinter der ein unerwartet großes Haus in den Berg gebaut war, über das sich gewölbte, ausgebuchtete Felsen türmten. An die rechte Seite schloss ein schäbiger Aluminiumverschlag. Vielleicht ist es das, dachte sie tausend Meter über dem Meer: Ankommen, ohne erwartet zu werden, und erwartet werden, ohne anzukommen. Das Haus war verfallen, der Verputz längst abgeblättert, und als Iris wenig später das Innere betrat, stand sie inmitten modriger Wände, auf dem aufgerissenen Boden lagen Zigarettenstummel neben Bierdosen, die Fenster scheibenlos. Die Wände waren bekritzelt mit den Namen jener, die einmal hier gewesen waren und im Hiersein ihr Hiergewesensein hatten dokumentieren wollen, in unregelmäßigen Abständen mit Bildern behangen, naiven Ansichten des Berges, abgehalfterter Impressionismus, versehen mit einem eben vergangenen Datum. Wie schlecht, dachte Iris, wie billig. An der Wand hing eine Collage, in deren Mitte ein Fensterchen wie bei einem Adventskalender zu öffnen war. Iris fand eine Bleistiftzeichnung dahinter, einen jungen traurigen Mann mit Hut, zwei Koffer neben sich auf dem Bahnsteig, darunter ein Name, geboren in der Sowjetunion, nach Israel ausgewandert, Ausstellung in einer kleinen Galerie in Barcelona. Zwischen Haus und Aluminiumverschlag flatterte ein Vorhang, Iris schob ihn beiseite. Da lagen Stifte am Boden, Farben, Bilder. Daneben ein Plakat: »Ausstellung, 1 Euro«. Sie ging weiter, war mit einemmal im Freien, sachte setzte sie einen Schritt vor den nächsten, bewegte sich langsam und tastend einen ungesicherten Felsvorsprung entlang. Ausgetretene Turnschuhe, Wasserflaschen, sie kam an Feuerstellen und alten Tassen vorbei. Und immer wieder Höhlen, kleine Einbuchtungen, aber kein Mensch, niemand. Iris blickte hinunter, es ging steil bergab, sehr steil, viel zu steil, sie drehte um und blieb erst im Raum mit dem Plakat wieder stehen. Da waren zwei Türen, die sie vorher nicht bemerkt hatte. Über dem Türstock der einen zeigte eine Farbfotografie orthodoxe Priester in prächtigen Gewändern. Zaghaft klopfte sie an. Durfte sie hinein? Er konnte ja drinnen sein, vielleicht hatte er ein Schweigegelübde abgelegt, das letzte Wort, das besiegelte, keines mehr fahren zu lassen. In all der Unwirtlichkeit, in diesem einsamen, heruntergekommenen Verschlag schien es Leben zu geben, das da, fernab im Irgendwo, sein gelassen sein wollte. Wir stellten uns oft vor, abends, nachts, neben- und übereinander, wie das wäre, wegzugehen, irgendwohin, wo niemand uns kennte, vielleicht sogar kaum jemand wäre, der uns je kennen könnte. Iris war aufgeregt. Sie klopfte noch einmal, wieder nichts, horchte an der Tür, still. Und da öffnete sie die Tür zu einer winzigen, niedrigen Felsenhöhle. Eine Kerze flackerte im leeren Raum, davor stand eine Ikone neben der Aufnahme eines Paares. Auf einem Holzsessel lagen halbfertige Aquarelle übereinander, ein zerschlissenes graues Leibchen, Acrylfarben, Pinsel. Die Schlafstatt befand sich in der Ecke, direkt am Stein, eine mit Gras und Reisig bedeckte Holzplatte, über die Plastik gespannt war. Und obwohl sie wusste, wo sie war, zog sie den Kopf ein und machte die zwei Schritte auf das Lager zu. Und obwohl sie sich nicht in ihren Bahnen bewegte, hob sie ein Bild nach dem anderen auf, setzte sich auf den Sessel und betrachtete, was der, der hier lebte, malte. Es war nicht gut, aber nahe. Als sie ging und die Tür sachte von außen zuzog, wurde der Vorhang beiseite gezogen, verdutzte Frauenaugen blickten sie an, ein Kopf wurde gedreht, und ein Mund flüsterte: »Sorry.« Von da an hatte sie es satt.