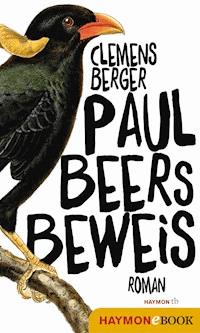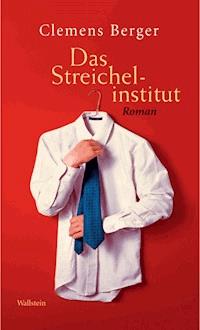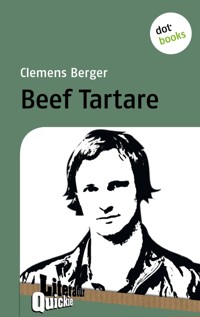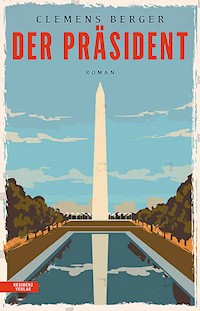18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue Roman des hochgelobten österreichischen Autors
Macht Geld glücklich? Kann uns Geld zumindest freier machen? Gibt es ein richtiges Leben im falschen? Und was passiert, wenn wir uns plötzlich aus der gewohnten Umlaufbahn unseres Lebens herauskatapultieren? Dies sind die Fragen, die Clemens Berger in seinem neuen großen Roman umkreist.
Der international gefeierte Künstler Kasimir Ab, dessen Werke bei Ausstellungen regelmäßig astronomische Preise erzielen, stößt an die Grenzen seines sorgenfrei abgefederten Lebens und entdeckt seine subversive Ader. Er tauscht das Atelier mit der Straße und tritt ungewollt eine gesellschaftliche Kettenreaktion los. Pia und Julian, die bei einer Sicherheitsfirma angestellt sind und Nacht für Nacht Geldautomaten befüllen, fragen sich, wie groß die Summe für einen gemeinsamen Neuanfang in einem anderen Teil der Welt wohl sein müsste. In einem wagemutigen Schritt machen sie ernst und reißen die Brücken zu ihrem bisherigen Leben ein. Und Rita, Tierpflegerin im Schönbrunner Tierpark, wird aus ihrem einsamen, zurückgezogenen Leben durch die Geburt eines kleinen Pandabären herausgerissen und durchlebt unerwartet einen zweiten Frühling.
In meisterlicher Manier fühlt Clemens Berger der Zeit ihren Puls und entwirft einen lustvoll erzählten Reigen um Geldscheine, Schwerelosigkeit und Kuckucke, um Kunst, Auflehnung und Subversion, der den Leser von Wien nach Neapel und Saigon, Bordeaux und Chengdu führt. Nichts ist, was es scheint: nicht einmal ein kleiner Panda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Zigtausende Euros gehen jede Nacht durch Pias und Julians Hände, die beiden befüllen die Geldautomaten Wiens. Eines Tages entscheiden sie, dass ihnen mehr zusteht, als das Leben und die Gesellschaft ihnen zugestehen wollen. Mut, Übermut, Rebellion? Ihre Flucht durch die halbe Welt hält die Menschen in Atem. Subversive Bilder und Botschaften prangen mitten in den Städten und bald auch anderswo, ein »Unbekannter Künstler« denkt sich immer irritierendere Aktionen aus. Kasimir Ab, ein arrivierter Maler, der für seine Bilder längst astronomische Preise erzielt, kann sich dazu nur ein müdes Lächeln abringen. Doch selbst er verfällt der Lust, sein Leben grundsätzlich zu hinterfragen, und gerät dabei gehörig außer Tritt. Und dann ist da noch ein seltsames, tapsiges Wesen namens Fi Fo, das mit seiner Geburt zum neuen Publikumsliebling des Tiergartens Schönbrunn avanciert. Aber nichts ist, was es scheint, nicht einmal der kleine Panda: Er wird zum Symbol des Rüttelns an einer anderen Welt. Einer besseren?
In meisterlicher Manier fühlt Clemens Berger unserer Zeit den Puls: Vom schrillen Kunstbetrieb bis zur erzwungenen Schwerelosigkeit, von kleinen Gaunereien bis zum Gesellschaftsumsturz, vom nächtlichen Wien über Neapel bis Ho Chi Minh City und Chengdu entwirft er einen großen erzählerischen Reigen durch eine nervöse Gegenwart: Ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen? Oder ist da noch etwas zu machen?
Zum Autor
CLEMENS BERGER, geboren 1979 im Südburgenland, studierte Philosophie in Wien, wo er als freier Schriftsteller lebt. Berger hat zahlreiche Romane und Erzählbände veröffentlicht, zuletzt erschien die Novelle »Ein Versprechen von Gegenwart« im Luchterhand Literaturverlag.
CLEMENS BERGER
IM JAHR DES PANDA
ROMAN
Luchterhand
Begräbt sie nur, ihr Toten, eure Toten! Indes ihr noch die Leichenfackel hält, Geschiehet schon, wie unser Herz geboten, Bricht schon herein die neue beßre Welt.
HÖLDERLIN
Erster Teil
Der fünfundsiebzigste Tag
1 Wenn Pia die alten Scheine aus dem Automaten nahm und durch neue ersetzte, überkam sie jedes Mal ein Gefühl, das sie lieber für sich behielt. Eine Arbeit wie alle anderen, sagte sie, falls jemand mehr wissen wollte, bloß behaupteten das Totengräber und Henker wahrscheinlich auch, denen sie genauso wenig geglaubt hätte wie sich selbst.
Man musste glauben.
Das war die Hauptsache.
Man musste glauben, dass die Scheine, die Julian und sie in der Nationalbank in Empfang nahmen, den Kreislauf gewährleisteten, der Menschen versicherte, jederzeit abheben zu können – wenn es etwas abzuheben gab. Man musste glauben, dass die Bündel etwas wert waren, man damit so und so viel kaufen konnte, dass nicht besonders wertvolles Papier tatsächlich gegen Nahrung, Kleidung, Reisen, Gefühle und weiß der Teufel was noch eingetauscht werden konnte.
Der Teufel wusste es: Gegen alles; vor allem gegen Menschen.
Man musste glauben, dass die Scheine überall verstanden wurden, man sie anderswo in andere übersetzen konnte, um anderswo mehr oder weniger oder in etwa gleich viel dafür zu bekommen. Man musste glauben, dass man mit vielen großen Scheinen viel bewegen, ein sorgenfreieres Leben führen konnte. Man musste dem Schein seinen Schein abnehmen, die Zahl, die auf ihn gedruckt war und in der Welt etwas bedeutete. Man musste glauben, dass man es glaubte.
Es war Nacht, wenn Pia in blaugrauer Uniform aus dem Auto stieg, sich kurz umsah und das Foyer einer Bank betrat. Julian saß hinter dem Steuer, blickte abwechselnd in den Rück- und in die Seitenspiegel, seit anderthalb Monaten trug er eine Waffe, die er selbst hatte anschaffen müssen. Es war angenehm, wenn niemand da war, es war unangenehm, wenn sie Menschen bitten musste, einen Augenblick auf der Straße zu warten – vor allem an Wochenenden, wenn manche grausam betrunken waren und in ihr die große Spielverderberin erkennen wollten. Sie sperrte das Foyer ab, öffnete einen Automaten nach dem nächsten, nahm den Zählerstand ab, die alten Scheine aus den Kassetten und fütterte sie mit neuen, die genauso frisch und glatt wie die alten waren.
Das Frösteln, das Erschaudern, das Ziehen in der Brust, wenn sie mit den gebündelten Scheinen hantierte, und gleichzeitig die sengende Wärme in ihrem Kopf, das Pochen an den Schläfen, die Ruhe des Blutes, das unabstellbare Kribbeln. Das war, wie ihr Körper auf die vielen Scheine und die damit verbundenen Möglichkeiten reagierte. Etwas tief in ihr reagierte anders.
Und zwar mit Hoffnung.
Pia schämte sich, als sie Julian ein Zeichen gab, weil sie im selben Moment erkannte, wie harmlos der Mann war. Er lag auf dem Boden in einer Ecke, in einen langen schwarzen Filzmantel gehüllt, eine pralle Tragetasche aus Plastik unter dem Kopf, eine zweite lehnte an der Wand. Langsam hob er seinen Kopf und sah sie mit offenem Mund und toten Augen an. Der Mann war unrasiert, sein struppiger Bart grau, zuallererst waren ihr die langen Nägel und der Schorf im Gesicht aufgefallen. Sie hätte nicht sagen können, wie alt er war. Er hätte siebzig, aber auch fünfzig sein können. Er hatte sich zur Hälfte aufgerichtet und blickte sie ängstlich an.
»Bleiben Sie liegen. Aber drehen Sie sich zur Seite.«
Pia wusste, das war falsch. Sie wusste, sie durfte das nicht tun. So etwas hatte sie noch nie getan, höchstwahrscheinlich gab es eine Verordnung oder ein Gesetz, das in Bankfoyers zu schlafen untersagte. Sie blickte zu den Kameras, als wollte sie sich entschuldigen. Bloß wofür? Sie wandte sich abermals den Automaten zu. Von dem Mann, der sich folgsam zur Wand gedreht hatte, ging keine Bedrohung aus. Aber wenn man sie sah und bemerkte, dass sie ihn nicht aus dem Foyer vertrieb, bekäme sie Probleme, harmlos hin oder her. Sie konnte keine Probleme gebrauchen, ihr Leben war problematisch genug, bisweilen war ihr, als könnte sie jeden Augenblick platzen. Vier Automaten benötigten frische Banknoten, Pia durfte nicht trödeln, ihr Zeitplan war straff und wurde in Echtzeit überwacht. Was war das schon wieder, Echtzeit? Als gäbe es eine andere.
Es war eine Schande, und es war das Wort »Schande«, das Runden in ihrem Kopf drehte, während sie die Automaten entleerte und wieder befüllte und bereit zur Ausgabe machte. Sollte er sich sträuben, könnte sie ihn entfernen oder entfernen lassen. Es lag in ihren Händen. Er lag in ihren Händen. Sie war angehalten, ihn zu entfernen oder entfernen zu lassen. Stattdessen hatte sie sich mit ihm im Foyer eingesperrt. Er atmete tief, sie spürte ihn im Rücken, von der Ecke breitete sich ein unangenehmer Geruch aus.
Und da, in ihren Händen, war all dieses Geld. Das eigentlich niemandem gehörte.
»Natürlich gehört es jemandem.«
»Ach ja?«
»Der Bank zum Beispiel?«
»Scheiß auf die Bank! Woher hat denn die das Geld?«
»Von denen, die es ihr anvertrauen?«
»Von sich selbst! Von der Notenpresse!«
»Ach ja?«
Bravo, Julian, bravo, bravo, bravo! Pia klatschte dreimal, Julian stellte die Musik lauter. Immer schön kühl bleiben, nüchtern, unbewegt. Immer alles so sehen, als könnte man nichts tun, als wäre die Welt, wie sie war, und Ende der Durchsage. Keine Regungen zeigen, die Zähne aufeinanderbeißen, die Augen verdrehen, die Backen blähen, tief einatmen, tief ausatmen. Großartig, wirklich. »Take it easy«, sagte er dann, »easy, baby«, das »easy« in die Länge gezogen, iiiiiisiiiii, tief, beruhigend, als beruhigte sie das. Im Gegenteil, es regte sie nur noch mehr auf, und gerade deshalb verkniff sich Pia, was sie sagen wollte.
Entgegen seiner Gewohnheit hatte Julian beide Hände auf dem Lenkrad. Er blickte geradeaus, auf einmal tat er so, als wäre er hoch konzentriert und müsste der Müdigkeit ein Schnippchen schlagen. Üblicherweise hatte er seine Rechte auf ihrem linken Oberschenkel, bisweilen auch anderswo – so hatte alles begonnen, von einer Nacht auf den nächsten Morgen, als sie vor jeder roten Ampel gierig geknutscht und einander berührt hatten. Wie hätte es auch anders kommen können, hatte Julian unlängst gesagt, was sie ihm immer noch verübelte, obwohl er es wieder nur so dahingesagt haben wollte – Nacht, Geld, Gefahr, ein junger Mann, eine junge Frau, stundenlang gemeinsam in einem gepanzerten Wagen.
Das war im Herbst gewesen, die Blätter hatten gelb und rot geleuchtet, die Sonne war hoch am Himmel gestanden und von Tag zu Tag schwächer geworden. Julian hatte Pia an der Hand genommen, sie waren durch die Stadt gewandert, an Weinhängen entlangspaziert, über die Höhenstraße gefahren, hatten sich in Häuser und Gärten und neue Existenzen hineinfabuliert, in dunklen Vorstadtspelunken mit derselben Aufregung wie in zu teuren Restaurants Platz genommen und sich wie Abenteurer gefühlt, die ständig Neues entdeckten. Sie hatten viel gelacht, in Pias Erinnerung beinahe ununterbrochen miteinander geschlafen, sie hatten halbe Tage im Bett verbracht, waren auf die Straße gegangen, um Essen und Wein aufzutreiben, nur um wenige Stunden später wieder im Bett zu landen. Sie hatten einander so viel zu erzählen und so viel zu verschweigen.
Aber jetzt war Mai.
Und alles hätte anders sein können. Alles könnte, wenn es nach Pia ging, immer anders sein. Sollte anders sein. Manchmal dachte sie, nur um den Gedanken gleich darauf wieder zu verscheuchen, Julian mangle es an Phantasie.
Fassaden zogen vorbei, Häuserzeilen im Dunklen, hinter wenigen Fenstern war Licht, junge dunkle Männer zogen Wägelchen hinter sich her und sperrten Haustore auf, um Tageszeitungen auf Fußabstreifer vor Wohnungstüren zu legen. Schilder und Reklametafeln leuchteten, riesige Lettern warben für oder behaupteten etwas, Taxis mit gelben Lichtern glitten vorbei, hin und wieder wankte jemand nach Hause oder wohin auch immer. Routine hin oder her, ein Job wie jeder andere oder nicht – noch immer stellten sie sich vor, wie es wäre, überfallen zu werden, wie sie reagieren würden. Natürlich war es geübt worden, aber die Wirklichkeit war immer anders.
Die ersten Bäckereien waren erleuchtet, Pia hatte den Geruch von früher in der Nase, wenn sie nach einer langen Nacht hinter der Bar nach Hause gegangen war. Ein paar Menschen trotteten zur Frühschicht, der Tag begann, ihre Runde war beinahe beendet, als sie Julians Hand auf ihrem Oberschenkel spürte.
»Should I take it easy, baby?«
»War nicht bös gemeint. Aber du bist nicht schuld daran. Ich übrigens auch nicht.«
»Aber –«
»Halt die Fresse.«
»So?«
Sie fixierte ihr Kinn zwischen beiden Händen, presste die Finger gegen die Wangen, die Lippen wurden zu einem dicken Kussmund. Julian drehte sich zu Pia, packte sie am Hinterkopf und küsste sie. Die Ampel war auf Rot.
2 Seinen Berechnungen zufolge war Kasimir Ab im August des Jahres 1960 in Apulien gezeugt worden.
Er nahm an, dass es zwischen Mitte und Ende des Monats in einem niedrigen Doppelbett in der Mitte eines Durchgangszimmers geschehen war, nachdem seine Eltern voller Sonne und Salz vom Strand zurückgekehrt waren. Natürlich konnte er genauso wenig ausschließen, dass sie eines Nachts auf dem Strand übereinander hergefallen waren, nachdem sie in einem kleinen Innenhof bei Kerzenlicht gegessen und getrunken hatten. Es konnte auch die Sonne gewesen sein, die seinen Vater oder seine Mutter aus dem Schlaf gekitzelt und im hellen Morgenlicht die Hand zur Seite hatte wandern lassen. Vielleicht waren sie nach einem langen Tag einfach zu Bett gegangen und hatten getan, was ein Mann und eine Frau üblicherweise taten, bevor sie einschliefen.
Kasimir saß vor einem Café und betrachtete die alten Fotos seiner Mutter, während er versuchte, die beiden Säufer auf der anderen Straßenseite zu ignorieren.
Das Bett, in dem Kasimir vermutlich gezeugt worden war, stand in einem hellen, schnörkellosen Raum, über dem sich eine kreuzförmige Decke wölbte. Der Verputz bröckelte, in der Mitte hing eine Glühbirne in einer einfachen schwarzen Fassung, hoch oben hinter dem Bett war ein Fenster in die Wand gelassen, dessen Läden seine Eltern mit einem Stock öffnen und schließen konnten. Geradeaus blickten sie durch ein Fenster auf einen steinernen Brunnen, Wäscheleinen waren von den Ästen eines Baumes zu den Ästen eines anderen gespannt, Kasimir sah eine weiße Unterhose und einen schwarzen Slip neben einem roten Handtuch sanft vom Wind bewegt werden, als er sich nicht länger vorgaukeln konnte, die beiden nicht zu bemerken.
Sie stießen auf ihn auf.
Er hatte es geahnt. Die Säufer auf der Bank gegenüber, von denen er sich seit Minuten beim Essen beobachtet fühlte, wünschten ihn in ihre Mitte. Natürlich war die Kleinigkeit, die er zu sich nahm, keine Kleinigkeit für die beiden Männer auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die mit roten Gesichtern und weiß Gott wann zuletzt gewaschenem Haar allem – und vor allem sich selbst – lange Nasen drehten. Die rotblau geäderte Knollennase des Linken drohte jeden Moment zu platzen, Kasimir Ab wollte sich nicht ausmalen, was er sich trotzdem ausmalen musste, Eiter, Blut, viel Blut, das aus einem berstenden Stumpf spritzte, zerfetzte Haut, die eine dünne Wand ungeschützt im Freien ließe, Nasenscheide, Augenweide, Tatortkreide. Der Rechte schob unermüdlich eine speckige, schief sitzende Schirmmütze auf seinem Kopf hin und her.
Sie tranken Wein aus dem Tetrapack, zwischen ihnen stand eine Flasche Fusel, sie unterhielten sich lautstark und unverständlich, ehe sie kurz innehielten und Menschen hinterherblickten, die sich zweifelhafter Kommentare sicher sein konnten. Sie sahen den anderen beim Leben zu.
Die anderen schienen allerdings weniger interessant zu sein als er, der manierlich seinen Salat aß und mit feinen dunkelblauen Handschuhen eine kleine Schale weißen Tees an seine Lippen führte. Ihm war, als sprächen sie über ihn, als suchten sie Kontakt, als meinten sie, in ihm den verlorengeglaubten Ausreißer aus ihrer Bande erkannt zu haben. Sie klopften einander auf die Schultern, winkten ihm zu, er hörte Gelächter, ein Spatz landete vor ihm auf dem Tisch und begann unverzüglich nach Brotkrümeln zu picken. Auf einmal hielten sie Bierflaschen in die Höhe und prosteten ihm zu.
Nein, eben nicht.
Sie stoßen auf mich auf, dachte er. Sie können Bierflaschen herbeizaubern, mit denen sie mich ködern wollen. Dachte er das für sich oder formulierte er seine Gedanken bereits für Frau Dr. König, die er bei sich längst Mirjam nannte? Es war nicht Hohn, was ihn in der Mittagspause vor einem kleinen Lokal traf; die beiden schienen etwas Verwandtes in ihm zu berühren, auf den schmalen Grat zwischen ihnen und ihm hinzuweisen. Da drüben hätte genauso gut er sitzen können.
Aber Kasimir Ab saß nicht da drüben, hatte sich das Hirn nicht aus dem Kopf gesoffen, trank keinen Wein aus dem Tetrapack und keinen Fusel, während er den anderen beim Leben zusah. Er hätte in diesem Augenblick Hans anrufen, sich zum Flughafen fahren lassen und fliegen können, wohin und für wie lange er wollte. Er hätte zum nächsten Luxuswagenhändler gehen und seinem Chauffeur einen Ferrari kaufen können. Geld spielte keine Rolle in seinem Leben, spielte sie nicht mehr, lange nicht mehr. Es sah auch nicht danach aus, als würde sich das bis zu seinem Tod ändern. Im Gegenteil: Er wurde immer reicher.
Er hatte nichts Böses an der Börse getan, gegen keine Währungen spekuliert, war nicht mit der Ausbeutung armer Menschen in der dritten, vierten, fünften, weiß der Teufel wievielten Welt reich geworden. Er lebte nicht von der Arbeit und Zeit anderer (ja, gut, aber nur sehr indirekt), hatte nichts geerbt, keinen Betrieb übernommen – er hatte einfach nur gemalt.
Er bediente keine Nachfrage. Er hatte ein Angebot, für das es eine Nachfrage gab. Wäre die Welt ärmer ohne seine Malerei, wäre sie anders? Ein Gedanke, zu dem Mirjam, also Frau Dr. König, die das Wort Malerei aus seinem Mund, bezogen auf seine Arbeit »abwertend« nannte, ihn bisweilen zu drängen schien, ein Gedanke, der ihm schmeichelte und den er selbst gern ausbreitete. Wenn man ehrlich war, wäre die Welt ohne Botticelli oder Pollock nicht besser oder schlechter; ärmer vielleicht, eintöniger bestimmt. Alles in allem wäre sie, wie sie war. Das waren Spitzfindigkeiten für wenige, von denen sich noch weniger tatsächlich von Kunst berühren ließen. Er produzierte etwas, das niemand brauchte und trotzdem so teuer war, dass er nachts bisweilen aufschreckte und sich fragte, was es auf sich habe mit ihm.
Einer der Säufer erhob sich schnaufend, Kasimir, der sein Leben lang vermieden hatte, Mitglied einer Bande zu sein, blickte stirnrunzelnd auf sein Mobiltelefon und betrachtete die Fotos seiner Mutter, als hinge davon sein weiteres Schicksal ab. Der Mensch überquerte die Straße, schon stand er vor ihm.
»Meister, hast Zigaretten? Bitte höflichst. Wir sind Penner.«
Penner? Sagte man das in Wien? Und warum nannte er ihn Meister?
»Das ist nicht lustig. Gibt’s nichts zu lachen.«
»Ich habe nicht gelacht. Wie viel kosten Zigaretten?«
»Vier Euro. Vier bis fünf.«
Kasimir Ab griff in seine Hosentasche und schämte sich im selben Augenblick, in dem er die Geldspange herauszog, die ausschließlich große Scheine und viele davon umklammerte. In letzter Zeit geriet er zunehmend in ähnliche Situationen. Immer mehr Bettler zogen ihre Runden, gesund und auf Krücken, verwahrlost und wohlgenährt, von sieben bis siebenundsiebzig, immer mehr Menschen verkauften seltsame Zeitungen, an deren Verkauf sie ein wenig verdienten, an jeder Ecke hielt einer die Hand auf, vor jedem Supermarkteingang fragte eine um Kleingeld, vor jedem Zebrastreifen bat jemand um Gehör für ein Begehr. Und sprang auf einer großen Straße die Ampel auf Rot, sprang gleichzeitig ein Knabe oder eine junge Frau mit Baby oder Babyattrappe auf die Straße, klopfte an die Fensterscheibe und bot sie zu putzen an.
Der Penner blickte zuerst auf die Spange, dann auf Kasimirs Handschuhe, ehe er in seinem Gesicht zu forschen begann.
»Was machst du, Meister, wenn ich fragen darf?«
»Ich fresse kleine Kinder. Und manchmal Penner. Sagt man das in Wien, Penner?«
»Wir sind ja Penner.«
»Sie sehen aber nicht sonderlich müde aus.«
Kasimir nahm einen Fünfzigeuroschein, hielt ihn dem Ungläubigen entgegen, der ihn an sich nahm und langsam zwischen schmutzigen, klobigen Fingern drehte, wobei sein halboffener Mund böse dezimierte Zahnreihen offenbarte. Unter den Fingernägeln war viel Schwarz – und Trauerrand ein schönes Wort. Trauer hatte einen schwarzen Rand, der sich immer weiter ausdehnte.
»Wissen Sie, wie man in Spanien zum Fünfhunderter sagt?«
Der Penner nickte bedächtig, allerdings eher dem Schein zu, den er immer noch in seinen Lederhänden drehte, als könnte er sich jeden Moment auflösen, bevor er ihn fragend ansah.
»Bin Laden. Jeder redet von ihm, keiner hat ihn gesehen.«
Der Penner kratzte sich am Hinterkopf, versuchte zu lächeln, streckte den Rücken durch und blickte Kasimir unverwandt an.
»Danke, Meister. Gott schütze dich.«
»Gott?«
»Wer sonst?«
Und mit diesem »Wer sonst?« tippte er keck an seine Schläfe, salutierte zackig, sog durch die Nase Luft in seine Lungen, die Knolle schwoll an und wieder ab, er drehte sich um, beschleunigte seinen Schritt und blieb erst vor seinem Kompagnon wieder stehen. Während er mit dem Daumen über den Rücken lebhaft in Richtung Geldspange wies, redete er auf seinen Kumpel ein, der dem Meister übertrieben freundlich zuzuwinken begann. Kasimir Ab rief die Kellnerin. Er wollte nicht abwarten, dass aus Dankbarkeit noch einmal und inbrünstiger auf ihn aufgestoßen würde.
3 Es war seltsam, mit Klopapier durch die Stadt zu gehen. Pia vermied es, Entgegenkommenden in die Augen zu blicken. Sie hatte eine Tragetasche in ihrer Linken und zehn in Cellophan verpackte Klopapierrollen in ihrer Rechten. Ganz schön was vor, mochte man denken. Dachte sie zumindest bei jungen Männern, die schwere Bierkisten aus Supermärkten schleppten.
Pia fragte sich, wie viele Hundert Meter, wenn nicht Kilometer ausgerollten Papiers das seien, bis sie laut lachen musste und sich vornahm, es stolz durch die Stadt zu tragen. Gleichzeitig fiel ihr ein, wie selten sie Menschen mit Klopapier auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sah. Die Menschen versteckten das Klopapier. Sie taten, als kauften sie keines. Wahrscheinlich zogen deshalb so viele Einkaufswägelchen hinter sich her.
Als sie wieder aufsah, bemerkte sie, dass niemand sie ansah. Allerdings sahen viele aus, als verdammten sie die öffentliche Sichtbarkeit von Klopapier, als wäre es unstatthaft, die Menschen an das Große Geschäft zu erinnern. Es gab Menschen, die mit dem Verkauf von Klopapier reich wurden. Darüber sollte man eine Dokumentation drehen! Pia liebte Dokumentarfilme, wann immer sie Zeit hatte, ließ sie sich in die Geschichte, in ferne Länder, ins Weltall oder zu exotischen Tieren entführen. Seit gestern wusste sie mehr über Google, vorgestern hatte sie sich die größten Containerschiffe der Welt erklären lassen, vorvorgestern Bekanntschaft mit der ersten Pharaonin geschlossen, Hatschepsut hatte sich bisweilen als Mann ausgegeben. Seit wann gab es Klopapier? Wo war es zuerst aufgetaucht? Wer war der König der Lagen? Sie würde später nachschauen – und Julian gelangweilt abwinken.
Vor einer Buchhandlung lagen verbilligte Bücher auf einem Tisch, Pia trat näher. 1000 Orte, die Sie sehen müssen, bevor Sie sterben. Das Buch war vergünstigt, Pia schlug es auf. Schöne Landschaften, aufregende Städte, atemberaubende Ausblicke. Jede Landschaft, jede Stadtansicht, jede Schlucht und jeder Strand eine Werbung. Neben ihr schmökerte ein älterer Mann in einem Taschenbuch, wobei unschwer zu erkennen war, dass er nur so tat. Er schielte ständig nach ihr.
»Stört Sie das?«
Pia schwenkte die Klopapierrollen in ihrer Rechten.
»Unangenehm? Unanständig?«
Der Mann schüttelte den Kopf, legte das Taschenbuch zurück und ging brummelnd weiter, als hätte er sich vor einer Verrückten in Sicherheit zu bringen. Die Verrückte war keineswegs verrückt. Sie hatte eine stinknormale Frage gestellt. Pia blickte dem Mann hinterher, der immer noch seinen Kopf schüttelte.
Wahrscheinlich bevorzugten der Mann und seine Frau Klopapier mit Kamillengeruch. Schön weich und sanft. Die Welt war weder weich noch sanft, Verrückte lauerten überall. Außerdem konnten Weich und Sanft unerwartete Überraschungen bereithalten. Unlängst hatte sie in einer U-Bahn-Zeitung von der großen Verwunderung des Mannes XY gelesen, der Klopapierrollen aus dem Cellophan geholt habe und plötzlich aus einer Rolle von zwei kleinen Augen angeblickt worden sei. Zum Glück hatte der Mann alles mit seinem Mobiltelefon fotografiert und somit Pia den verängstigten Siebenschläfer sehen lassen, der in einer Kartonröhre gesteckt war.
Pia würde das Buch nicht kaufen. Es war eine Gemeinheit. Als wäre man kein vollwertiger Mensch, wenn man diese Orte vor seinem Tod nicht gesehen hatte. Man musste reich sein, um die Orte zu sehen, die man vor seinem Tod gesehen haben musste. Selbst wenn es nur hundert Orte gewesen wären. Der Titel brachte sie auf die Palme, sie sah sich mit einer Kokosnuss zwischen den Zweigen sitzen und auf Dummköpfe werfen, die dergleichen schrieben. Sie würde das Buch aus dem Verkehr ziehen. Pia blickte sich unauffällig um und beugte sich über den Tisch, als sähe sie ein anderes Buch genauer an. Es war gelb.
Vor dem Haus des Meeres blieb sie stehen. Es standen sehr viele Menschen davor, vielleicht war es einer der Orte des Buches, das neben Zahnpasta, Gemüse und Nudeln in ihrer Einkaufstasche lag. Die meisten standen nicht wie üblich in Schlangen vor dem Eingang, sondern blickten auf die Fassade des Flakturms, wiesen einander auf die Feuerleiter an der rechten Seite hin, fotografierten und tuschelten aufgeregt. In etwa vier Metern Höhe, über den Köpfen der Schaulustigen, war auf dem graubraunen Beton ein riesiger dunkelroter Fünfhunderteuroschein zu sehen.
Pia lachte – und wusste nicht, warum. Sie fand den auf die Wand gesprühten Schein wunderbar – und wusste nicht, warum. Sie hielt das Ungetüm für erleichternd – und wusste nicht, warum. Üblicherweise wusste sie aber gern, warum etwas etwas in ihr bewirkte.
Am Rande der Zusammenrottung standen eine junge Polizistin und ein junger Polizist. Pia fragte sich, warum junge Polizistinnen immer blond waren. Vielleicht hatte sie Unrecht, und es war ihr Blick, dem blonde Polizistinnen besonders auffielen. Jedenfalls passte das Blond ausgezeichnet zum Dunkelblau der Uniform. Die Polizistin fotografierte den falschen Schein mit ihrem Mobiltelefon, während sie etwas in ihr Funkgerät murmelte, der Polizist sprach mit einem aufgebrachten Mann, der beim Reden unentwegt mit den Schultern zuckte und sein Gegenüber anstarrte, als wollte er es auf den Boden nageln.
Das Rot ließ Pia an Blut denken. Es war nicht die richtige Farbe, der Schein war in Wirklichkeit heller, violett oder lila. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal einen gesehen – und ob sie überhaupt jemals einen in ihren Händen gehalten hatte. In die Automaten kamen sie jedenfalls nicht. So viel konnte man nicht auf einmal abheben.
»Wer macht denn so was?«, fragte der Aufgebrachte den Polizisten, der die Backen blähte, um seine Ratlosigkeit zu unterstreichen. Allerdings fragte der Aufgebrachte nicht, er schrie beinahe, sein Gesicht war gefährlich gerötet. »Was soll denn das«, rief er, wieder war es keine Frage, »was soll denn das, zum Kuckuck!« Pia zückte ihr Mobiltelefon, fotografierte den riesigen Schein und schickte das Foto Julian. Etwas stimmte nicht.
Im Nähertreten entdeckte sie einen Hund und musste so laut lachen, dass man sich nach ihr umdrehte. Der Polizist blickte sie vorwurfsvoll an; wahrscheinlich wollte er verhindern, was nicht zu verhindern war. Der Aufgebrachte drehte sich um, wollte in Pias Richtung, die Polizistin berührte ihn sanft, aber mit Nachdruck an der Schulter. Er blieb stehen. Sein Gesicht war hochrot, Pia fürchtete, er möge einen Herzinfarkt erleiden. Herzkasperl, dachte sie, gutes Wort.
»Was gibt’s da zu lachen?«
»Sieht besser aus, so«, sagte Pia und ging weiter. Das Klopapier in ihrer Rechten federte mit jedem Schritt, sie fragte sich, ob sie dem Aufgebrachten eine Rolle anbieten solle. Ich würde Ihnen gern eine Rolle anbieten. Nein, nicht in meinem neuen Dokumentarfilm.
Im Weggehen drehte sie sich noch einmal um. Ihr fiel ein, wie oft ihre Mutter sie in das Haus des Meeres geschleppt hatte, obwohl geschleppt gemein war. Pia erinnerte sich bloß an ein vages Gefühl der Freude unter all den Tieren, an ein Entzücken und Schauen und Hören, an Lächeln und Japsen und Luftanhalten. Menschen schienen gern an diesen Orten zu sein, an denen etwas ihre Augen leuchten und ihre Münder offenstehen ließ. Vielleicht bewachte der Hund die Tiere des Meeres.
Kurz vor Julians Wohnung hatte sie sich daran erinnert, dass es Samstag und er auf dem Weg ins Stadion war. Sie war mit dem Klopapier durch die halbe Stadt spaziert. Es handelte sich um die günstigste Marke. Sogar beim Scheißen musste sie aufs Geld schauen.
Julian war nicht auf ihr Foto eingegangen, stattdessen hatte er ihr eines aus der U-Bahn geschickt, über das sie den Kopf geschüttelt hatte. Pia verstand nicht, wie sich ein erwachsener Mann einen grünweißen Schal umbinden und in eine U-Bahn steigen konnte, in der es vor grünweißen Schals, Trikots, Fahnen und Mützen nur so wimmelte. Aber Menschen mit Klopapier in der Hand sah man seltsam an. Wenn sie ehrlich war, hatte sie Julian in dieser Verkleidung schon beim ersten Mal lächerlich gefunden. Er war Teil einer befremdlichen Masse geworden. Sie hatte sich ein wenig für ihn geschämt.
Zu Hause saß Pia in Shorts und Leibchen auf ihrer Couch, die Laufschuhe an den Füßen. Sie hatte eine Fotostrecke vom Haus des Meeres entdeckt, den Artikel dazu konnte man kaum Artikel nennen. Abgesehen davon, dass das Graffito in der Nacht von Freitag auf Samstag angebracht worden sein musste, erfuhr sie nichts Neues. Neben dem Artikel konnte man abstimmen, ob der Fünfhunderteuroschein an der Wand des Flakturms Kunst oder Vandalismus sei. Diejenigen, die ihn für Vandalismus hielten, waren zu zwei Dritteln in der Mehrheit. Pia klickte Kunst an, obwohl es lächerlich war. Als ob ihre Meinung zu irgendetwas zählte. Vor dem Haus des Meeres wäre sie nie auf Kunst gekommen.
2,9 e + 11 hatte der Rechner ihres Mobiltelefons ausgespuckt, wie viel auch immer das war, für Pia war es eine unvorstellbare Zahl. Sie lief durch den Schlosspark von Schönbrunn, der Kiesel knirschte unter ihren Sohlen. Sie sah den riesigen dunkelroten Schein über den Köpfen der Menschen, sie sah den Aufgebrachten, dem sie eine Rolle hätte anbieten sollen und der höchstwahrscheinlich andere im Netz von der Ungeheuerlichkeit dieser Tat zu überzeugen suchte, sie sah die Scheine, von denen es 580 Millionen gab.
Üblicherweise dauerte es zwanzig bis dreißig Minuten, ehe sie im Moment angekommen war und das Tempo erhöhte. Dann verzogen sich ihre Gedanken, jagten einander nicht mehr im Kopf, führten nicht länger von einem zum nächsten. Sie wurde ruhiger, die Schritte, der Atem, die Stille, die wunderbare Leere, die keine Leere war, sondern alles anders in sich aufnahm. Sie schwitzte, ihr klatschnasses Leibchen klebte an ihrem Körper, sie ging an ihre Grenzen.
Dann endlich nichts mehr, nur noch ihr Atem, der Kiesel, die Bäume und Vögel, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter drangen. Hinter ihrem Rücken lachten Kinder über Pinguine, beobachteten Löwen und Tiger, wurden Eisbären gefüttert und Elefanten bestaunt, streuten Tierpfleger Bambus vor Pandas und sprachen mit sanften Stimmen zu Giraffen. An manchen Tagen hörte Pia die Wölfe heulen.
Ihr Kopf war warm, der Schweiß troff aus allen Poren, als sie um eine Ecke bog, kam ihr ein großer Schwarzer entgegengelaufen. Trotz der Wärme trug er einen Kapuzenpullover, die Kapuze über dem Kopf – beim Anziehen dürfte der Pullover blau gewesen sein, jetzt war er dunkelgrau. Er lächelte sie an, sie lächelte zurück, auf einmal hörte sie einen dumpfen Knall.
»Fuck.«
Pia drehte sich um, der Mann lag auf dem Boden und hielt sich den Kopf. Sie trabte zurück, er wollte aufstehen, der Schmerz zwang ihn in die Hocke zurück. Mit beiden Händen massierte er seine aufgekratzte Stirn, hielt die Hände vor die Augen und blickte sie kopfschüttelnd durch die gespreizten Finger an.
»Oh my God. This is so embarrassing.«
Er lachte und schüttelte den Kopf. Er sah sie wie ein kleiner Junge an, der auf frischer Tat bei einer Dummheit ertappt worden war. Der Baum, an dem er nie mehr unbeteiligt vorbeilaufen würde, bewegte sich nicht. Der Mann rappelte sich auf, stand verlegen vor ihr, sie trippelte im Stehen.
»Sie sind schuld.«
»Verklagen Sie mich.«
Bevor er nach der Zustelladresse für die Klageschrift fragen konnte, wünschte Pia seinem Kopf alles Gute, drehte sich um und lief weiter. Sie bemerkte, dass sie lächelte.
4 Sophie hatte die Farben gemischt, um die Kasimir vor der Mittagspause gebeten hatte, Antoine war zur Druckerei gefahren, um die limitierte Luxusausgabe eines neuen Bildbandes abzuholen, der Kaffee duftete, Passalacqua, aus Neapel, in seinem Atelier duldete er keinen anderen. Er sah die Spaccanapoli, er stand auf dem Vomero, er wartete unter den Extremgläubigen im Dom auf das Blutwunder des Heiligen Gennaro, er küsste Martha und sah den dreißigjährigen Kasimir in die Sonne blinzeln, wann immer er den Kaffee roch. Er sah auch die schlaflosen Nächte, die angsterfüllten Tage, seine brüchige Welt, der er im Süden zu entfliehen versucht hatte, während sein Gehirn rund um die Uhr mit der Frage beschäftigt war, ob er verrückt werde oder bereits verrückt sei. Er bat Sophie, auf die Terrasse zu kommen. Die Leinwände konnten warten.
Es war Mitte Mai, es war warm, Kasimir liebte die Sonne und die Wärme, auch wenn er jene allzu oft bloß durch die Glasfront zu sehen bekam. Er legte sich auf eine Liege am Pool und bat Sophie, sich ihm gegenüber hinzulegen.
»Was hältst du von mir?«
Sophie setzte sich auf, schob ihre Sonnenbrille auf den Kopf und lachte.
»Wie meinst du das?«
»Wie ich’s gesagt habe.«
»Ich bewundere dich.«
Sie blickte sich um, ihr Kopf deutete einen Kreis über die riesige Terrasse an, über Blumen, Pflanzen, Sträucher und Gewürzstauden, über den Pool, das Gras ringsum, den Holzboden und den Rasen, über den Tisch, die Stühle, die Hängematte, bevor er einen weiteren Kreis über das Atelier – und allgemeiner: über das Haus – andeutete.
»Hab ich mich verkauft?«
»Bist du verrückt?«
»Sei ehrlich.«
»Du lässt deine Werke verkaufen.«
Kasimir setzte sich auf, winkte sie heran, Sophie tat, als schliche sie sich auf Zehenspitzen an. Er schloss sie in die Arme, sie strich ihm über den Kopf, er spürte ihre Brüste unter seinem Hals.
»Du hast dein Ding durchgezogen. Meine Kollegen denken Tag und Nacht darüber nach, was irgendwelchen Sammlern gefallen könnte.«
»Lass uns um die Wette schwimmen. Sechs Längen, dann geht’s ab an die Ar–«
»Wolltest du Arbeit sagen?«
»Na ja, für dich.« Er lachte. »Der Verlierer schreibt ein Gedicht und liest es beim nächsten Rambazamba vor.«
»Mein Bikini ist in der Wäsche.«
»Ich verzichte auf meine Badehose. Keine Angst. Aber bitte auch keine Vorfreude.«
Sophie erhob sich, zeigte ihm den Vogel, knöpfte ihre Jeans auf, streifte sie ab, bevor sie sich das blaue Leibchen über den Kopf zog. »Komm schon«, rief sie, »alter Spanner«, Kasimir zeigte Sophie den Vogel, stand auf, ließ Hose und Unterhose auf einmal hinunter und knöpfte sein Hemd auf. Während Sophie unter der Dusche stand, die Arme blau, rot, grün tätowiert, stachelige Muster, sich windende Ranken, Worte in Schreibschrift, rotschwarze Sterne am Halsanfang, war ihm, als wäre er einer der wenigen Verbliebenen, die sich keine Tinte in die Haut hatten stechen lassen. Vielleicht sollte er sich Dürers Hände auf den Rücken tätowieren lassen und als ironisches Zitat ausgeben. Vielleicht sollte er sich Trauerrand auf die Fingerknöchel tätowieren lassen. Er zählte nach. Bingo! Dieses Gehirn müsste man einmal gesondert begraben.
Erstaunlich, was Sophie alles auf ihrer Haut trug; das meiste kannte er aus ihren Pausen, wenn er vor den Leinwänden stand und sie im roten Bikini Längen schwamm. Antoine neckte sie dann bisweilen, aber das war unverfänglich, man wusste nach den ersten paar Worten aus seinem Mund, dass er sich nicht für Frauen interessierte. Kasimir genoss durchaus, wie Antoine ihn bisweilen ansah, es war, ja, Mirjam, auch schmeichelnd, von jemandem begehrt zu werden, der nicht infrage kam. Sophie stand am Beckenrand, streckte und reckte sich, als wärmte die Titelverteidigerin vor dem Finale der Weltmeisterschaft auf.
»Brust oder Kraul?«
Kasimir musterte sie von unten nach oben, hielt seinen Blick kurz auf ihren verzierten oder verunstalteten Brüsten und lächelte.
»Beim Kraulen wäre ich im Nachteil.« Mit dreißig hätte er seine Seele für Sophie verkauft. »Verziert.«
»Was?«
Er winkte ab, stellte sich neben sie, begann zu zählen, »eins«, »zwei«, bei »drei« köpfte er ins Wasser, blickte kurz nach links, als er auftauchte, war Sophie nicht zu sehen. Er spannte seinen Körper an, Kopf über, Kopf unter dem Wasser, Zug für Zug, bei der ersten Wende war sie hinter ihm, bei der zweiten spürte er sie schneller werden, bei der dritten waren sie gleichauf, bei der vierten sah er sie bereits von hinten, Kasimir schwamm, so schnell er konnte, die Sonnenstrahlen standen schräg im Becken, ließen das grüne Invictus auf dem Boden funkeln, er holte auf, aber als er nach der sechsten Länge auftauchte, strich Sophie ihr Haar nach hinten, atmete langsamer und lächelte ihn an.
»Ich freu mich auf dein Gedicht.«
»An die Arbeit, husch.«
»Es geht nicht unbedingt um die Brust, Meister, der Brustkorb muss gedehnt sein.«
»Wir reden Ende August weiter. Sag, was ist eigentlich mit dem Streichelmonster von gegenüber?«
»Die Lady hat den Laden übernommen. Er soll an einem Buch schreiben.«
»Bring ihn mal vorbei.«
Fünf Minuten später stand Kasimir Ab in Spielkleidung vor seinen Gemälden. Er arbeitete nicht, er verspottete den grassierenden Arbeitswahn. Jeder musste auf einmal arbeiten, selbst Fußballer sprachen im Fernsehen davon, gut gearbeitet zu haben und noch mehr und konzentrierter und zielgerichteter arbeiten zu müssen; Politiker mussten arbeiten, Künstler mussten arbeiten, Schriftsteller arbeiteten besonders hart, Schüler mussten arbeiten, man vergaß beinahe, dass bereits Säuglinge arbeiteten – immerhin war es kein Kinderspiel, Muttermilch aus der Brust zu saugen. Vor wenigen Tagen hatte er im Fernsehen Staatsbedienstete der Vereinigten Staaten gesehen, die eines Haushaltsstreits wegen für ein paar Tage zu Hause bleiben durften, was die Verrückten dazu genutzt hatten, auf die Straßen zu ziehen und »Wir wollen arbeiten« zu skandieren.
Er wollte spielen.
Kasimir trug alte Jeans, ein vor Jahren in Weiß gekauftes Leinenhemd, das er Fleischerhemd nannte und das bei einer Auktion einen aberwitzigen Preis erzielen würde, auf dem Kopf einen vor unvordenklichen Zeiten weißen Strohhut, auf den eine gewisse Frau mit schwarzem Edding in fetten Blockbuchstaben das von zwei Ohren eingerahmte Wort ARSCH geschrieben hatte. Zum Glück konnte ihn niemand von denen, die sechsstellige Beträge für seine Bilder ausgaben, in diesem Aufzug sehen. Sophie hatte gut gemischt, aber es war ein grüner Tag. Er rief nach ihr.
Er brauchte jetzt sein Grün.
Und wie grün dieser Tag war.
Das Gras war grüner auf der anderen Seite, immer, aber auch auf seiner Seite, wenn er kurz zur Seite blickte, war es grün draußen, um den Pool, grün wie die Augen des Penners, grün wie das Männchen in der Ampel, grün wie der Schnabel, den er einmal gehabt hatte und sich bewahren und auf keinen Fall halten wollte, hinter den Ohren war er grün gewesen, grün wie der Klee, über den er seit Jahr und Tag gelobt wurde, Kasimir fuhr mit dem rechten Zeigefinger in die Farbe, schmierte sie sich hinter das rechte Ohr, angenehm kühlend, die kalte Farbe, bevor er die Teleskopstange mit der Walze eintauchte und die Leinwand attackierte, als hätte sie auf ihn aufgestoßen, grün war ein seltsames Wort, jedes Wort war seltsam, wenn man es nur oft genug wiederholte, es wies in eine Richtung, oh, ihr Blätter, Kokablätter bittersüße, Bambus für Pandas, Eukalyptus für Koalas, gründen, grünzen, in Grünzüng war er lange nicht gewesen, die Penner, Säufer, Tunichtgute, Tagediebe, Passantenkommentatoren waren ihm nicht grün, weil er ihnen grün und nicht grün in einem zu sein schien, Grünzeug, Gründerzeit, Kasimirgrün, Kasimirabgrün, Kasimirabgründe, abgründiges Grün war die Farbe, die er auftrug, sie rann, verdickte sich, lief in Schlieren von oben nach unten, mäanderte wie das Aderngeflecht auf der pompösen Knollennase, er stand auf einer Leiter, Gründonnerstag, wer sagte es denn, Donnerstag war’s und ein grüner noch dazu, und die Hände, die das Grün führten, bis das Wort sich auflöste, bis es jede Bedeutung und jede Verbindung zu irgendetwas verlor, waren unbekannte Hände, kein Spleen, ihr Grünspatzen, die ihr etwas ergründen wollt, kein Marketingkonzept, kein Schmäh, wie man in der Stadt hinter seinem Rücken sagte, ihr Grünköpfe, ich will euch nicht die Hand reichen, will nicht überall mit allem in Berührung kommen, will euren Dreck nicht anfassen, hinterlasse keine Fingerabdrücke, lasse meine Hände nicht ablichten, damit ihr kommentieren, analysieren, spekulieren könnt, meine Trauerränder und Hoffnungsränder sind meine, wir kommen auf keinen grünen Zweig, heute nicht und niemals, Ölzweig, arme Taube, gestrandete Arche, sinkender Spiegel, gründlich will die Leinwand grundiert werden, grünst nur, grünst, er grünste auch, grüne Karten, die viele erwarten, er rief nach Sophie, nach Grünem Veltliner, der Abend würde grau sein, nur so zu überstehen, Kasimir schwitzte, hatte er behauptet, nicht zu arbeiten, bezahlten sie so viel, weil er doch arbeitete, oder bezahlten sie so viel, weil er gerade nicht arbeitete und wie ein Narr auf einer Leiter und grün und gründlich hinterm Ohr und Teleskop und Walze und innehalten im rechten Moment, er ließ sich das Holz reichen, gebot dem Grün Einhalt, lenkte es in andere Bahnen, hievte die riesige Leinwand auf den Boden – dann nur noch die Musik, dunkelrote Choräle, das Licht im Freien, die Vögel auf den Ästen, die Bewegungen, keine Gedanken, es war ein grüner Tag, es war sein grüner Tag, bis Kasimir Ab daran zu zweifeln begann.
5 Als Pia das Lächeln in Julians Gesicht und die Freude in seinen Augen sah, konnte sie ihm nicht böse sein. Er fiel ihr um den Hals, drückte sie an sich, rieb seine Wangen an ihren, küsste sie auf die Ohren. Er roch nach Bier und Zigaretten und Zwiebel.
»Nur drei Bier.«
»Und vor dem Spiel?«
Er lächelte.
»Und einen kleinen Joint?«
Julian sah sie mit einem Blick an, der genau zu wissen schien, er habe etwas getan, das er nicht hätte tun sollen und genau deshalb getan hatte. Die Niederlage hatte ihm offenbar nicht sonderlich zugesetzt.
»Ich will nur mit dir sein.«
»Außer im Stadion.«
»Auch im Stadion. Ich kauf dir eine Jahreskarte, ich –«
»Jetzt gehen wir brav unter die Dusche und dann essen. Ich hatte nämlich keinen Döner.«
Julian sah sie an, als wäre sie eine Wahrsagerin. Sein Mund stand offen, er wollte etwas sagen, er sagte es nicht. Stattdessen grinste er, zog Schultern und Augenbrauen hoch und seufzte tief. Er bestand darauf, dass sie in das enge Badezimmer mitkomme, während des Duschens wollte er ihr etwas erzählen. Beim Abstreifen der Unterhose stolperte er beinahe, verhakte sich mit einem Bein im Stoff und stützte sich kichernd an der weißen Wand ab. Pia hatte den Deckel auf die Klobrille geklappt und sah ihm kopfschüttelnd zu. Ein gutaussehender, betrunkener Anhänger Rapid Wiens in dem kleinen Badezimmer einer kleinen Wohnung in einer abgehalfterten Straße.
Julian war ein großer, starker Mann, auch wenn er sich gerade wie eine Robbe oder sonst ein Tier anstellte, das nicht sonderlich bewegungsfähig war. Alles an ihm war groß, das war ein beträchtlicher Vorteil, was immer andere Frauen sagen mochten, um andere Männer in Sicherheit zu wiegen. Er hatte einen breiten Rücken, muskulöse Schultern, einen starken Nacken. Sie liebte seine gewölbte Brust, den definierten Trizeps, seinen hervorspringenden Bizeps, einen Hügel, auf den sie gern ihren Kopf legte. Vor allem liebte sie seine starken Beine, mit denen er jedem jederzeit davonlaufen könnte, außer ihr. Die Zeit, die sie mit Laufen zubrachte, verbrachte er in der Kraftkammer. Er trainierte wie ein Besessener. Wofür, hatte sie einmal wissen wollen. Für dich, hatte er geantwortet, aber das war höchstens die halbe Wahrheit.
Er trainierte, als müsste er bald an einem Aufstand teilnehmen. Als rüste er sich für härtere Zeiten. Als stünde eine entscheidende Schlacht bevor, auf die er sich vorzubereiten hätte. Jetzt war es aber gut, Pia wollte keinen Bodybuilder. Julians Körper erinnerte sie an alte Heldenstatuen, oder umgekehrt. So ähnlich sieht mein Mann aus, dachte sie bisweilen mit einem Lächeln, wenn sie durch die Stadt ging, in Stein gehauene Helden sah und sich fragte, wie man damals trainiert habe.
Julian stand unter der Dusche, die Trennwand aus Milchglas hatte er nicht zugezogen, und sprach einen Vornamen nach dem nächsten aus, als spräche er von ihr wohlbekannten Freunden. Steffen habe einen schlechten Tag erwischt, nicht einmal die Eckbälle seien angekommen, Jimmy habe nicht und nicht getroffen, aber sie könnten immer noch, sie müssten Meister werden. Während er seufzte und seinen Penis einseifte, den er gründlicher als jeden anderen Körperteil wusch, machte er sich über das lange Elend lustig, das nicht in der Startelf gestanden, sich aber gebärdet habe, als wäre es Cristiano Ronaldo. Beim Aufwärmen sei das lange Elend wie ein Irrer die Seitenauslinie entlang gesprintet, habe Steffen bei jedem Eckball etwas ins Ohr geflüstert, obwohl er eigentlich auf der Ersatzbank gesessen sei. In der Pause sei das lange Elend einmal die Breitseite vor dem Fansektor hinauf- und hinuntergesprintet, habe dann im Stehenbleiben die Arme in die Höhe gerissen und auf Applaus gewartet – und zwei Minuten nach Wiederanpfiff ein Tor geköpft, das leider nicht gereicht habe. Während Julian noch einmal seinen Penis wusch, weil er vergessen zu haben schien, was er gerade getan hatte, fragte sie, was das mit ihm zu tun habe.
»Alles!«
»Du stehst nicht auf dem Feld, du bekommst nicht nur kein Geld dafür, du musst sogar zahlen – wenn du in einer anderen Stadt wärst, wärst du Anhänger einer anderen Mannschaft.«
Julian stellte das Wasser ab, griff nach einem Handtuch und stieg aus der Dusche. Der einmal weiße Boden war grau geworden, die Wände hatten einen Gelbstich bekommen. Er sah sie an, als wäre sie hinter dem Mond aufgewachsen und machte ein paar Schritte auf sie zu; während er sein Haar frottierte, bimmelte sein Penis vor ihr. Sie küsste ihn kurz, bevor sie sagte, er solle sich beeilen, sie falle um vor Hunger.
»Wenn die Grünen gut sind, habe ich das Gefühl, die Welt ist in Ordnung. Verstehst du?«
»Nein.«
»Dass es so ist, wie es sein sollte. Als ob die eigene Partei an der Macht wäre.«
Er drehte sich um, Pia klatschte ihm auf den Hintern, er blieb stehen und drehte sich zur Seite.
»Wenn dir eine auf die linke Backe schlägt, halt auch die rechte hin.«
Pia schlug zu.
6 »Sie sprechen von Schuld. Wie wäre es mit Angst?«
Kasimir zahlte, um zu reden. Er zahlte nicht, damit ihm zugehört werde. Er zahlte, um die Geschichten, die er bisweilen in geselliger Runde erzählte, einmal ehrlich erzählen zu können. Dabei war ehrlich nicht das richtige Wort, eher ungeschützt oder mit einem Fragezeichen anstatt des Punktes, zu dem alle nickten, anstatt des Rufzeichens, dem alle applaudierten. Hans hatte ihn in die Innere Stadt gefahren, Hans würde ihn in die Stadt und aufs Land und an den Fluss fahren, bis einer von ihnen tot war. Er solle nicht auf ihn warten, hatte ihm Kasimir beim Aussteigen zugerufen, Hans hatte die Brauen gehoben und durchaus richtig gehört, ja, heute habe er Lust zu schlendern. Er hatte kaum geschlafen. Er fühlte sich erfrischt.
Kasimir schritt zwischen den beiden barbusigen Karyatiden durchs Tor, er mochte den Hall seiner Absätze auf dem Marmor, vorbei an wohlgeformten Göttinnen und Helden die paar Stufen ins Parterre, groß, weit, herrschaftlich auch die sanft geschwungenen Treppen und die etwas zu entzückenden Schmiedeeisenarbeiten unter dem hölzernen Handlauf. Er rasierte sich jeden Freitagmorgen, zog jeden Freitagmorgen eine frische Hose, ein frisches Hemd, ein schönes Sakko und dazu passende Handschuhe an, er stand jeden Freitagmorgen noch etwas länger als üblich vor dem Spiegel, wenn er in die Innere Stadt fuhr.
Er lag auf der braunen Couch, die bloßen Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Augen geschlossen. Als er Freunde gebeten hatte, sich für ihn umzuhören, war es ihm um eine Couch zu tun gewesen, zum einen des Klischees wegen, zum anderen aber, weil er ohnehin tagelang vor Leinwänden und auf Leitern stand, weil er abendelang bei mehreren Gängen und schwerem Wein saß, und weil er beim Nachdenken am liebsten lag – oder ging. Vielleicht sollte er Frau Dr. König vorschlagen, einmal während eines Spaziergangs zu reden.
Er war an drei, vier Adressen gewesen, bevor er zum ersten Mal im Wartezimmer jener Frau gesessen war, die mittlerweile mehr über ihn wusste als irgendein anderer. Sie hatte die Tür geöffnet, ihn ins Zimmer gebeten und kurz auf seine Hände geblickt; anstandslos hatte er die Handschuhe ausgezogen, seine Rechte ausgestreckt und ihre zarte, weiche, etwas zu warme Hand geschüttelt. Obwohl ihm eine Freundin zu einem Mann geraten hatte, war in diesem Augenblick alles entschieden: Seine Hände vertrauten ihr.
Die Frau war nicht vom Zimmer, das Zimmer nicht von der Frau zu trennen, ein volles Bücherregal, ein breiter schwarzer Schreibtisch, hinter dem sie saß und auf dem ein Kugelschreiber neben ihrem Notizbuch lag, die dunkelgrüne Lampe auf dem Tischrand, die weiße Stehlampe neben der Couch – alles strahlte Kultur und Kultiviertheit aus. Dass er sie überdies attraktiv fand, war nicht das Unangenehmste.
Er öffnete die Augen und drehte den Kopf. Frau Dr. König saß aufrecht hinter ihrem Tisch, die gepflegten weißen Hände lagen entspannt übereinander. Sie hatte feingliedrige, wenn auch etwas fleischige Finger, Zeige-, Mittel- und Ringfinger waren beinahe gleich lang. Auf dem rechten Ringfinger steckte ein schmaler, schnörkelloser Silberring. Wer immer ihn ihr angesteckt hatte, musste ein glücklicher Mensch sein. Die blassrot lackierten Nägel ragten etwa fünf Millimeter über ihre Betten, die Brille lag wie immer griffbereit, das Notizbuch war aufgeschlagen, die Kugelschreibermine ausgefahren. Letzte Weihnachten hatte er ihr einen edlen Kugelschreiber geschenkt, sie hatte sich bedankt, ihm kurz zugenickt, führte aber weiterhin den Stift in ihrer Linken, den sie immer benutzt hatte. An der Wand hinter ihr hing ein schwarzweißer Franz Kline, über dessen Herkunft er sich wieder und wieder den Kopf zerbrach, ansonsten gab es keine Bilder, keine Ablenkung.
Frau Dr. König trug eine schwarze Stoffhose, eine weiße Bluse, ein enges schwarzes Sakko und schwarze Stilettos mit gemäßigten Absätzen. Sie sah wie eine Dame aus, die gern gut aß, eine weiße Serviette auf dem Schoß, gedämpfte Stimmen, gedämpftes Licht, dazu ein Glas Rotwein trank, vielleicht noch ein zweites, dann aber bei Wasser blieb, um vor dem Schlafengehen noch eine Stunde im Bett zu lesen. Das lange dunkelbraune Haar trug sie streng nach hinten gekämmt und auf dem Hinterkopf zusammengebunden, die einzige Exzentrizität, die sie sich leistete, waren vier weitere Haargummis in gleichmäßigen Abständen, die ihren Zopf in Abschnitte teilten, die er weder Wülste noch Würste nennen wollte. Sie brachten etwas Keckes in die Strenge.
Mirjam König blickte ihn abwartend an, nicht im Mindesten drängend. Sie sprach wenig, erklärte nichts, sie stellte nur unangenehme Fragen.
»Könnte es sein, dass Sie sich von den Betrunkenen ertappt fühlten?«
»Ertappt?«
»Dass Ihre Freiheit vielleicht nicht so frei ist, wie Sie denken. Oder anders: Dass es eine größere, wenn auch prekärere Freiheit gibt?«
Was wusste Frau Doktor König von Freiheit? Kasimir schätzte gerade die Biederkeit, die sie ausstrahlte; sie erlaubte ihm, das Gegenteil darunter zu vermuten. Er hatte, wenn überhaupt, Angst gehabt, die Penner mögen ihn mit Bier taufen oder ihm ins Gesicht rülpsen. Gleichzeitig war mit ihnen eine Möglichkeit aufgeblitzt. Er hatte den grauen Abend vor sich gesehen, das Silberbesteck, die beflissenen Kellnerinnen und Kellner, die Speisekarte auf Büttenpapier, in die er nicht blicken würde, Weißwein und Champagner in Kübeln mit Eis, die nur er Kübel nannte, seinen Galeristen Jonathan in maßgeschneidertem Anzug und genagelten Schuhen, den Sammler mit Gattin, einen Banker, vielleicht einen Industriellen oder zur Abwechslung einen Herzchirurgen, viel Geld, sehr viel Geld, möglicherweise weniger als er.
Vielleicht, hatte Kasimir gedacht, wäre es erträglicher, in dem Zustand, in dem der Säufer vor ihm stand, dieses Abendessen über sich ergehen zu lassen. Es war einerlei, ob er sich gut oder schlecht verhielt. Er war Künstler. Er genoss Narrenfreiheit. Sie wollten ein Bild kaufen und einmal in seiner Nähe sein, vielleicht ein Foto mit ihm machen, und vermutlich fänden sie es aufregender, wenn er sich gehen ließe, liefe ihnen ein angenehmer Schauer über die Rücken, wenn er auf den Tisch kletterte und irre lachend Champagner verspritzte.
»Sie erzählen gerade das, was Sie eben verneinten.«
Genau deswegen, und weil Jonathan ihn genervt hatte, hatte er sich dann doch wieder danebenbenommen, wie man sagte, und zwar so richtig. Der Kübel und das Eis hatten dabei nicht unwesentliche Rollen gespielt.
Am frühen Nachmittag kam Kasimir Ab ins Atelier. Er hatte seine Analytikerin nicht zu fragen gewagt, ob er ihre Hände fotografieren dürfe. Analytikerin klang besser als Therapeutin. Er brauchte keine Therapie, ironischerweise war sein Werk Therapie für Menschen mit vollgekritzelten Terminkalendern, Yoga für Geldsäcke, was Mirjam König ebenfalls abwertend nannte, sobald er sich darüber mokierte.
Er schickte Sophie und Antoine nach Hause, sie sollten ein ausgedehntes Wochenende lang tun und lassen, was sie wollten, sich seinethalben der Kunst widmen, wenn es unbedingt sein musste. Antoines Lächeln verriet Unglauben, Sophie hatte noch einige E-Mails zu beantworten, er verschwand auf die Terrasse, zog sich aus und sprang ins Wasser. Zwanzig Längen, mindestens, dann Liegestütze und Klimmzüge.
Seit er Lydia kannte, trieb er wieder Sport. Sie kam, wann sie Zeit und Lust hatte, sie kümmerte sich kein bisschen darum, ob er ein berühmter Künstler war oder nicht, genoss den Komfort, den sein Atelier und die riesige Dachterrasse boten, schien ansonsten aber in keiner Weise bestechlich. Manchmal schrieb er ihr, je nach Zustand, schmachtende oder äußerst explizite Nachrichten, für die er sich am nächsten Morgen keineswegs schämte, obwohl sie öfter unbeantwortet blieben, als ihm lieb war. Wenn sie ihm nach dem Sport Nacktfotos aus der Umkleidekabine schickte, fürchtete er den Tag, an dem nichts mehr von ihr käme. Er kannte schönere Frauen, er kannte verdorbenere, er kannte gebildetere und kultiviertere, aber er war Lydia verfallen. Nicht, dass er sie hätte heiraten wollen, aber wenn sie nicht antwortete oder nur knapp und ohne Berücksichtigung der Orthographie absagte, wenn er befürchtete, sie vielleicht nie wieder zu sehen, drehte sich etwas in ihm um.
Einmal die Woche ging Kasimir mittags in das Lokal, in dem sie arbeitete, wobei ihm war, als genieße auch Lydia, Kellnerin und Gast zu spielen. Er löffelte die Suppe, aß die Hauptspeise, überflog die Schlagzeilen, bestellte hinterher Espresso, wobei er jedes Mal aufs Neue um braunen Zucker bitten musste. Sie behandelte ihn wie jeden anderen Gast, vielleicht etwas kühler. Lydia stand mit beiden Beinen in einem Leben, das ihr selbstverständlich zu sein schien, weshalb er sich bisweilen wunderte, warum sie immer noch zu ihm kam. Während er abwechselnd Liegestütze und Klimmzüge machte, versuchte er, an Fünfhunderteuroscheine zu denken, über die er seit der langen letzten Nacht mehr wusste, als er jemals hatte wissen wollen. Die Lange Nacht der Fünfhunderteuroscheine. Aber das war nur so dahingedacht. Er hatte wissen wollen, was zu wissen war.
Oh, du wohlklingendes, liebliches, reizendes Summen!
Bevor Kasimir die Haustür öffnete, betrachtete er Lydia in Schwarzweiß, wie sie in engen Jeans auf der Straße stand, in einem Shirt, das ihren Nacken und die Schultern frei ließ, das lange blonde Haar am Hinterkopf zusammengebunden. Sie blickte nach links und nach rechts, als wüsste sie nicht, dass und wie er sie sah. Man konnte über Überwachung sagen, was man wollte. Aber erstens war die Außenwelt draußen zu halten, zweitens waren die Gemälde in seinem Atelier und im Arsenal horrende Summen wert, und drittens hatte die Kamera, deren Bilder er auf einem Flachbildschirm sah, einen Vorteil, der Goldes wert war: Er sah, ob er zu Hause sein wollte oder nicht.
In diesem Moment wollte er nichts lieber.
Er öffnete die Tür zu seinem Atelier und hörte den Aufzug nach unten fahren. Mit einem Ruck kehrte er zurück, die Tür ging auf, Kasimir verbeugte sich, ließ seine Rechte eine einladende und sanfte Welle beschreiben, ehe er Lydias Handrücken küsste, dessen Geruch er unter Hunderten erkannt hätte. Im Hintergrund lief Musik, er hatte Champagner in zwei Gläser gefüllt und ein wenig vorgekostet. Während des Anstoßens deutete er in Richtung Terrasse, sie schüttelte kurz den Kopf und deutete Richtung Couch.
»Ich bin wütend, mein Chef, dieser –«
Während Lydia abwinkte und Kasimir Platz nahm, stellte er sich vor, wie aufschlussreich eine DNA-Analyse seiner Couch wäre; was dabei zu Tage käme, wäre nicht weniger als sein wirkliches Leben, hätte sein Werk hundertmal sinnvoller erklärt als all die mehr oder weniger angestrengten Versuche im wechselnden Vokabular wechselnder Moden. Lydia kramte in ihrer Handtasche, entnahm ihr Zigaretten, Papier und eine kleine Dose, um flink und geschickt einen Joint zu drehen, den sie noch im Stehen anzündete. Sie sog den Rauch tief ein, ließ ihren Kopf im Nacken kreisen, ehe sie eine dichte Schwade in die Luft blies. Sie sah wie eine Hohepriesterin auf Urlaub aus.
»Zieh dich aus.«
Kasimir entledigte sich widerspruchslos seiner Kleider, Lydia kam auf ihn zu und betrachtete ihn. Er mochte ihre Blicke auf ihm, auch wenn er sie nicht immer zu deuten wusste und sie ihm bisweilen spöttisch erschienen.
»Hände hinters Genick. Man schaut mit den Augen, Herr Ab.«
Lydia stellte sich vor ihn, ihre langen Beine formten ein Dreieck über seinen nackten Oberschenkeln. Sie hielt ihm die makellos gedrehte Zigarette vor den Mund, Kasimir zog an, einmal, zweimal, dreimal. Wie gut ihre Hand roch, wie gerade ihre langen, dünnen Finger waren, die ihm den brauen Zucker so nachlässig auf den Tisch stellten. Ihre Handfläche war fein gemasert, die Lebenslinie lang und tief, an diesem Tag würde etwas Unerwartetes eintreten. Sie nahm die Zigarette wieder an sich, legte sie in den Aschenbecher auf dem Beistelltisch, nippte am Champagner, strich ihm über die Lippen und steckte ihm den linken Zeigefinger in den Mund, an dem er lutschte, bis sie ihn zurückzog und wortlos verschwand.
Kasimir griff nach dem Joint, zog gemächlich an, stieß den Rauch aus den Nasenlöchern, angenehme Verlangsamung, genauerer Blick, geneigtes Ohr, gesteigertes Verlangen. »Wir hören besser«, hatte Peter Ost gesagt und Kasimirs Wangen geküsst, als sie jung und bekifft in Clubs gegangen waren und sich durch die Nächte hatten treiben lassen. Heute hätte man Peter Ost ohne weiteres zwischen die Penner setzen können; den Tetrapack hätte er abgelehnt, beim Fusel nur kurz gezögert. Ein, zwei Mal im Jahr besuchte Kasimir seinen alten Freund in einem Atelier, das längst nur noch ein potemkinsches Dorf war, und soff mit ihm, bis Hans kam, um seinen abgefüllten Arbeitgeber nach Hause zu fahren. Nach der zweiten Flasche Wein begannen Peters Augen zu blitzen wie früher, nach der dritten war er wieder der Künstler, der er einmal hatte sein wollen und hätte sein können, aber nach der Hälfte der ersten Flasche Whiskey sackte er ab in Selbstmitleid, und alle waren schuld an seiner Misere, die ganze Welt, vor allem sein Vater, der seit sieben Jahren tot war.
Daran wollte Kasimir jetzt nicht denken. Der Abdruck von Lydias Lippen auf dem Glas zog ihn in seinen Bann, er hatte noch den Geschmack ihrer Finger im Mund, Pergolesis Stabat Mater hüllte ihn ein, das Licht fiel schräg auf die Couch. Als er Schritte aus dem Bad kommen hörte, tauschte er den Joint gegen das Glas.
Der Autor dankt dem Deutschen Literaturfonds e. V., der Bowling Green State University – und allen, die an dieser Geschichte beteiligt waren. Vor allem Kasu.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2016 Clemens Berger
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstraße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | München
Covermotiv: © Ruth Botzenhardt
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-20254-5V004
www.luchterhand-literaturverlag.de
Bitte besuchen Sie unseren LiteraturBlog
www.transatlantik.de