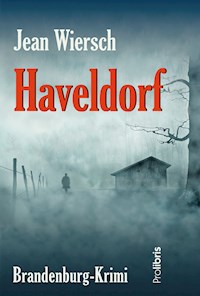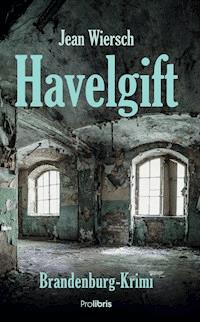Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Ein Graffiti auf riesengroßer Leinwand am Dom zu Brandenburg zeigt den Polizeipräsidenten in wenig freundlicher Pose. Doch aus einem harmlosen Streich Jugendlicher wird schnell Ernst, als man einen der Sprayer tot auffindet. Kommissar Manzetti soll den Mord aufklären - und stellt entsetzt fest, dass seine eigene Tochter zu der Graffiti-Crew gehört. Als der heißblütige Manzetti vom Dienst suspendiert wird, nimmt er eigene Ermittlungen auf. Dabei unterstützen ihn ein begnadeter Computerhacker und ein ehrgeiziger Journalist. Vor allem aber der Rechtsmediziner Bremer erweist sich als hilfreicher Freund. Konfrontiert mit den brutalen Methoden skrupelloser Verbrecher einerseits und den Geisterbeschwörungen seiner italienischen Mamma andererseits, versucht Manzetti, seine Tochter Lara vor einer tödlichen Gefahr zu retten. Havelgeister ist nach Havelwasser, Havelsymphonie und Haveljagd der vierte Kriminalroman des Brandenburger Polizeibeamten und Autors Jean Wiersch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Wiersch
Havelgeister
Brandenburg Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Endlich. Die Nacht hatte ihren gewohnten Platz eingenommen und über die Stadt den Mantel aus profunder Dunkelheit gespannt. Nicht einmal der Mond erhellte zu dieser Stunde die Straßen, er steckte hinter einer undurchdringlichen Wolkenwand fest. Somit fiel kaum Licht durch die Fenster des gotischen Hochchores, das Innere der Mutter aller märkischen Kirchen war nur zu ahnen.
Nepomuk Böttger setzte zögerlich einen Fuß aus seinem Versteck, dem schmalen Holzschrank, in dem gewöhnlich die Gesangbücher aufbewahrt werden, und streckte dann, als er wieder die volle Bewegungsfreiheit hatte, den Körper wie eine Katze, die sich nach stundenlangem Schlaf vom Sessel erhebt. Auch er musste erst einmal die Wartezeit in dem engen Verschlag aus den Knochen schütteln. Mit der rechten Hand griff sich der Junge an die linke Brust. Sein Herz. Es machte bei plötzlich einsetzenden Anstrengungen nach längerer Pause immer mal wieder Ärger. So wie jetzt, da es ein wenig zu stechen begann.
Als der leichte Schwindel verflogen war, machte er die ersten Schritte, streng darauf bedacht, auf dem kalten Steinfußboden möglichst kein Geräusch zu verursachen, das in den Gewölben der Kirche laut hallen würde. Er vertraute den weichen Gummisohlen der neuen Turnschuhe.
Nach wenigen Metern streckte Nepomuk beide Arme vor und tastete nach einer Rückenlehne der letzten Stuhlreihe. Von da an, war er sich sicher, würde er sich orientieren können. Es würde die schlafwandlerische Sicherheit einsetzen, die er durch wiederholte Betrachtungen des Lageplans und ein gutes Dutzend Erkundungsbesuche in der Kirche gewonnen hatte. Auf seinen Kopf konnte Nepomuk sich stets verlassen, kein Wunder bei einem errechneten IQ von 132.
Aber das allein würde für die heutige Mission nicht reichen. Für den großen Clou musste er auch die anderen im Griff behalten, und die scheiterten ohne Taschenrechner schon an der Wurzel aus neun.
Er tastete sich weiter voran und kam schließlich zum letzten Stuhl der Reihe. Da war er endlich, der Mittelgang, der direkt zum Altar führte. In den letzten Wochen hatte er hier während seiner Ausspähunternehmungen mehrere Male gestanden, allerdings immer umringt von anderen Besuchern des Doms St. Peter und Paul und immer bei Tageslicht. Und immer war sein Blick nach oben gewandert, dahin, wo das grandiose Instrument stand.
Die alte Wagnerorgel.
Tief sog er die muffige Luft der Kirche ein und schloss die Augen. Er versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, was die Dunkelheit um ihn herum verschluckte. Bei Tageslicht waren die Figuren von Peter und Paul in der schwungvollen Fassade der Orgel ebenso wie der preußische Adler in ihrem reichen Schnitzwerk gut zu sehen. Doch jetzt konnte er davon nichts mehr erkennen.
»Pssst, Nepo, können wir kommen?«
Es war Kevin, einer der Jungen, die Nepomuk für seinen großen Coup rekrutiert hatte. Er lugte müde aus dem zweiten Holzschrank.
»Ja«, gestattete Nepomuk. »Aber seid leise und lasst die Lampen noch aus.«
Er hatte im Treckingladen in der Steinstraße fünf Stirnlampen gekauft und jedem Crewmitglied eine in die Hand gedrückt, als sie sich gegen zwanzig Uhr an der Näthewindebrücke getroffen hatten, von wo aus sie zum Dom gegangen waren. Dort hatten sie nur knapp zehn Minuten warten müssen, dann hatte sich die Dame, die ansonsten den ganzen Tag hinter einem Tisch mit Büchern und CD zubrachte, erhoben und war zu ihrer Kollegin ins Dommuseum verschwunden. Ihre Abwesenheit hatten die Jungen sofort genutzt und sich in die beiden Schränke gedrückt.
Kevin und die anderen drei standen jetzt direkt neben Nepomuk. Er konnte sie sogar riechen.
»Habt ihr die Uhren dabei?« Auch die waren eine Anschaffung für die heutige Nacht.
»Ja, haben wir«, kam es unisono aus drei Mündern.
»Still!«, herrschte Nepomuk seine Crew an, die ihm nach seinem Empfinden etwas zu laut geantwortet hatten. »Wir dürfen möglichst keine Geräusche machen, eigentlich auch nicht sprechen.«
»Okay«, flüsterte Kevin. »Aber eine Frage habe ich noch.«
»Und welche?«
»Wenn wir fertig sind und noch ein bisschen Zeit haben, können wir nicht doch …«
»Nein.«
»Aber …«
»Nein, habe ich gesagt«, zischte Nepomuk unwirsch. »Wir sind keine gemeinen Ganoven, die sich an Kunstschätzen vergreifen. Ist das klar?«
Es blieb still, niemand übte Widerspruch.
»Und deshalb treffen wir uns nach dem Abseilen wie verabredet hinten an der Brücke über den Domstreng. Dafür hat jeder nur fünf Minuten Zeit. Vergesst das nicht.«
»Aber Kevin hat doch Recht«, warf Lucas ein. »Im Dommuseum liegt genug Zeugs, das wir prima unter die Leute bringen können.«
»Nein, habe ich gesagt, und dabei bleibt es. Das Dommuseum ist alarmgesichert, und ehe wir da wieder raus sind, haben die Bullen uns am Arsch. Dafür gibt es dann kein Du, Du mehr vom Staatsanwalt, sondern mehrere Jahre Knast. Also, fünf Minuten nach dem Abseilen hinter der Mauer an der Brücke zum großen Parkplatz.«
Lucas war mit der Antwort nicht zufrieden. Er wagte einen letzten Versuch. »Können wir nicht mal die große Truhe aufmachen?«, fragte er.
Nepomuk schlug sich vor lauter Verzweiflung gegen die Stirn. So viel Blödheit konnte es doch auch in der Unterschicht nicht geben. »Ich habe euch ein Dutzend Mal erklärt, dass der Giebelschrein leer ist und nur noch da oben im Chor steht, um von den Leuten bewundert zu werden. Früher, vor sechshundert Jahren, diente er der Aufbewahrung liturgischer Gewänder. Früher, heute nicht mehr.«
Auch wenn seine Jungs bestimmt nicht wussten, was liturgische Gewänder waren, hatten sie instinktiv begriffen, dass sich hinter dem unaussprechlichen Wort ein einfacher deutscher Begriff verbarg, nämlich kostbar, was so viel hieß wie teuer.
Bis auf Kevin, mit dem er schon im Kindergarten über den Rasen gerannt war, hatte Nepomuk die Jungen erst vor gut einem halben Jahr kennengelernt. Sie hatten sich an der Wand getroffen, ihrem Übungsareal, das direkt hinter einem Teppichbodenmarkt lag. Kein schlechter Ort, denn da waren sie vor dem Zugriff der Polizei sicher. Und das war wichtig, denn die Bullen hatten ihre Aktivitäten seit einiger Zeit massiv verstärkt, waren ihnen bedenklich nahegekommen.
Und da Nepomuk es immer wieder verstanden hatte, die Polizei ins Leere laufen zu lassen, hatten die Jungen schnell erkannt, dass in ihm das Zeug zum Anführer steckte. Sie also dank seiner grandiosen Pläne ganz groß rauskommen konnten, ohne immer wieder in der Polizeiwache zu landen. An Nepos Seite wollten sie ungetrübten Ruhm, Anerkennung und Respekt in der Szene genießen.
»Los jetzt«, zischte er. »Haltet die Hand so hinter den Rücken, dass der Hintermann das leuchtende Ziffernblatt sehen kann, das muss ausreichen, um euch zu orientieren. Und dann folgt mir.«
Nepomuk drehte sich um und ging behutsam den Mittelgang entlang. Vor dem Altar bog er nach links ab, betrat ganz vorsichtig die steinernen, abwärts führenden Stufen und zuckte immer dann zusammen, wenn einer der Jungen mit der Hüfte gegen einen Stuhl stieß oder etwas anderes zum Wackeln brachte. Blödheit war nun mal nicht therapierbar.
Endlich wurde es etwas heller und ihre Schritte sicherer. Der Mond hatte sich durch ein kleines Wolkenloch gekämpft und beschien einen Winkel des Kreuzganges mit kaltem Licht. Wenig später, als sie den Kreuzgang passiert und den kleinen Innenhof erreicht hatten, sahen sie schließlich die Fenster der evangelischen Domgrundschule, neben der die Räume der alten Ritterakademie lagen.
Nepomuk blieb stehen. Tiefe Ehrfurcht ergriff ihn. Dort oben, hinter den Fenstern der Akademie, hatte jede Fußbodendiele abenteuerliche Geschichten zu erzählen. Geschichten aus der Kindheit und Jugend von Männern, die später preußische Geschichte schreiben sollten. Etwa von Leopold, Fürst von Anhalt-Köthen, der später zu einem Förderer von Johann Sebastian Bach geworden war, oder von Friedrich Eberhard von Rochow, Junker und Pädagoge, oder auch von Otto Graf Lambsdorff. Sie alle hatten die 1704 gestiftete Ritterschule besucht, die dem Zwecke der Ausbildung und Erziehung des preußischen und pommerschen Adels diente.
Nepomuk hob die Hand über den Kopf. Dann spähte er in den Innenhof und lauschte in die Stille. Die Luft schien rein. Der Wachmann würde frühestens in zwei Stunden wiederkommen und nichts anderes vorfinden, als gestern, vorgestern und in der letzten Woche. Auf Nepomuk und seine Crew würde nicht einmal ein achtlos weggeworfener Zigarettenstummel hindeuten.
»Die Seile«, forderte er und sah in das vom Mond schwach beschienene Gesicht von Lucas.
»Hier«, sagte der und ließ den Rucksack über die Schulter rutschen.
»Gut«, kam es von Nepomuk, der seinerseits den Rucksack auf den Boden gestellt hatte und bereits damit beschäftigt war, die Armbrust zusammenzubauen. Damit wollte er die Widerhaken abschießen, an denen die dünnen, extrem reißfesten Synthetikseile befestigt waren, an denen er mit Kevin hochzuklettern gedachte.
»Wenn wir das Dach erreicht haben«, sagte er, »fangt ihr sofort an, die Laken miteinander zu verbinden. Und vergesst nicht, ganz unten die Teleskopstange einzufädeln. Noch Fragen?«
Die Jungen schüttelten den Kopf.
»Dann los. Kevin, bist du so weit?«
Kevin, der sich die genoppten, schwarzen Handschuhe bereits angezogen hatte, hob die Hand, woraufhin Nepomuk die Armbrust in die Schulter zog und den Abzug nach hinten drückte. Sirrend flog der erste Pfeil auf das Dach des Doms zu Brandenburg an der Havel.
2
Die Toskana hatte aus Andrea Manzetti einen Müßiggänger gemacht. Und das in kürzester Zeit sowie mit einfachsten Mitteln. Hoch über seinem Geburtsort San Gimignano schien nämlich auch im Winter die Sonne so intensiv, dass er auf dem Landgut seiner Mutter in einer Januarwoche mehr Sonnenstunden zählen konnte, als ihm das gewöhnlich während eines kompletten Wintermonats in Brandenburg gelang. Und dazu trockenen Rotwein vom Gut des Onkels. Was wollte die verwöhnte Seele mehr?
Trotzdem war für Manzetti irgendwann der Tag gekommen, an dem sich so etwas wie Heimweh in seinem Herzen einnistete. Da war ihm die Leuchtkraft des strahlenden Himmelskörpers nicht mehr genug. Zum ganz großen Glück bedurfte es doch etwas mehr als Sonnenschein. Und so landeten sie schließlich im Juni wieder da, wo sie vor zehn Monaten abgefahren waren. In ihrer geliebten Mark Brandenburg.
Die Frage, ob sie für immer in Italien bleiben oder doch zurückkehren sollten, hatte sich in den Wochen nach Ostern immer häufiger gestellt. Das lag nicht an etwaigen Sprachproblemen, denn beide Töchter waren, seit sie den Mund nicht mehr halten konnten, zweisprachig aufgewachsen. Und Kerstin Manzetti galt per se als Sprachtalent. Ihr genügten in aller Regel fünf Minuten des Zuhörens, um sich anschließend in jeder nur denkbaren Sprache der Welt mit einer Schuhverkäuferin unterhalten zu können.
Aber die alte Signora Manzetti war nun mal keine Schuhverkäuferin, sondern eine richtige italienische Mamma, und als solche hatte sie von der ersten Minute an zwischen Sohn und Schwiegertochter gestanden. So war Kerstins Unwohlsein schließlich ausschlaggebend gewesen, ihr konstanter Wille, sich aus der erdrückenden Umarmung der Schwiegermutter zu befreien.
Nun saß Manzetti seit drei Monaten wieder am Beetzsee und begann erneut, diesen Landstrich zu lieben. Das Wechselspiel zwischen hoch fliegenden Lerchen und Graugänsen, zwischen unglaublich schönen Seen und ausgedehnten Nadelwäldern. Alles erfreute ihn bis in den letzten Winkel seines Körpers. Ein Fleckchen Erde, an dem die Seele beruhigt baumeln durfte.
Tief atmete er die klare Luft ein und schaute auf den See hinaus. An nichts wollte er momentan denken, nur unbeschwert lustwandeln, eine Hand in der Hosentasche, die andere um die warme Kaffeetasse gelegt. Seine Frau und die Töchter hatten ihn bereits vor knapp zwei Stunden verlassen, waren in die Stadt gefahren, um dort ihren täglichen Aufgaben nachzugehen. Er dagegen fühlte sich wie ein Vagabund auf einem etwas zu groß geratenen Grundstück.
Er sah auf den wackelnden Hintern von Julius Cäsar, dem er brav folgte. Julius, wie Manzetti den getigerten Kater knapp nannte, war eine ganz spezielle Katze. In einem italienischen Palazzo groß geworden, glaubte er sich allen anderen Lebewesen auf eine gewisse Art und Weise überlegen. Er war ein attraktives Tier, das war überhaupt keine Frage, und er hatte sogar diesen italienischen Augenaufschlag. Aber in dem märkischen Dorf am Ufer des Beetzsees war ihm seine spätrömische Arroganz im Weg. Manzetti tat sich lange schwer damit, zu begreifen, warum Julius sich so anstellte.
Auch die Kätzchen im Dorf waren aus Katersicht doch wohl kaum zu verachten. Vielleicht etwas fülliger als in der Toskana, aber nicht minder hübsch. Manzetti hatte gehofft, Julius stünde auf etwas rundere Formen, aber immer, wenn er ihn darauf ansprach, wandte sich der Kater beleidigt ab. Mit einem Blick, wie nur er ihn auflegen konnte, schlüpfte Julius anschließend durch die Hecke auf die benachbarte Pferdekoppel.
»Geh doch!«, rief Manzetti ihm dann voller Verachtung hinterher, allerdings erst, wenn er sich sicher sein konnte, dass Julius ihn nicht mehr hörte.
Auch jetzt zwängte der Kater seinen Körper zwischen Ginsterbusch und Zaun hindurch, entschwand Manzettis langweiliger Gegenwart und überließ Paul Gerhardt das Feld.
»Morgen, Nachbar«, rief Paul bereits über den Gartenzaun.
Manzetti zuckte zusammen. In ihm machte sich die Ahnung von dem breit, was nun kommen würde, und er verdammte Julius mit einem Vokabular, das er lieber nicht laut aussprach.
Der Pferdebesitzer Paul war nicht nur der liebste Freund der Manzettitöchter, sondern auch Binnenschiffer in Rente. Und somit hatte er viel Zeit für ein Leben, das auch jetzt noch nicht stillstehen wollte.
»Es muss immer alles im Fluss sein«, behauptete Paul ständig. Schließlich hatten er und sein Schiff auch selten vor Anker gelegen.
»Na, schon wieder nichts zu tun?«, fragte Paul nun und lüftete seine speckige Schiffermütze, die er sogar im Hochsommer trug.
Manzetti erkannte sofort, dass hier nicht einfach eine Frage gestellt wurde. Es handelte sich vielmehr um einen feinen Vorwurf, und Paul beugte sich über den Gartenzaun, um die Nachbarschaft auf den rechten Pfad der Tugend zu bringen.
»Paul, ich habe genug zu tun«, bemühte Manzetti sich um eine erste, vorsichtige Verteidigung. »Ich muss gleich zum Dienst und war nur mit Julius noch eine kurze Runde durch den Garten unterwegs.«
Am Zaun reichte Manzetti Paul die Hand, doch dessen raue Pranke griff sogleich nach der Kaffeetasse. Nur Sekundenbruchteile später verschwand die riesige, grobporige Nase in dem blauen Tongefäß.
»Wenigstens Kaffee machen könnt ihr Italiener ja«, lobte Paul und ließ die letzten Tropfen des Latte macchiato in das feuchte Gras fallen.
»Ich bin nicht nur Italiener, Paul, sondern auch Deutscher«, erklärte Manzetti seine Herkunft bestimmt zum hundertsten Mal, obwohl er wusste, dass Paul es wieder nicht begreifen würde.
»Das geht nicht, Nachbar«, konterte er auch schon und vermied dabei wie immer, Manzetti bei dessen italienischem Vornamen zu nennen. Für Paul hatten Menschen, die Andrea hießen, große Brüste und trugen Röcke.
»Man muss sich im Leben immer entscheiden, Nachbar«, philosophierte er auf seine bäuerliche Art. »Für wen willst du denn die Fahne schwenken, wenn unsere Jungs im Endspiel auf die Italiener treffen?«
Manzetti ließ die Frage unbeantwortet, was seinem großen Erfahrungsschatz beim Umgang mit Nachbar Paul entsprang. Der war ein Mensch, der sich nur mit zwei Dingen auskannte. Der Schifffahrt und Fußball. Und Manzetti hatte weder auf das eine noch das andere Thema Lust.
Zum Glück reichte Paul ihm die leere Tasse zurück.
»Du kommst zur rechten Zeit, Nachbar. Ich brauche nämlich deine Hilfe.«
»Paul«, nörgelte Manzetti. »Ich habe wirklich keine Zeit. In spätestens einer Stunde muss ich in der Direktion sein und vorher will ich noch duschen.«
Aber Paul kannte keine Gnade mit der Morgenhygiene von Polizeibeamten.
»Nur einen Moment«, knurrte er. »Komm mal rüber.«
Der Umstand, dass Paul bereits die beiden Latten auseinander schob, die nur oben mit einem Nagel gehalten wurden und damit unten ein großes Durchschlupfloch schufen, sagte Manzetti, dass er seine letzte Hoffnung endgültig begraben konnte.
»Nur kurz, Nachbar«, betonte Paul noch einmal und schloss hinter Manzetti wieder die Lücke im Bretterzaun.
»Was ist denn?«, jammerte der Hauptkommissar. »Ich schieb dir nicht schon wieder die Mülltonnen auf die Straße. Das kannst du nämlich allein, wie jeder andere im Dorf auch. Dafür haben die Dinger nämlich Rollen.«
Paul warf sich ein halbes Dutzend Sonnenblumenkerne in den Mund und sah Manzetti an, als glaubte er, dass sich zwischen den Ohren von Stadtmenschen nur luftleerer Raum befände. Und Stadtmenschen würden die Manzettis für ihn bleiben, bis die zweite Generation der Familie auf den Friedhof gebracht war.
»Nachbar«, raunte Paul mit seinem dröhnenden Bass. »Ich habe die Mülltonnen schon längst rausgebracht. Aber ich komme an das Gold nicht ran.«
War Paul jetzt übergeschnappt? »Was redest du da von Gold? Ich habe wirklich keine Zeit für deinen Blödsinn.«
»Komm doch nur mal kurz.« Paul ließ nicht locker und zerrte an Manzetti herum, wie es sonst nur seine kleine Tochter Paola tat. Die übrigens konnte mit Paul in Augenhöhe reden, denn beide reichten dem Hauptkommissar der hiesigen Polizeidirektion nur bis zum Brustbein. Das hielt Paul allerdings nicht davon ab, den einsfünfundachtzig großen Manzetti bis zum Birnbaum zu zerren, unter dem bereits drei volle Körbe aus dem hohen Gras guckten.
Manzetti setzte zu einem letzten Versuch an. »Kannst du nicht nachher meine Töchter fragen, ob sie dir helfen?«
»Kann ich«, entgegnete Paul und spuckte die Schalen der Sonnenblumenkerne ins Gras. »Aber wenn ich warte, bis sie hier auftauchen, haben sich die Wespen schon die ganze Ernte geholt. Und das kann ich mir nicht erlauben. Also komm, ich reiche da oben nicht ran.« Paul zeigte in die Krone des Baumes, in die er bereits eine blitzende Metallleiter geschoben hatte. »Mach du das mal, Nachbar. Du bist noch jung und hast eine viel größere Reichweite als ich.«
»Paul, kann das nicht wirklich bis heute Nachmittag warten?«
Das konnte es offenbar nicht. Paul drückte Manzetti seine Faust in den Rücken und bugsierte ihn sanft an den Stamm des Baumes.
»Kriege ich wenigstens welche ab?«, fragte er und stellte seine leere Tasse an das Vorderrad des Handwagens, mit dem Paul Gerhardt wohl gedachte, die Ernte des Tages zur Mosterei zu ziehen.
»Ja, ja. Aber jetzt erntest du erst mal den Baum ab. Und wirf die Birnen nicht so. Die kriegen sonst Druckstellen.«
Gut eine Stunde später hatte Manzetti fast vier Säcke voller Birnen vom Baum geholt und jedes Mal ein freundliches Lächeln mitgeerntet. Am Ende der Arbeit zeigte sich der alte Ganove für seine Verhältnisse dann sogar recht großzügig und drückte Manzetti zwei mittelgroße Birnen in die Hand.
»Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Zwei Birnen für eine Stunde Schufterei?«
»Nachbar, ich will doch nicht, dass du dir den Magen verdirbst.«
Aus Mangel an Schlagfertigkeit ließ Manzetti die Bemerkung so stehen und war froh, wieder durch den Bretterzaun schlüpfen zu können. Als er seinen Rücken gerade wieder durchbog, erkannte er hinter den grünen Zweigen der Tannen bereits den nächsten Störenfried. Vor dem Grundstück bremste ein dunkelblauer Passat und erzeugte dabei eine riesige Staubwolke. Das Kennzeichen wies den Wagen als ziviles Polizeifahrzeug aus, am Steuer saß Sonja Brinkmann, seine Assistentin.
»Auch wenn du es hier am Beetzsee wunderschön hast, in der Stadt wartet Arbeit«, rief Sonja über das Wagendach und warf schwungvoll die Tür zu. »Wir müssen sofort los, der Alte tobt schon.«
Mit dem Alten meinte sie in aller Regel Polizeidirektor Ole Claasen. Manzetti sah auf die Uhr, es war gerade halb neun.
»Was hat ihm denn den Morgen verhagelt?«
»Eigentlich nichts«, sagte Sonja.
Manzetti wusste, dass nichts bei Sonja nicht das Gleiche war wie bei ihm. Für nichts hätte Claasen sie nicht nach Ketzür geschickt, um ihn persönlich abzuholen.
»Na gut«, sagte er. »Für nichts müssen wir uns ja nicht so beeilen. Ich gehe dann erst mal unter die Dusche und danach trinken wir noch einen Kaffee zusammen.«
»Andrea, er hat ausdrücklich gesagt: Sofort!«
»Aber wegen nichts?«
»Nun stell dich doch nicht so an und dreh mir nicht schon jetzt jedes Wort im Mund herum.«
»Das mach ich doch gar nicht. Du sollst nur einfach die Fakten benennen. Über deine Einschätzung der Dinge können wir uns dann später unterhalten … Also, wie dringend ist es wirklich?«
»Sehr«, behauptete Sonja, kam um den Passat herum und öffnete die Beifahrertür. »Am Dom hat sich schon die komplette Presse versammelt. Der Alte soll bereits schreien.«
Manzetti zuckte mit den Schultern. »Dann müssen wir wohl«, sagte er und drehte sein linkes Ohr der Ortschaft Lünow zu. »Ist der für uns?«
»Wer?«
»Der Habicht.«
Dann hörte auch sie das schneidende Geräusch eines schnell heranfliegenden Hubschraubers.
»Jupp«, sagte sie. »Der ist für uns. Komm, wir sollten nicht lange nach Claasen am Dom sein.«
3
Wie ein Geist huschte Kevin über die groben Betonplatten, aus denen man einheitsgrau den Gehweg gelegt hatte. Das Gesicht dabei immer dem Boden zugewandt. Nepomuk hatte ihm erzählt, dass sie hochauflösende Kameras an Bord hatten, mit denen sich aus jeder Höhe seine Wimpern zählen ließen. Scheißbullen.
Als er endlich die rettende Haustür erreichte und die quietschend nach innen pendelte, zog er die Kapuze zurück und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand. Geschafft. Hier drinnen dürften sie ihn nicht mehr finden, selbst mit ihrem Kackhubschrauber nicht. Er hielt die zurückpendelnde Tür mit der Schuhspitze auf und lugte durch den handbreiten Spalt.
Da könnt ihr lange suchen, raunte er der Hubschrauberbesatzung zu, die über der Innenstadt noch eine Runde gedreht hatte und jetzt ihren Helikopter in etwa einhundert Metern Höhe einfach anhielt, als wäre da oben eine Bordsteinkante.
Er zog den Fuß zurück und hetzte die vier Stockwerke hoch. Oben schloss er die zerschrammte Tür mit dem Namensschild »Schuster« auf und verschwand sogleich in sein Zimmer, das er sich mit einer schwarz-weißen Ratte und einigen Guppys teilte, die sich in einem großen Wasserglas tummelten. Hier war er sicher und noch bevor er ausgiebig über die letzte Nacht nachdenken konnte, fielen ihm die Augen zu.
Mit der Gewissheit, einen verdammt guten Job gemacht zu haben, schlief er seelenruhig ein.
Auch wenn Nepo nicht an der verabredeten Brücke erschienen war, musste er sich keine Sorgen machen. Ihr Crewchef war clever – viel cleverer als alle anderen Jungen in der Stadt und viel cleverer als die blöden Bullen.
4
Die Sonne blitzte vom spätsommerlichen Himmel auf die Dominsel und knallte Henry Wegmann direkt in die Pupille. Scheißdreck, dachte er und tastete seine Jackentaschen nach einer Sonnenbrille ab. Vergebens, wie er feststellen musste. Sie lag bestimmt noch auf seinem Schreibtisch, wie auch der Fotoapparat und die DJ-Ötzi-Mütze, ohne die er normalerweise das Redaktionsgebäude am Neustädtischen Markt nicht verließ.
Aber was war schon normal an diesem Morgen?
Der Chefredakteur hatte alles rausgejagt, was laufen konnte. Und so war Wegmann zum Dom gerannt, während die anderen beiden Reporter ihre Kontakte abklapperten, einer in Richtung Nord und der andere in Hohenstücken.
»Ich will die absolute Story und ich will sie als Erster«, hatte Riethmüller gebrüllt und der Mann meinte das auch so. »Bringt mir die Hammergeschichte oder ihr könnt euch gleich einen anderen Job suchen, ihr faulen Säcke.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!