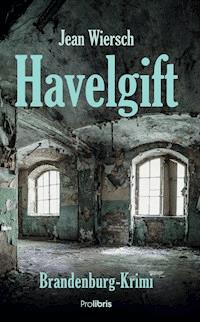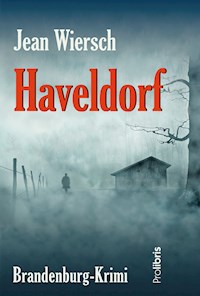Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Jean Wiersch
Havelgift
Brandenburg-Krimi
Prolibris Verlag
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden. Auch die Figuren entstammen seiner
Phantasie. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2017
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelfoto von Wendelin Jacober
Beelitz, creativecommons
flickr.com/photos/wendelinjacober/33382299761/in/datetaken/
Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Bildausschnitt aus einem Querformat
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-158-7
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-148-8
www.prolibris-verlag.de
Prolog
Februar 1951
Später werden die Erwachsenen fragen, wie es ihnen ergangen sei an diesem frostigen
Wintertag, und Berni wird stets sagen: »Na, wie schon, gut eben.« Wie man sich halt fühlt, wenn man ein märkisches Kindlein ist, und keines aus einer großen vornehmen Stadt. Klirrende Kälte oder sengende Hitze, man nimmt es, wie es kommt. Hier in der Mark
Brandenburg ist man bodenständig, wie Vater und Großvater es waren. Man verspürte nicht einmal den Drang, ins Nachbardorf zu fahren. Was sollte man da auch?
Und in eine andere Gegend, vielleicht in ein fernes Land, musste man schon
gleich gar nicht.
Und die Kindlein? Sie hatten auf dem Hof alles, was sie brauchten. Wirklich
alles. Sie hatten sogar Schnee in diesem Winter, viel Schnee, eiskalten Schnee.
Die Erwachsenen sprachen gar von einer Katastrophe: Der ganze Schnee, wo soll
man damit nur hin?
Aber die Kindlein störten sich daran nicht. Sie waren begeistert von der weißen Pracht. Kam der Schnee, dann war es nicht mehr weit bis zu dem einfach nur
wunderbaren Schlachtefest.
Darauf freuten sich die Kindlein schon lange. Würden doch zu diesem Fest viele Verwandte anreisen, mit all ihren warmen
Umarmungen und vielleicht sogar mit Geschenken. Die Vorfreude war fast so groß wie an Weihnachten.
Und weil es in wenigen Minuten losgehen würde, hatten sich die Kindlein klammheimlich aus dem Haus geschlichen. Sie
wollten sich, auch wenn es eigentlich verboten war, in der Scheune umtun. Die
war der Abenteuerspielplatz schlechthin auf einem Bauernhof. Eine riesige
Dreschmaschine stand darin und eine alte Kutsche, an der Wand lehnten unzählige Holzmollen. Und über den lehmigen Scheunenboden hatte der Großvater Bleche gebreitet, damit das Gemisch aus Blut und warmem Wasser den
Lehmboden der Tenne nicht in eine Schlammwüste verwandelte.
Beim Schlachten hätten die Kinder nichts zu suchen, sagte die Großmutter immer. Deshalb war es ihnen streng verboten, an diesem Tag die Scheune zu
betreten. Und die Kindlein wussten, dass es mehr als Schelte geben würde, ließe sich eines von ihnen vom Großvater erwischen oder von einem der anderen Männer, die extra zum Schlachten gekommen waren.
Aber die Verlockung des Verbotenen versprühte jenen unwiderstehlichen Reiz, dem sich niemand entziehen kann. Auch kleine
Kinder nicht. Und so waren ihre Ohren gespitzt wie die einer Maus in Großmutters Vorratskammer.
Kaum hatten sie das Scheunentor hinter sich zugezogen, drangen vom Hof her die
ersten Stimmen zu ihnen hinein. Männer kamen aus dem Haus und stapften durch den Gang, den der Großvater schon am gestrigen Abend in den hüfthohen Schnee geschoben hatte. Es knirschte unter ihren schweren Stiefeln. Und
aus der Richtung ihrer Schritte folgerten die Kindlein, dass die Männer zum Schweinestall unterwegs waren. Dort würden sie der Sau eine Schlinge um einen Hinterlauf legen, um sie dann gemächlich zur Scheune zu führen. Ganz ohne Stress. So wie es der Großvater eingefordert hatte, denn sonst schmecke das Fleisch nicht.
Schnell kletterten die Kindlein auf die Leiter zum Heu– und von dort noch höher in den Strohboden, wo sie sich hinter einem riesigen Ballen versteckten. Und
das war allerhöchste Zeit, weil in diesem Augenblick auch schon einer der Männer das Scheunentor aufzog. Die Spannung stieg, war kaum mehr auszuhalten.
Gleich würden sie die Sau hereinführen, sie mit dem anderen Ende der Schlinge an einem eigens dafür in die Zwischenwand geschlagenen Haken festbinden. Und dann? Dann würde einer der Männer das Bolzenschussgerät ansetzen. Mittig auf der Stirn der nichts ahnenden Sau. Und genau das sollte
nach dem Willen der Großmutter vor den Kinderaugen verborgen bleiben. Denn töten, so meinten fast alle, war nichts für Kinder. Töten war ein Akt der Erwachsenen.
Die Anspannung der Kindlein wuchs ins Unermessliche. Es krabbelte in jedem
Zentimeter ihres Körpers. Sie rückten ein wenig vom Strohballen ab, nur so weit, dass man sie von unten her, von
der Tenne, nicht sehen konnte. Dann trat auch schon der erste der Männer durch das Tor. Es war der alte Karl, ein Nachbar. Der wohnte in der weißen Bauernkate am Ende der Straße. Ein Haus, dem Stürme und Fröste über die Jahre ordentlich zugesetzt hatten. Jeder neue Orkan drohte Karls Dach zu ergreifen und es
fortzutragen, samt der langsam verrottenden Holzmöbel, die noch älter waren als Karl selbst.
Der nächste Mann, den die Kindlein ausmachten, gehörte nicht zum Dorf. Er war womöglich der Schlachter. Sein Fleischerhemd war bis zu den Ellenbogen
hochgekrempelt. Und er war der, der das Seil in der Hand hielt.
Die beiden Kindlein richteten sich auf, denn mehr als die Oberkörper der Männer konnten sie nicht erkennen. Aber auch das reichte noch nicht, um den
dritten Mann auszumachen. Die Kindlein mussten, wollten sie alles überblicken, so weit nach vorn rutschen, dass die zierlichen Finger fast den Rand
des Strohbodens berührten. Beide atmeten im selben Rhythmus, ganz flach. Sie durften sich auf gar
keinen Fall den Männern verraten.
Doch dann spürten sie plötzlich den Blick des Schlachters. Die Augen des Mannes schienen jeden Meter der
Scheune abzusuchen. Die Kindlein hielten vor Schreck den Atem an und drückten sich ganz flach auf die Dielen des Strohbodens. Instinktiv schoben sie sich wie Indianer wieder hinter den Strohballen zurück, wo sie die dicken Norwegerpullover gegen die Münder pressten und die sauerstoffarme Luft aus ihren Backen in die engen
Wollmaschen bliesen.
Aber die Männer kamen nicht die Leiter herauf. Die Kindlein waren unentdeckt geblieben.
Unten in der Tenne hatten sie mittlerweile die Sau festgebunden. Doch die war
nicht so entspannt, wie es der Großvater gewünscht hatte. Das entnahmen die Kindlein den Geräuschen, die von unten hochdrangen. Die schweren Stiefel der Männer rutschten über die ausgelegten Bleche, die Sau musste sich mit all ihrer Kraft zur Wehr
setzen. Zu gerne hätten sich die Kindlein wieder bis an den Rand des Strohbodens vorgetastet, aber
es mangelte am nötigen Mut.
»Karl«, rief einer der Männer plötzlich. »Nimm den Schwanz da weg.«
Noch nie hatten die Kindlein dem ersten Akt eines Schlachtefestes beiwohnen dürfen. Was dabei passierte, wussten sie aus den Erzählungen des Großvaters und der anderen Männer. Sie kannten all die Handlungen des Schlachtens nur ab dem Zeitpunkt, an
dem die Sau schon über der Tenne hing und die Männer den ersten Schnaps in ihre Kehlen gossen. Dann hatten die Kindlein immer
den Ringelschwanz in die Hände gedrückt bekommen, den sie anschließend mit einer Sicherheitsnadel an den hinteren Teil von Großmutters Schürze zu hängen versuchten. Warum aber sollte Karl jetzt schon den Schwanz wegnehmen? Das
kam doch erst viel, viel später, überlegten die Kindlein. Außerdem fehlten auch noch die Großmutter und die Nachbarinnen, die für das Blutrühren zuständig waren.
Die Kindlein atmeten tief, aber geräuschlos ein, drehten sich wieder auf den Bauch und schoben sich nun doch wieder
Millimeter um Millimeter zum Rand des Strohbodens vor.
Noch bevor die Augen auf die Tenne hinunterschauen konnten, nahmen die Ohren der
Kindlein eigenartige Geräusche wahr. Stöhnen, Wortfetzen, Seufzer, Stiefelscharren auf Blech. Es kam ihnen vor, als säßen sie inmitten eines Gewitters.
»Hier, nimm den Schwanz, du Sau!«, forderte der Schlachter. »Nimm ihn ganz.«
Warum, fragten sich die Kindlein, soll die Sau jetzt den eigenen Schwanz nehmen?
Und womit sollte das Tier das tun? Ein Schwein hat doch keine Finger.
Die Kindlein mussten unbedingt den Rand des Strohbodens erreichen. Was war da
unten los? Was machten die Männer mit der Sau?
Dann schoben sich die Köpfchen endlich bis über die letzte Diele. Nun war der Blick frei auf die Männer … Es war nicht die Sau, die bei ihnen war. Was sie dort unten sahen, war
unbegreiflich. Dieser Anblick ließ die Zunge des Jungen, der krampfhaft die Hand der Schwester hielt, für lange Zeit erstarren. Kein Wort würde er über die kleinen Lippen bringen. Der ganze Körper würde sich fortan in dichten Nebel hüllen.
Kindlein mein, schlaf nur ein, weil die Sternlein kommen …
1
September 1996
Seit Minuten starrte Barrus stur vor sich hin. Er hatte keine Lust, an etwas
Bestimmtes zu denken oder jemand Speziellen ins Visier zu nehmen. Er wollte
einfach stupide vor sich hinstarren. Deshalb nahm er die Passanten auch nur
schemenhaft wahr, die links und rechts der fußballfeldgroßen Baugrube ihren Angelegenheiten nachgingen, hetzend zumeist, denn Müßiggang, wie ihn Südländer beherrschten, insbesondere die von Barrus so geliebten Italiener, war hier
immer noch ein Fremdwort.
Es mochte für Außenstehende so aussehen, als habe der Mann im weißen Leinenanzug nebst dem obligaten Panamahut, seine ganze Konzentration ihm
gewidmet – dem Loch, das mittlerweile Stadtgesprächsstoff Nummer eins war, weit über die Stadtmauern hinaus. Vor einigen Monaten war es hier auf dem Neustädtischen Markt ausgehoben worden, weil der Parkplatz, den alle brauchten, die
mit dem Auto in die Innenstadt wollten, einem großen Kaufhaus weichen sollte. Sollte! Aber wie in Brandenburg oft der Fall, gab es
bislang nur das Loch, anstatt der versprochenen Baustelle, denn die war auf
Initiative der Stadtarchäologen inzwischen mit einem Baustopp gesegnet worden. Und das, obwohl kaum ein
vernunftbegabtes Wesen die Hoffnung am Leben erhielt, dass an dieser Stelle
archäologisch mehr zu finden sein würde als genau das, was man schon vor langer Zeit gefunden hatte. Aber wie es mit
Hoffnungen so ist, wussten all die Vernunftbegabten zu diesem Zeitpunkt noch
nicht, dass ihr Loch, an dessen Rand der stur dreinblickende Josef Barrus
hockte, dass dieses Loch mit dem Kolosseum in Rom gleichziehen würde. Das konnte jeder mittelprächtig begabte Grundschüler nachrechnen, hatten doch die Römer sieben Jahre gebraucht, um die weltberühmte Arena zu bauen, genauso lange wie die Brandenburger brauchen würden, um jenes Loch wieder zu schließen, auf dem dann, wer hätte das je geglaubt, ein Parkplatz errichtet sein würde.
Aber das war Barrus vollkommen egal. Bei ihm reichte es an diesem sonnigen
Septembertag nur zu einem desinteressierten Kopfschütteln, denn ihn plagten andere Sorgen, andere Löcher. Und hätten all die Menschen, die um das Loch herumschwirrten wie aufgescheuchte
Bienen, gewusst, wie es in ihm aussah, sie hätten vielleicht ihr Portemonnaie gezückt, um dem Mann, der da seit Tagen vor der Weinhandlung Belmondo herumlungerte,
einen Geldschein in die Hand zu drücken. Das nämlich waren die Löcher, die an Barrus’ Verstand nagten, die Löcher in seinen Sakkotaschen, durch die das Geld nur so rieselte.
Er drehte sich um und schleppte sich mehr, als dass er lief, bis zur Tür des Belmondo. »Hildi«, rief er ins Innere, »mach mir mal einen hübschen Grauburgunder. Schön kalt, wenn es geht.« Dann ließ er sich vor der Weinhandlung auf einen Stuhl fallen, und starrte weiter auf das
Loch.
Hildi kam an die Tür, verschränkte die Hände vor der Brust und benutzte den für sie so typischen, weil belehrenden Ton einer Gouvernante. »Jo, es ist erst elf.«
Barrus machte sich nicht die Mühe aufzublicken. »Ja, und?«, sagte er. »Ein Burgunder schmeckt um elf morgens genauso gut wie um sechs Uhr abends. Bring
ihn mir jetzt, bitte. Meine Kehle verlangt danach.«
»Das kann ja sein«, beharrte Hildi auf ihrer Belehrung. »Aber das wäre heute schon dein vierter.«
»Hildi«, schnaufte Barrus und gab dann folgende Empfehlung: »Nimm einfach einen anderen Zettel. Aller guten Dinge sind bekanntermaßen drei. Also solltest du immer nur drei Burgunder zusammen aufschreiben. Der
vierte wäre der erste auf einem neuen«, philosophierte er und ließ den Blick, der mittlerweile so schleppend war wie sein Gang, einer für Brandenburger Verhältnisse äußerst adrett gekleideten Dame folgen, die schnurstracks auf das Belmondo zuhielt.
»Und wer bezahlt mir die vielen Zettel?«, fragte Hildi, wohl wissend, dass hinter dem Tresen bereits ein ganzer Stapel
davon lag, alle mit den Initialen JB, die für Josef Barrus standen.
»Irgendwann bekomme ich auch wieder einen Auftrag«, sinnierte er, als er die Bedrohung für seinen Gaumen erkannte, die in Hildis Worten steckte. »Dann lade ich dich sogar zum Essen ein, meine Schöne. Versprochen. Aber jetzt bring mir bitte den Burgunder«, beharrte Barrus und sah der gut gekleideten Dame nach, die an ihm
vorbeigegangen war und nun, sich an Hildi vorbeischlängelnd, gerade im Belmondo verschwand, einen betörenden Duft nach exotischen Blumen zurücklassend.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte Hildi, die der Dame gefolgt war und nun hinter ihrem Tresen stand.
Die Frau nahm ihre Sonnenbrille ab und sah sich um, als wähnte sie sich im falschen Geschäft. »Ich bin doch hier richtig? Am Neustädtischen 33?«, fragte sie.
Hildi schüttelte den Kopf, dann nickte sie.
»Nein und ja«, antwortete sie schließlich, denn diese Frage war ihr nicht zum ersten Mal gestellt worden. »Wir liegen zwar direkt am Neustädtischen Markt, doch die Adresse lautet: Am Molkenmarkt 33.«
»Ah, ja«, kam es von der Dame. »Aber ich suche den Neustädtischen Markt 33. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen?«
Hildi gab nicht auf. Sie hatte da so eine Idee, dass die Dame hier im Belmondo
doch richtig war. »Wohin möchten Sie denn?«, erkundigte sie sich deshalb. Längst ahnte sie, zu wem die Dame wollte.
Die Angesprochene öffnete ihre Handtasche und entnahm ihr eine Visitenkarte. »Zur Detektei Jo Barrus«, las sie von dem Kärtchen ab, als könne sie sich die drei Worte nicht merken.
Hildi nickte erneut und nahm der Dame die Visitenkarte ab. »Dann sind Sie hier goldrichtig«, sagte sie mit dem Gefühl der Siegerin. »Darauf steht es ja: Am Molkenmarkt 33, auch wenn alle Welt glaubt, dass hier sei
der Neustädtische Markt 33. Der Herr sitzt draußen vor der Tür, und wenn Sie so nett wären, ihm das mit rauszunehmen«, ergänzte sie und stellte ein volles Weinglas auf den Tresen.
»Hallo, Josef.«
Die Dame setzte sich neben Barrus auf einen Stuhl und stellte das Glas auf das
kleine Tischchen, unter dem Barrus seine Beine ausgestreckt hatte. »Zum Wohl.«
»Kennen wir uns?«, fragte Barrus, ohne den Blick vom Loch abzuwenden.
»Ich glaube schon«, gab die Dame zu. »Und auch wenn du dich äußerlich sehr verändert hast, so dass ich dich nicht sofort erkannt habe, ist ansonsten wohl alles
beim Alten geblieben. Denn wie ich sehe, ist unser Jo weiterhin Bacchus bester
Geselle.«
Nun musterte Barrus die Dame angestrengt. »Das ist nicht ganz richtig«, entgegnete er schließlich, wieder auf das Loch starrend. »Ich habe nämlich den Arbeitgeber gewechselt. Ich stehe nicht mehr in den Diensten des
verehrten Herrn Bacchus, sondern habe mich weiterentwickelt und arbeite jetzt für seine Exzellenz Liber Pater.«
»Und wer ist das, wenn ich fragen darf?«
»Der römische Gott der animalischen Befruchtung und des Weins, wobei mein Tätigkeitsschwerpunkt weiter beim Wein liegt.« Dann sah Barrus die Dame mit einem herausfordernden Blick an. »Was wollen Sie von mir?«
Die Dame wirkte ob der jähen Wendung des Gespräches und der durch Barrus plötzlich hervorgestoßenen Frage ein wenig überrumpelt. Sie brauchte einige Sekunden, bis sie sich wieder fing. »Erkennst du mich denn nicht?«
Barrus nahm die Sonnenbrille ab und versuchte angespannt, seinen Linsen etwas
mehr an Sehschärfe zu entlocken. Gepflegtes, auf natürliche Weise hübsches Gesicht, halblanges, rötlichbraun gefärbtes Haar, volle Lippen. So lautete seine Kurzbeschreibung. Alles in allem ging er davon aus, dass dieser
sehr frauliche Körper vom Leben weniger gezeichnet war, als der, in dem er selbst steckte. Darüber hinaus verrieten die leuchtende Perlenkette, das weiße Designerkostüm und der unaufdringliche Brillantring die Zugehörigkeit der Dame zum städtischen, vielleicht sogar zum nationalen Geldadel. Und, auf die Frage der Dame
zurückkommend, solche Menschen kannte Barrus nicht.
»Müsste ich Sie kennen?«, fragte er deshalb. »Ich lese keine bunten Zeitschriften und an der Wallstreet bin ich zu selten, als
dass ich mir die Gesichter merken könnte.«
»Ich hatte gehofft, dass du mich erkennst.«
»Und woher sollte ich Sie kennen?« Barrus sah wieder zum Loch. »Hören Sie: Ich bin mittlerweile einundsechzig Jahre alt. Da ist man im Leben schon
dem ein oder anderen Menschen begegnet. Und das Gute am Altern ist, wenn es überhaupt etwas Gutes daran gibt, dass man Gott sei Dank die meisten, denen man
begegnet ist, längst wieder vergessen hat.«
»Ich zähle also auch zu den Vergessenen«, stellte die Dame fest, und es klang, als wäre sie darüber enttäuscht. Sie nahm das Weinglas in die Hand, das sie zuvor auf den Tisch gestellt
hatte, und roch daran. Dann trank sie einen winzigen Schluck, was Barrus mit
zusammengekniffenen Augen beobachtete. Anschließend schürzte sie anerkennend die Lippen.
»Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, mein Lieber.«
»Was?«, fragte Barrus und eroberte sich das Weinglas zurück.
»Dass du Wasser trinkst.«
Barrus brauchte keinen Probeschluck. Er erkannte allein an der Farbe der Flüssigkeit, dass Hildi es ein weiteres Mal viel zu gut mit ihm gemeint hatte. Mit
einer schnellen Bewegung kippte er das Wasser vor seine Füße.
Als er wieder aus dem Belmondo trat, stellte er zwei Gläser auf das Tischchen und die angefangene Flasche Grauburgunder dazu.
»Nun mal Butter bei die Fische, Madame. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?«
»Du erkennst mich also wirklich nicht?«, fragte sie und wartete eine kurze Weile, ehe sie fortfuhr. »Klingelt es immer noch nicht? Na, dann werde ich das Rätsel wohl lösen müssen. Wir sind ein Jahr lang gemeinsam zur Schule gegangen. Ich heiße Eva.«
Barrus schob sich den Panamahut in den Nacken. »Heiliger Strohsack«, entfuhr es ihm. »Die Eva. Eva Mahler, unser Mauerblümchen.«
2
»Wo ist Jo?«
Berit stand in der Tür des Belmondo. Ihr Blick, der mit voller Wucht den Tresen traf, konnte Materie
eliminieren.
»Weg«, antwortete Hildi schlicht.
»Was heißt weg? Wo ist er hin? Um diese Zeit sitzt er gewöhnlich weinselig vor deiner Tür.«
Hildi kam um ihren Tresen herum und ging auf Berit zu. Sie musste Berit
beruhigen, bevor dieser brodelnde Vulkan ausbrach.
»Guten Morgen, mein Schatz«, sagte Hildi und nahm die kleine Berit in den Arm.
Jetzt sackte Berit ein wenig zusammen, bemühte sich aber trotzdem um ein Lächeln, das etwas steif wirkte. Hildi hatte mal wieder gewonnen.
»Entschuldige«, sagte sie und ließ es dankbar zu, dass Hildi sie noch immer in den Armen hielt. »Dir auch einen guten Morgen, Hildi.«
Dann löste sich Berit aus der Umarmung und sah angestrengt auf ihre Armbanduhr. »Es ist fast elf. Ich hatte gehofft, ihn hier zu finden.«
Hildi musterte Barrus’ Nichte. Berit sah ziemlich mitgenommen aus. Und es war unschwer zu erkennen,
dass diese Abgespanntheit etwas mit ihrem Onkel zu tun haben musste.
»Was hat er dieses Mal angestellt? Hat er wieder den Müll nicht runtergebracht?«
Berit ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sie suchte nach einem Satz, einem einzigen, einem
prägnanten Satz, der mit knappen Worten ihre Situation auf den Punkt bringen würde. »Es ist eine Katastrophe mit ihm«, sagte sie schließlich und genoss Hildis Hand, die über ihre Haare strich.
»Aber das wusstest du vorher, mein Kind.«
»Schon, bloß dass es so schlimm wird …« Berit hob den Kopf, suchte Hildis Blick. »Niemals hätte ich das für möglich gehalten. Jo ist ein kompletter Chaot.«
Hildi nickte. »Ja«, sagte sie. »Aber ein liebenswürdiger. Was hat er denn nun angestellt? Erzähl es mir.«
»Nichts!«, schrie Berit ihren Frust heraus, als wäre plötzlich der Teufel in sie gefahren. »Er hat nichts, überhaupt nichts angestellt. Und deshalb ist er permanent pleite.«
»Du hast schon wieder seine Miete bezahlt, oder?« Hildis Hand glitt von Berits Kopf auf die Schulter.
»Was soll ich denn machen? Sie setzen ihn doch sonst auf die Straße. Und dann kommt er vielleicht auf die irre Idee, bei mir einzuziehen.«
Hildi rechnete kurz nach. »Wir haben jetzt September. Wie viele Mieten hast du in diesem Jahr für ihn schon übernommen?«
»Drei.«
»Dann hat er also gar keine bezahlt, denn die anderen sechs habe ich ihm
ausgelegt.«
Berit legte den Kopf zur Seite, so dass ihre Wange Hildis Hand berührte, die noch immer auf ihrer Schulter lag. »Was machen wir nur mit ihm? Das kann doch so nicht weitergehen.« Dann nahm sie den Kopf wieder hoch. Sie schaute Hildi an. »Was stellt er eigentlich mit seinem ganzen Geld an?«
Hildi holte tief Luft. »So viel hat er nicht«, sagte sie. »Die Pension, die sie ihm zahlen, nachdem er die Polizei verlassen hat, ist recht
dürftig. Die bekommt er vom neuen Staat lediglich für die Zeit seit 1990 bis zu seinem Ausscheiden, also für knapp fünf Jahre. Plus einer Übergangszahlung. Die Rente aus seinem Dienst als Polizist in der Volkspolizei
gibt es erst mit Erreichen seines fünfundsechzigsten Lebensjahres, also in vier Jahren. Und dann ist da ja noch
deine Tante. Für Gisela zahlt er Unterhalt, weil sie ja bei diesem Guru lebt und zu Gott Shiva
vorzudringen versucht. Und das nimmt ihre ganze Zeit in Anspruch.«
Berit schüttelte den Kopf. Das wollte sie nicht gelten lassen. »Aber seine Pension mit dem Übergangsgeld muss doch wenigstens für die Miete reichen. So hoch ist die ja nicht. Ich kann mich darum nicht mehr kümmern. Mein Café schluckt genug Geld, wenn ich es am Leben halten will.« Dann stand Berit auf, energisch. Sie hatte offenbar zu alter Stärke zurückgefunden. »Und die Detektei? Für sein Büro bei dir hier im Belmondo zahlt er doch bestimmt auch nichts.«
»Die Detektei …« Hildi winkte ab. »Du weißt ja, wie die läuft. Die Leute haben nicht genug Geld, um Privatdetektive zu engagieren.«
»Und der große Meister hat sich damit abgefunden, oder?«
»Offensichtlich«, sagte Hildi, lief zum Tresen zurück, streckte den Arm aus und angelte zwei Pralinen für sie beide hervor. »Hier, das beruhigt die Nerven.«
Berit schob ihre in den Mund, schloss die Augen und atmete befreit auf. »Und wo ist er nun, unser Grandseigneur?«
Hildi lächelte. Und es kam weder ihr noch Berit unpassend vor. »Er ist weggegangen. Mit einer Frau, einer Dame, wohl ziemlich vermögend, wie ich das einschätze. Sie ist vor einer halben Stunde gekommen und hat nach der Detektei Barrus
gefragt. Dann hat sie sich mit Jo unterhalten, und als der seinen Burgunder
ausgetrunken hatte, sind sie grußlos verschwunden.«
»Ein Auftrag?«
»Möglich.«
»Na, hoffentlich vermasselt er das nicht wieder. Sein wievielter Burgunder war
das denn heute schon?«
»Er wird es nicht vermasseln, mein Schatz. Er ist noch ganz klar im Kopf, es war
ja erst sein vierter.«
»Nimm ihn nicht immer in Schutz«, mahnte Berit, als sie sich bereits der Tür zuwandte. »Das hat er nicht verdient.«
»Das vielleicht nicht«, rief Hildi ihr nach. »Aber Berit, er hat doch nur uns beide, um ihn zu beschützen?«
»Sag ihm, er soll mich anrufen, wenn er wieder da ist. Ich bin im Schach-Matt und
muss unbedingt mit ihm reden.«
3
»So wohnt also unser Mauerblümchen.«
Barrus hatte sich entschieden, in der Kommunikation mit Eva vorerst die Spöttelei-Karte auszuspielen. Warum er das tat, hätte er jedoch nicht sagen können.
Sie ließ sich von seiner flapsigen Bemerkung nicht aus der Ruhe bringen. Sie warf ihre
Handtasche auf den nächsten Sessel , an dem vorbei sie Barrus in die Mitte des knapp einhundertfünfzig Quadratmeter großen Lofts geführt hatte. »Wenn du bei der Verwendung von Mauerblümchen im Sinn hast, dass ich eine Frau bin, die von Männern nur wenig beachtet wird, dann wünschte ich, du hättest Recht. Verletzen kannst du mich damit also nicht.«
Barrus nahm den Blick aus dem hallenartigen Loft wieder zurück. »Man nennt Mauerblümchen auch jemanden, der beim Skat sein Spiel nicht ausreizt, um den anderen überrumpeln zu können«, sagte er. »Bist du gekommen, um mich zu überrumpeln, schöne Eva?«
»Könnte ich das denn? Ich, die kleine Eva, die vor dreiundvierzig Jahren mit ihren
zarten vierzehn Lenzen die viel älteren Jungs der Abiturklasse angehimmelt hat.«
Barrus fühlte sich geschmeichelt, beschloss aber, dies aus taktischen Gründen besser zu verbergen. »Wenn ich das hier alles sehe«, sagte er, »gibt es die kleine Eva von damals nicht mehr. Sie scheint sehr erwachsen
geworden zu sein, ist auf Augenhöhe angekommen.«
Eva Mahler deutete auf einen der weißen Ledersessel, der mit drei Artgenossen an einem niedrigen Tisch stand, dessen
Glasplatte auf den Köpfen von vier züngelnden Kobras aus weißem Marmor ruhte. Nicht sein Geschmack, aber konnte man bei dem, was er schön fand, überhaupt von Geschmack reden? Das hier jedenfalls war das, was Barrus dem
sogenannten finanzkräftigen Bildungsbürgertum zusprach. In seiner Vorstellung fehlte nur noch eine einsame Oboistin,
wohlerzogene Tochter des Hauses, die sich bei ihrem Spiel die Qual nicht
anmerken ließ, welche ihr Strawinsky gerade bereitete.
»Setz dich doch«, sagte Eva. »Was kann ich dir anbieten? Grauen Burgunder?«
Barrus nickte. »Wenn er kalt genug ist.«
»Ist er. Ich habe einen Kühlschrank eigens für Weißwein.« Daraufhin verschwand sie hinter dem gut drei Meter hohen und fünf Meter breiten Bücherregal, hinter dem Barrus die Küche vermutete.
»Bitte«, sagte Eva wenig später, als sie Barrus die Weinflasche und einen Korkenzieher hinhielt. »Wenn du so nett wärst?«
»Nur ein Glas?«, fragte Barrus mit Blick auf Evas Hände.
»Ja. Da ich ja im Belmondo schon ein Glas getrunken habe, begnüge ich mich jetzt lieber mit Wasser, um nicht wirklich auf Augenhöhe mit dir zu landen.«
Das hatte gesessen. Barrus stellte die Weinflasche ungeöffnet auf den Tisch. War er hier richtig? Was sollte das werden? Eine Art
Abrechnung mit längst verjährten Jugendsünden?
»Eva, bist du auf einer Mission?«
»Warum?«
»Ich meine ja nur. Vielleicht bist du ja als Gräfin von Monte Christo nach Brandenburg zurückgekommen, um den ehemals bösen Jungs zu zeigen, dass du mittlerweile zu größerem Wohlstand gelangt bist, als die das jemals für möglich gehalten hätten. Und nun willst du sie vernichten. Einen nach dem anderen. Und ausgerechnet
mit mir fängst du an?«
»War die Prahlerei wirklich das Ansinnen des Grafen von Monte Christo? Ich
glaube, er wollte Rache für das Unrecht, das ihm widerfahren war. Er wollte diejenigen vernichten, die ihm
geschadet haben.«
»Stimmt«, gab Barrus zu und griff nach der Weinflasche.
Eva schüttelte den Kopf. »Du hast dich in all der Zeit wirklich nicht verändert, Jo Barrus. Wenn ich früher hätte sagen müssen, wessen Leben von euch vier Musketieren bereits mit achtzehn Jahren
vorgezeichnet sei, dann hätte ich immer auf dich getippt.«
»Und wie ist mein Leben deiner Meinung nach gelaufen, wenn das so deutlich auf
der Hand lag?« Barrus zögerte mit dem Eingießen des Weins und lehnte sich in dem voluminösen Sessel zurück. Er war bereit, auch den nächsten Schlag Evas einzustecken, geduldig, denn wenn das, was ihn momentan
umgab, nicht nur Filmkulisse war, würde er ihre Seitenhiebe später parieren, nämlich dann, wenn es um sein Honorar ging.
»Wie dein Leben gelaufen ist? Ich tippe auf Alkohol, Frauen und Polizei. Habe ich
Recht?«, fragte sie.
Barrus beugte sich wieder zum Tisch und goss sein Glas randvoll. Zur Beruhigung,
wie er sich einredete. Am liebsten hätte er nämlich laut aufgebrüllt und wäre anschließend gegangen. Doch er brauchte das Geld, und er wusste, dass sein Moment noch
nicht gekommen war. Einige Minuten musste er noch aushalten.
»Alkohol, Frauen und Polizei«, wiederholte er. »Nicht ganz falsch, aber es war nur eine Frau. Gisela.«
»War?«
»Gisela heißt jetzt Ahlachita, die Frau in glücklicher Stimmung. Sie hat sich vor drei Jahren entschieden, in den Bhagwan
eines jungen Gurus zu ziehen, um dort nach dem absoluten Glück zu suchen.«
»Und, hat sie es gefunden?«
Barrus zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Wir haben kaum noch Kontakt.«
»Habt ihr Kinder?«
Barrus schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte er, besann sich dann aber darauf, dass eigentlich ihm die Rolle des
Fragenden zustand. »Und du? Hast du welche?«
»Nein«, antwortete Eva. »Ich kann Kinder nicht ausstehen.«
»Also hast du mich nicht aufgesucht, um den zukünftigen Schwiegersohn zu überprüfen.«
»Richtig. Es geht um etwas anderes. Bist du gerade frei?«
Barrus setzte verblüfft das Weinglas ab und zog unübersehbar die Augenbrauen zusammen.
»Ich meine, ob du einen Auftrag hast oder ob du für mich arbeiten kannst?«, reagierte Eva auf das entsetzte Gesicht von Barrus. »Ich brauche einen guten Privatdetektiv. Und das, wenn möglich, sofort.«
Barrus trank das Glas mit einem Hieb halb leer und atmete dann tief ein. »Ich habe zwar viel zu tun«, log er, »aber es ließe sich bestimmt einrichten. Worum geht es denn?«
»Um einen jungen Mann. Er ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden«, sagte Eva, erhob sich und lief wieder die gut fünf Meter bis zu dem Bücherregal. Dann gab sie Barrus ein Foto, das sie aus dem Regal genommen hatte. »Er heißt Markus Weiß. Alles andere steht hinten drauf.«
Barrus sah nach. Zweiunddreißig, wohnhaft in der Stadt, verheiratet, ein Kind, Krankenpfleger in der neuen
Privatklinik am Gördenwald.
»Okay«, sagte er, »aber das wird nicht ganz billig. Die Suche nach Menschen ist nämlich kompliziert. Sie erfordert einen hohen Aufwand.«
»Wie viel?«, fragte Eva knapp.
»Fünf … fünfhundert«, antwortete Barrus.
»Fünfhundert für welchen Zeitraum?«
»Eine Woche.«
»Einverstanden. Ich gebe dir tausend, wenn du sofort anfängst.«
Barrus streckte die Hände in die Höhe. »Da kann ich wohl nicht anders. Der Kunde ist König.«
Eva beugte sich zu dem Sessel und nahm einen Briefumschlag aus ihrer Handtasche.
»Hier sind eintausend Mark. Eine Rechnung brauche ich nicht. Aber es gibt eine
Bedingung.«
»Welche?«, fragte Barrus, während der Umschlag in seinem Sakko verschwand.
»Du lässt seine Frau aus dem Spiel.«
»Aber …«
»Kein Aber«, sagte Eva, was sehr bestimmt klang und kaum Raum für Widerspruch ließ. »Er ist mein Liebhaber, was die junge Gattin nicht unbedingt wissen muss.«
Barrus senkte den Blick auf seine Finger, die bereits wie bei einem Erstklässler nachrechneten. »Das sind fünf …«
Aber Eva kam ihm zuvor. »Richtig. Er ist fünfundzwanzig Jahre jünger als ich. Wo ist das Problem, Jo?«
4
Als Barrus wieder auf den Mühlendamm trat, fiel sein Blick auf die Idylle aus ruhig dahinfließendem Wasser und einem breiten Schilfgürtel. Eine Idylle, die man in Brandenburg nicht lange suchen muss. Sie begegnet
einem auf Schritt und Tritt.
Dann blickte er noch einmal an der Fassade der alten Mühle empor. Sein Verdacht, der schon vor dem Belmondo geboren war, hatte sich
hier als begründet herausgestellt. Eva Mahler, das ehemalige Mauerblümchen, war angekommen in der Welt der Schönen und Reichen. Und er? Er war abgebrannt und weinselig, wie Eva es genannt
hatte, als sie ihn in den Fahrstuhl schob, der direkt in ihrem Loft hielt. Und
dann hatte sie ihm, als gelte es bei Gestürzten unbedingt noch einmal nachzutreten, den Rat gegeben, von den tausend Mark
zuerst ein frisches Hemd zu kaufen.
Lächerlich, absolut lächerlich, oder sollte er das wirklich tun? Papperlapapp, irgendwo in seinem
Kleiderschrank mussten noch welche liegen. Und wenn nicht, würde er Berit bitten, die Waschmaschine anzuwerfen.
Ohne weiteres Zögern und bevor Eva ihm aus ihrem Loft noch etwas Hässliches hätte zurufen können, machte Barrus sich unter Umgehung des Belmondo auf den Weg zur
Polizeidirektion. Andächtig betrachtete er das Gebäude. Vier Jahrzehnte hatte er hier gearbeitet. Fast ein ganzes Leben lang. Und über dreißig Jahre davon in der Mordkommission. Als es ein bisschen düster wurde, weil die Sonne kurz hinter einer Wolke verschwand, räusperte Barrus sich und betrat dann mit breiter Brust die alte Wirkungsstätte.
Schon auf den ersten Metern verschlug es ihm die Sprache. Was war denn hier
passiert? Die Tür, durch die Publikum und Mitarbeiter bislang ungehindert vom Foyer ins Innere
der Behörde kamen, hatte wie auch immer die Klinke eingebüßt. Und da, wo früher ein Tresen zum Gespräch einlud, stellte sich dem Besucher nunmehr eine massive Wand entgegen. Einzig
das kleine Fenster ließ einen knappen Blick zu, und Barrus erkannte sofort: Die Luke war kugelsicher.
Wen erwartete man hier? Oder lagerten im Keller neuerdings die Goldreserven der
Deutschen Bundesbank?
Barrus trat vor den Schalter und drückte mit Vehemenz auf die Klingel. Auf der anderen Seite sorgte das
augenblicklich für Bitterkeit. Mit einem Gesicht, das an die Saure-Gurkenzeit erinnerte, näherte sich der uniformierte Beamte. Der spaßgebremste Staatsdiener betätigte nun seinerseits einen Knopf. Barrus erkannte den Mann sofort. Es war Herr
Meier, ein ehemaliger Kollege des Wachdienstes, den früher allein die Vorschriften am Leben gehalten hatten, da Meiers zurückhaltende Intelligenz nicht ausreichte, eigene, noch dazu sinnvolle
Entscheidungen zu treffen. Meiers Stimme, die hatte nichts von der Anmut des
Nachtigallengesangs gehabt. Jetzt, da sie durch die Gegensprechanlage gepresst
wurde, klang sie blechern, was dem Mann etwas Roboterhaftes verlieh.
»Sie wünschen?«, fragte Herr Meier, ohne die kleinste Veränderung im eigenen Gesicht zuzulassen.
»Erkennst du mich denn nicht?«, rief ihm Barrus entgegen. »Mensch Meier, ich bin’s, der Barrus.«
Herr Meier zeigte keine Reaktion, weshalb sich Barrus genötigt sah, die Fingerknöchel gegen die Scheibe zu klopfen. »He, Meier, mach endlich die Tür auf! Ich will rein.«
Noch immer keine Veränderung im Gesicht von Polizeiobermeister Meier. Nur seine Lippen bewegten sich.
»Sie wünschen?«
Stinksauer knallte Barrus die flache Hand gegen die Scheibe. Es klatschte, als hätte er einen reifen Schinken geschlagen. »Mach auf, ich will zu Manfred!«, brüllte Barrus, biss dann die Zähne zusammen, riss die Lippen zum gefletschten Gebiss auseinander und gab auch
ansonsten Geräusche von sich, die ihn in die Nähe eines Rottweilers brachten.