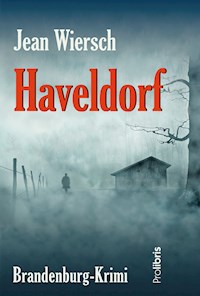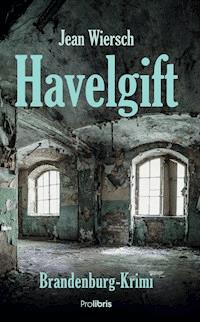Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Manzettis zweiter Fall. Eine bizarre Szenerie findet Hauptkommissar Manzetti in der Nähe des Brandenburger Theaters vor. Eine junge Frau in auffallend altmodischer Kleidung liegt tot auf einem Kneipentisch. Ihre eiskalten Hände stecken in einem altertümlichen Muff, der Griff eines Brieföffners ragt aus ihrer Brust. Manzettis Ermittlungen führen ins Theatermilieu. Aber spielen in diesem Fall selbst die Orchestermusiker Theater? Und was hat Puccini mit dem Mord zu tun?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Wiersch
Havelsymphonie
Brandenburg Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Das Echo kurzer Schritte, jenes typische Klacken weiblicher Pfennigabsätze sprang noch zwischen den eckigen Säulen des Stadtbades hin und her, als die Frau mit den Stöckelschuhen das Gebäude bereits panikartig verlassen hatte. Endlich war sie draußen, und endlich entspannte sie sich, ein wenig nur, aber genug, um allmählich ihre Selbstbeherrschung zurückzugewinnen. Aber der Ärger nagte weiter an ihr, sie kam nicht wirklich zur Ruhe.
Sie lief vor dem dunklen Gebäude hin und her, bis sie im stürmischen Novemberwind fast das Gleichgewicht verlor. Nur mit Mühe fand sie Halt, als die spitzen Absätze tief in den durchweichten Boden drangen und auch noch das Riemchen der rechten Sandale riss. Nein, für einen Aufenthalt im Freien war sie nicht angezogen.
Regentropfen um Regentropfen zerplatzte auf Wangen und Stirn. Eine ganze Armada der feuchten Himmelsboten brach schließlich über sie herein, von dort, wo nur tiefschwarzes Nichts zu sehen war, das sich Besitz ergreifend über die ganze Stadt gebreitet hatte und alles an Schmuddelwetter ablud, was das Havelland derzeit zu bieten hatte.
Mit beiden Händen über dem Kopf lief sie zur Hauswand des Stadtbades und suchte in einem verwitterten Türrahmen Schutz. Immer mehr Tropfen, die wie an einer Perlenschnur aufgereiht fast waagerecht durch die Luft geblasen wurden, durchtränkten ihre Bluse, bis die schließlich klatschnass war und eiskalt auf der Haut klebte.
„Gabi, so warte doch. Gabi!“ Auch er stürzte mehr, als dass er lief, durch die Flügeltür des alten Bades, das als eine der markantesten Schöpfungen des Bauhausstils galt und heute nur noch für Feiern und Feste genutzt wurde. Aber die Feier heute Abend war nicht nach ihrem Geschmack verlaufen.
„Gabi, ich bitte dich, sei doch vernünftig“, schrie er in die alles verschluckende Dunkelheit und drehte dabei nervös seinen Kopf nach links und rechts.
Warum verschwand er nicht wieder, dieser Taugenichts?, ging es ihr durch den Kopf. Soll er doch wieder hineingehen, hinein zu dieser aufgetakelten Schnepfe, und soll er tanzen mit ihr, mit seinen leuchtenden Augen. Was konnte sie schon dagegen tun?
In solchen Momenten, davon war sie zutiefst überzeugt, war es ihm völlig egal, dass er sie der Lächerlichkeit preisgab. Da interessierte ihn auch nicht, dass sie als Mutter von zwei Kindern eine Frau war, die zwar in die Jahre kam, aber noch immer ganz gut mit den jungen, gesichtslosen Dingern mithalten konnte. In solchen Momenten, umringt von seinen geifernden Kollegen, wurde er von seinem Schwanz gesteuert und war nicht zu nüchternen Überlegungen fähig.
„Gabi, wo bist du denn?“ Seine flehenden Worte amüsierten sie geradezu. Und deshalb wäre es vielleicht sogar ein schöner Moment gewesen, wenn nicht der Wind immer wieder eiskalt durch ihre dünne Bluse gepfiffen hätte. Als sich auch noch nasses, schweres Laub über ihren Sandalen sammelte, lief sie endlich weiter.
„Bleib doch stehen, verdammt noch mal … Gabi!“ Seine muskulösen Hände packten plötzlich ihre dünnen Arme, hielten sie fest. Wütend sah sie zu ihm auf.
„Gabi, das ist doch nicht dein Ernst. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Sie ist die Sekretärin des Chefs, junge Mutter und glücklich verheiratet“, behauptete er. Das hatte er aber schon drinnen geschworen. Ihr fiel die Zeit ein, als sie selbst noch junge Mutter war, die niemals um drei Uhr morgens über den Tanzboden geschwirrt wäre, solange ihre Kinder noch im Baby-Alter waren. Außerdem kannte sie derlei Erklärungen von ihm zur Genüge.
Ich liebe dich! Es kommt nicht wieder vor! Jetzt zählst nur noch du! Sie wollte es, sie konnte es nicht mehr hören. Nicht jetzt und auch nicht morgen oder an einem anderen Tag. Sie wollte sich das nie wieder antun, hatte sie sich beim letzten Mal geschworen. Nie wieder! Und jetzt fing er wieder damit an. Sie warf die Sandale auf den Boden, schlüpfte hinein und stapfte dann über das glitschige Kopfsteinpflaster der Havelstraße.
„Komm wenigstens auf den Bürgersteig“, bat er, als er sie wieder eingeholt hatte und neben ihr herlief.
„Nein“, rief sie energisch, und das Echo ihres Schreis pendelte drei Mal zwischen den Fassaden der alten Bürgerhäuser, ehe es der Wind davontrug. Sie würde ihm in dieser Situation auf keinen Fall irgendeinen Wunsch erfüllen. Nichts durfte den leisesten Verdacht erzeugen, sie würde ihm in Kürze doch wieder nachgeben.
Sie wollte ihn dieses Mal nicht nur zappeln lassen, zwei oder drei Tage lang, so wie sie es bisher immer getan hatte und wie es mit ihrer besten Freundin besprochen war. Sie wollte ihn endgültig loswerden.
Mittlerweile waren sie bis zur Ecke Grabenstraße gekommen, wo er nun schweigend neben ihr hertrottete. Eigentlich hätte sie jetzt geradeaus in die Kurstraße laufen müssen und von dort weiter über die Hauptstraße und den Neustädtischen Markt bis ins Deutsche Dorf. Aber sie hatte Spaß daran, eigene Entscheidungen zu treffen, solche, die ihm signalisierten, dass sie ihn gar nicht brauchte und eigentlich sogar besser ohne ihn klarkam. Deshalb bog sie nach rechts in die Grabenstraße ab, direkt in Richtung des Theaters.
„Gabi, was soll das denn nun wieder? Komm doch mit nach Hause, du wirst dich noch erkälten ohne Jacke.“
Sie tat so, als hörte sie ihn gar nicht, und ging stur weiter. Nur nicht reagieren, war jetzt die Devise. Ihre ganze Konzentration galt einzig seinen Schritten. Folgte er ihr oder wagte er es wirklich, geradeaus zu gehen?
Sie musste sich sehr anstrengen, denn der laute Wind verschlang fast alle Geräusche um sie herum. Aber sie wollte sich auch nicht umdrehen um zu sehen, wohin er lief, das hätte ihrer gerade ersonnenen Demonstration weiblicher Stärke womöglich geschadet. Nur ganz leicht wandte sie deshalb ihren Kopf über die linke Schulter, gerade so weit, dass ihr Ohr ihm zugewandt war und sie seine Schritte hinter sich hören und daraus schließen konnte, dass er nicht weiter in Richtung Kurstraße gelaufen war.
Schnell drehte sie sich wieder nach vorn, rieb sich die Augen und wischte damit auch gleich die Wimperntusche breit. Als sie wieder klar sehen konnte, tauchte neben ihr der Eingang der Theaterklause auf, und vor ihr lag das Große Haus des Cultur und Congress Centers.
Aber es war nicht der Anblick der Theaterklause, der sie plötzlich erstarren ließ und ihr zusätzlich zur bitteren Kälte neue Gänsehaut über die Arme trieb, und es war eine ganz andere Szenerie, die ihrer Kehle einen markerschütternden Schrei entrang.
2
Eine halbe Stunde nachdem Frau Manter entgegen ihrem eigentlichen Vorhaben doch wieder in die Arme ihres Mannes gesunken war, standen beide im gleißenden Licht vieler Scheinwerfer. Nur der Theaterpark, jener grüne Lungenflügel, der die Grabenstraße zu einer Seite hin begrenzte, lag noch im Dunkeln der sich langsam verabschiedenden Nacht. Frau Manter hatte vorerst ihren Ärger über die wilde Tanzerei des Gatten beiseitegelegt und inzwischen auch vergessen, dass ihr entsetzlich kalt gewesen war, denn über ihrer nassen Bluse trug sie einen dick gefütterten Parka mit der breiten Aufschrift POLIZEI.
Hauptkommissar Andrea Manzetti beachtete das Ehepaar nicht. Später, erst nachdem er einen Gesamteindruck gewonnen haben würde, wollte er sich mit den beiden befassen. Bis dahin, war er sich sicher, war durch Sonja Brinkmann all das aufgeschrieben, woran die Manters sich erinnern konnten.
So stand Manzetti etwas abseits und betrachtete regungslos die bizarre Szenerie. Er lehnte mit tief in den Manteltaschen vergrabenen Händen rücklings an einem Auto, das irgendjemand mit dem Heck bis an die große Strauchhecke gefahren hatte. Die hatte längst alles Grün abgeworfen, was aber für einen ersten November auch nicht ungewöhnlich war.
Er starrte auf den kleinen Platz vor dem Theater, wobei seine Augen sich nur sehr langsam bewegten. Es hatte nichts mit der morgendlichen Müdigkeit zu tun, vielmehr versuchte Manzetti, in die gegenwärtige Situation einzutauchen, mit jedem Atemzug die Atmosphäre aufzusaugen und sich dabei noch nicht in komplizierten Details zu verlieren. War nämlich erst einmal aufgeräumt hier, dann war auch dieser Eindruck verloren. Für immer, denn Fotos waren seiner Meinung nach nicht in der Lage, Stimmungen einzufangen. Jedenfalls nicht die der Polizeifotografen. Dazu bedurfte es Profis, die mindestens einen vernünftigen Bildband veröffentlicht hatten, aber die konnte sich die Polizei nicht leisten. Genau deshalb fuhr Manzetti seit eh und je selbst an die Tatorte, und alle achteten penibel darauf, dass sie nichts anrührten, bevor der Chef dazu seine Erlaubnis erteilte.
Manzetti begann das Sammeln von Eindrücken links, wo der Eingang des Großen Hauses war. Den hatte er erst vor gut drei Wochen seiner Frau offen gehalten, als sie zum ersten Konzert der Brandenburger Symphoniker in der neuen Spielsaison gekommen waren. Das Orchester war wieder einmal großartig gewesen, und auch bei der Auswahl der Stücke hatte der Generalmusikdirektor ein goldenes Händchen bewiesen. Carl Maria von Weber, Hindemith und Bernstein hatten jene Mischung ausgemacht, die dem verwöhnten Geschmack des Publikums voll entsprach, und der Höhepunkt, ein Stepptänzer zu klassischer Musik, hatte dank der unzähligen Bravorufe drei Zugaben geben müssen.
Manzettis Augen wanderten weiter, vorbei an der Theaterklause, hin zu den Häusern der Grabenstraße, die nicht mehr zum Theaterkomplex gehörten und wo die polizeiliche Absperrung begann. Er griff in die Innentasche seines Mantels, in der gewöhnlich der handtellergroße Schreibblock steckte und schrieb zwei Wörter auf: Intendant, Gastwirt.
Als er wieder aufblickte, sah er zu Sonja, die wild gestikulierte und wohl hoffte, ihn dadurch mahnen zu können, dass die Kollegen nun lange genug auf ihren Einsatz warteten. Endlich gab Manzetti nach und ließ mit einer Handbewegung alle mit der Arbeit beginnen.
„Kollege Köppen!“, rief er dem jungen Mann entgegen, der frierend von einem Bein auf das andere sprang.
„Was soll ich machen, Herr Manzetti?“, fragte Köppen mit klappernden Zähnen.
„Versuchen Sie bitte, den Intendanten des Theaters und den Eigentümer dieses Lokals aufzutreiben“, wies Manzetti ihn an und zeigte mit gestrecktem Arm auf die Klause. „Ich brauche beide hier, auch wenn es wohl noch nicht ihre Zeit ist. Aber vorher fahren Sie zur Wohnung von Bremer und bringen ihn sofort hierher. Wenn nötig, treten Sie seine Tür ein.“
„Das hat die Kollegin Brinkmann bereits veranlasst“, sagte Köppen ohne Zögern.
„Was? Dass Bremers Tür eingetreten wird?“, fragte Manzetti mehr rhetorisch und deshalb mit breitem Grinsen.
„Nein. Aber der Doktor wird gerade mit einem Streifenwagen gebracht.“
Als Köppen in der Menge verschwunden war, bog wie zur Bestätigung auch schon das Polizeifahrzeug aus der Havelstraße ein und hielt direkt vor dem rot-weißen Absperrband. Dr. Bremer kletterte vom Beifahrersitz und zog den Kragen seines Mantels mit einer Hand zusammen.
„Morgen, Dottore“, grüßte Manzetti, als der Gerichtsmediziner auf seiner Höhe war. „Mal wieder vor lauter Träumen das Telefon nicht gehört?“
„Hm“, knurrte der Arzt und war im Begriff, schnell an Manzetti vorbeizugehen. Der lächelte erneut, als ihre Blicke sich kurz trafen.
„Leiden Sie neuerdings unter Bulimie?“, fragte der Hauptkommissar dann mit hochgezogenen Augenbrauen.
„Bulimie? Wieso?“, brabbelte Bremer, ohne dabei stehen zu bleiben.
„Weil Sie aussehen, als hätten Sie Ihr Frühstück unter großen Anstrengungen gerade wieder erbrochen.“
„Ich lach mich tot, Manzetti“, schnaufte der Gerichtsmediziner. „Ich habe noch nicht gefrühstückt, und wenn Sie mich weiter vollquatschen, dann komme ich heute auch nicht mehr dazu.“
„Sind Sie in diesem Zustand überhaupt in der Lage, vernünftig zu arbeiten?“ Manzetti fragte das, weil ihm Bremers Fahne, die zu dem Mann gehörte wie der Stern zu Mercedes, hier draußen in der frischen Luft geradezu ekelerregend in die Nase strömte.
„Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Ich habe drei Stunden geschlafen, das reicht.“
Manzetti zuckte mit den Schultern und folgte dem Mediziner schweigend bis vor die Klause, wo er sich so hinstellte, dass der Wind den Fuselgeruch von ihm wegtrug. Er kannte Bremer nun schon viele Jahre, ebenso viele, wie der an der Flasche hing. Weil er ihn trotzdem mochte, litt Manzetti bei jedem Aufeinandertreffen der beiden an seinem eigenen Mitleid, das er einfach nicht ablegen konnte und mit betonter Ruppigkeit zu überspielen versuchte. Er schätzte Bremers messerscharfen Verstand, seinen Humor und auch den Einsatzwillen, drei Punkte, die in jüngster Vergangenheit jedoch immer häufiger von wahren Saufexzessen verdrängt worden waren.
„Bremer, was sehen Sie?“
Der Arzt hob nicht einmal den Kopf, als er antwortete: „Weiblich, etwa dreißig Jahre alt und weniger als acht Stunden tot. Mehr Zeit hatte ich ja noch nicht, oder?“
Manzetti trat einen Schritt zur Seite und setzte sich schwerfällig auf einen der Plastikstühle. Dabei wunderte er sich, dass man den Gästen noch im November das Angebot machte, draußen sitzen zu können. Dann blickte er wieder zur Toten.
Er sah sich die Frau etwas genauer an. Sie war sehr hübsch. Ihre langen blonden Haare waren streng nach hinten gekämmt und dort zu einem Zopf gebunden. So boten sie dem Wind, der am frühen Morgen etwas nachgelassen hatte, kaum Angriffsfläche.
Der Täter hatte die Frau nicht einfach auf den Boden gelegt, sondern auf einen der Kneipentische, die vor der Klause standen. Dort ruhte sie wie in ihrem Bett. Nur war sie angekleidet, allerdings trug sie ein Kleid, das irgendwie nicht in die heutige Zeit passte. Vielleicht kam es fünfzig Jahre zu spät. Es war etwa wadenlang, grau und bis oben zugeknöpft. Und es hatte sogar angesetzte Puffärmel, die jede Trägerin artig aussehen ließen. Über dem Kleid trug die Tote eine schlichte Schürze, ebenfalls grau, wenn auch eine Nuance heller, die, jedenfalls soviel Manzetti momentan erkennen konnte, so eng geschnürt war, dass die Brüste der Frau regelrecht platt gedrückt wurden.
Im Übrigen konnte der Eindruck entstehen, als schliefe sie seelenruhig und ließe sich dabei von niemandem stören. Ihr Kopf mit dem ebenmäßigen Gesicht war auf ein großes Kissen gebettet. Ihre Hände steckten in einer länglichen Hülle aus flaumigem Fell.
„Woran ist sie gestorben?“, fragte Manzetti.
„Zuviel Post“, antwortete Bremer ohne lange zu überlegen.
„Zuviel Post?“
„Ich habe sie zwar noch nicht umgedreht, aber hier vorne steckt ein Brieföffner in ihrem Herzen.“
Nun stand Manzetti doch auf und konnte gerade noch sehen, wie Bremer den Brieföffner langsam aus der jungen Frau zog und ihn in die Luft hielt: „Ein schönes Stück.“
„Was ist daran schön?“, wollte Manzetti wissen.
„Sieht aus wie Jade.“
„Nie und nimmer“, meinte Manzetti, als er ganz dicht neben Bremer getreten war. „Das sieht eher aus wie Massenware.“
„Massenware?“, empörte sich Bremer spielerisch. „Brieföffner sind doch keine Massenware. Manzetti, ich bitte Sie, wer schreibt denn heute noch Briefe. Heute verschickt man E-Mails oder SMS, aber doch keine Briefe mehr. Und wenn doch noch jemand einen Brieföffner besitzt, dann stammt der aus dem Nachlass der Großtante …Trotzdem, Sie könnten Recht haben“, sagte Bremer nach kurzem Zögern und hielt den grünen Griff des Brieföffners noch dichter gegen den grellen Schein des Scheinwerfers, den die Kriminaltechniker für ihn aufgebaut hatten. „Und Sie haben Recht, was ich ungern zugebe“, stellte er plötzlich fest. „Sah aber auf den ersten Blick wirklich aus wie Jade.“ Seine Enttäuschung war nicht zu überhören.
„Ja, sicher doch.“ Manzetti unterdrückte den Wunsch, die Augen zu verdrehen. „Ist sie nur daran gestorben? Ich meine, wurde sie erstochen?“
„Sieht so aus. Sie hat keine weiteren Verletzungen an der Vorderseite, keine Würgemale am Hals und keine Anomalien in den Augen. Aber genau kann ich es erst sagen, wenn sie bei mir im Institut ist.“
„Was sind das da für Schlüssel?“, fragte Manzetti.
„Welche Schlüssel?“ Bremer schaute sich suchend um.
„Unter dem Tisch. Da liegen doch zwei Schlüssel.“
Bremer trat einen Schritt zurück und bückte sich.
„Liegen lassen!“, befahl Manzetti.
Sofort zuckte Bremer zurück, wobei er sich den Kopf geräuschvoll an der Tischkante stieß. „Idiot“, stöhnte er, rieb sich die Schädelplatte und fragte dann, als wäre nichts gewesen: „Meinen Sie, die stammen von der Toten? Sehen aus wie Haustürschlüssel.“
„Sie können auch vom Täter sein. Das werden wir klären müssen.“ Manzetti angelte mit seinem Kugelschreiber nach dem Schlüsselring und sah sich die Fundstücke etwas genauer an. Ein Schlüssel war oben rund und der andere viereckig. Er drehte sie weiter hin und her. Auf dem runden stand IKON und auf dem eckigen BAB. Mit der linken Hand kramte Manzetti in der Manteltasche und förderte zum Vergleich sein eigenes Schlüsselbund zu Tage.
„Der hier“, er hielt den Kugelschreiber mit den Schlüsseln in Bremers Richtung, „ist von BAB und meiner auch. Das heißt zwar noch nichts, aber es könnte immerhin sein, dass es wirklich Haustürschlüssel sind.“ Manzetti übergab sie einem Kollegen, der sie in eine durchsichtige Plastiktüte steckte.
„Was ist das für ein Fell?“, fragte Manzetti nach einer kurzen Pause und deutete mit dem rechten Zeigefinger an Bremer vorbei auf die pelzige Hülle, in dem noch immer die Hände der Toten steckten.
„Sieht aus wie ein Muff“, erklärte Sonja, die plötzlich zwischen den beiden Männern stand. „Schön warm, aber schon ziemlich aus der Mode gekommen.“
Bremer zog unterdessen eine Hand der Leiche aus dem Muff und blickte anschließend mit faltiger Stirn zu Manzetti.
„Was haben Sie?“, fragte der, nun noch neugieriger geworden.
„Fassen Sie mal die Hand an“, forderte Bremer nicht ohne aufsteigende Erregung, denn er wusste nur zu gut, was er dem Hauptkommissar damit zumutete. Aber seiner Meinung nach hatte Manzetti sich das schon allein wegen seiner ruppigen Begrüßung verdient, als er am Tatort erschienen war.
Manzetti schob unterdessen seine Hand ganz behutsam nach vorne, so wie es kleine Kinder tun, die zum ersten Mal in ihrem Leben einen Hund streicheln sollen, der viel größer als sie selbst ist. Dann berührte er zögerlich den blassen Handrücken der toten Frau. Blitzartig zuckte er zurück. „Die ist ja eiskalt.“
„Richtig“, lobte Bremer und versteckte die Hand der Toten zwischen seinen, ganz so, als würde er sie wärmen wollen.
Manzetti setzte sich wieder in den Stuhl, irgendetwas trieb sich plötzlich in seinem Kopf herum. Es war einer von den Gedanken, die er für gewöhnlich nicht sofort beschreiben konnte, von denen er aber glaubte, dass sie nicht unwichtig waren. Es dauerte eine Weile, bis er diese Inspiration in Worte fassen konnte. Nach einigen Sekunden der Stille und einem tiefen Seufzer sprach er mehr zu sich, als zu den anderen. „Che gelida manina.“
„Was?“ Sonja sah Hilfe suchend erst zu ihrem Chef und dann zu Dr. Bremer.
Manzetti erhob sich und legte seinen Arm um ihre Schulter: „Wie eiskalt ist dies Händchen“, sang er ganz leise und offenbar mit einer Melodie, die ihm gerade eingefallen war.
„Und was soll das bedeuten?“ Sonja war nun offensichtlich völlig verwirrt.
„Puccini. La Bohème. Che gelida manina ist die wohl berühmteste Arie aus dieser Oper. Kennst du die etwa nicht?“ Manzetti zog seine junge Kollegin noch dichter an sich heran.
Sonja schüttelte den Kopf. „Muss ich das?“
„Natürlich nicht“, räumte er ein, ließ sie schließlich los und begann dann seine Erklärung. „In diesem Musikstück beschreibt Puccini das Künstlermilieu im Paris des beginnenden neunzehnten Jahrhunderts mit ihrem ungezwungenen Lebensstil, die Bohème. Unter ihnen waren Maler, Dichter, Bildhauer und auch Musiker, deren Dasein oft so etwas wie ein täglicher Geniestreich war, ein Überlebenskampf.“
„Heute würde man wohl sagen, dass sie von der Hand in den Mund gelebt haben“, ergänzte Bremer, der kurz zu den beiden Kommissaren aufgesehen hatte.
„Und was hat das mit dieser Frau zu tun?“, warf Sonja ein und deutete mit dem Kinn zu der Toten. Sie konnte sich noch immer nicht erklären, worauf Manzetti anzuspielen versuchte.
„Mit der Toten?“, fragte er. „Ach so. Zu dieser Bohème gehörte auch ein Dichter mit dem schönen Namen Rodolfo, der sich eine Behausung mit dem Maler Marcello teilte. Bei ihm lernte Rodolfo die Stickerin Mimi kennen und verliebte sich in sie.“
Sonja hörte zwar weiter zu, sah aber inzwischen mit anderen Augen zum Tisch. Hatte sich die unbekannte Tote etwa zu Lebzeiten unglücklich verliebt? War auch sie an einen Künstler geraten und musste die Liaison schließlich mit dem Leben bezahlen? Unmöglich war das nicht, schließlich lag sie vor dem Theater.
„Und dann hat dieser Rodolfo die Stickerin getötet“, stellte Sonja schließlich fest.
„Nein“, widersprach Bremer aufs Heftigste. „Mimi war an Schwindsucht erkrankt, woran sie dann auch starb. Und wegen ihrer Erkrankung hatte sie immer kalte Hände. Che gelida manina eben.“
„Und deshalb steckte sie ihre Hände in einen Muff?“ Sonja formulierte es zwar wie ein Frage, aber eigentlich klang es eher wie eine Erklärung.
„Genau. Deshalb steckte sie ihre Hände in einen Muff“, bestätigte Manzetti. „Das hier sieht auf den ersten Blick fast genauso aus. Mimi liegt mit Händen in einem Muff auf einem improvisierten Diwan, noch dazu neben unserem Theater. Ihr fehlt nur noch das rote Häubchen.“
Sonja fragte nicht weiter, denn sie glaubte, dass sie zwar nicht jedes Detail begriffen hatte, aber aus einer gewissen Intuition heraus im Moment ihrem Chef geistig folgen konnte. Sie meinte zu wissen, was er wollte, denn Täter, die ein Verbrechen regelrecht in Szene setzten, wählten die Orte ihrer Inszenierung natürlich nicht zufällig. Vielmehr verbanden sie mit ihnen etwas, sie hatten gar eine Beziehung zu dem Ort oder wollten damit wenigstens etwas zum Ausdruck bringen. Das konnte man gut und gerne mit einer Demonstration vergleichen, bei der sich auch niemand vor einem Bäckergeschäft einfinden würde, um gegen hohe Benzinpreise zu protestieren.
Zwar glaubte Sonja, ihren Chef zu verstehen, aber den Blick, den er Bremer nun zuwarf, konnte sie nicht einordnen. Aber die beiden hatten sich still verständigt und hoben in unerwarteter Eintracht den Oberkörper der Toten, bis Bremer unter das flauschige Kopfkissen gucken konnte.
„Und?“, fragte Manzetti hastig.
„Nichts … nur ein gelbes Blatt“, stellte Bremer enttäuscht fest.
Daraufhin sah Sonja etwas grimmig aus, denn sie hatte den sicher geglaubten Faden längst wieder verloren. „Kann mir mal jemand verraten, was ihr hier treibt? Blätter fallen nun mal im Herbst herunter, oder irre ich mich da?“ Ihre Hände stemmte sie dabei provokativ in die Hüften.
„Bei Puccini“, erklärte Manzetti, „hatte diese Mimi ein rosa Häubchen, das sie hin und wieder unter dem Kopfkissen versteckte. Aber hier lag eben nur dieses Blatt. Es hätte so schön sein können …“
Er trat wieder etwas dichter an den Tisch, beugte sich über den Kopf der Leiche und wandte sich dann zu Sonja: „Wissen wir schon, wer sie ist?“
„War“, korrigierte Bremer.
„War“, wiederholte Manzetti mit eindeutiger Mimik.
„Nein“, musste Sonja einräumen. „Sie hatte keine Papiere dabei, und bislang hat sie niemand erkannt. Es haben aber auch noch nicht viele Leute einen Blick gewagt.“
Manzetti schaute nach rechts, dorthin, wo zwei uniformierte Kollegen die Absperrung verteidigten.
„Wenn du das Flatterband abnimmst, kommen die zu Dutzenden und wagen mehr als einen Blick. Guck dir nur die Handys an. Die halten sie doch nicht in die Luft, weil so die Gespräche besser zu verstehen sind.“
„Deswegen müssen sie die Tote aber noch lange nicht kennen“, gab Sonja zu bedenken.
„Gekannt haben“, kam es wieder von Bremer.
Sonja begnügte sich nicht mit einem strafenden Blick, wie Manzetti. Sie holte weit aus und trat Bremer vors Schienbein.
„Ich habe sie schon irgendwo gesehen“, behauptete Manzetti in das Gejaule von Bremer hinein, während er sich wieder über die Leiche beugte und intensiv das Gesicht betrachtete. Es war ein wirklich schönes, mit ganz ebenmäßigen Zügen. Der Teint war nordisch und die Nase teilte das Gesicht gleichmäßig in zwei Hälften. Das war wohl das Geheimnis von Schönheit. Die Symmetrie. Wenn die Proportionen harmonisch waren, so wie hier, dann sah auch ein totes Gesicht noch reizend aus, so, als würde es friedlich schlafen. „Ich kann mich nicht erinnern, aber ich bin mir absolut sicher, dass ich sie erst vor kurzem gesehen habe und das nicht nur flüchtig. Ein so schönes Gesicht vergisst man nicht so schnell.“
Als Bremer die zweite Pirouette vollendet hatte, trat er vorsichtig mit dem schmerzenden Bein auf und sah wutschnaubend zu Sonja. Aber sein Blick glitt schnell weiter, über ihre Schulter hinweg. Und dann fragte er: „Was will die denn hier?“
„Wer?“
„Na, die da.“ Bremer zeigte ungeniert mit dem ausgestreckten Finger auf die Frau, die noch immer mit dem Polizeiparka innerhalb der Absperrung stand.
„Das ist Frau Manter“, sagte Sonja.
„Das weiß ich. Aber was will die hier?“ Bremer wurde immer lauter.
„Sie hat die Tote gefunden“, erklärte Manzetti, packte den Arzt an der Schulter und drehte ihn wieder zur Leiche.
3
Nach mehr als zwei Stunden intensiver Tatortarbeit sah Manzetti auf seine Uhr. Spätestens um sieben wollte er nämlich wieder zu Hause sein. Allerspätestens.
Also übergab er Sonja das Zepter und verließ zu Fuß den Platz vor dem Theater. Sein eher bedächtiger Marsch führte ihn nicht auf dem kürzesten Weg durch den Theaterpark, sondern durch die Wollenweberstraße. Das brachte ihm nicht nur genug Zeit und Muße, um die ersten Eindrücke und die sich aufdrängenden Fragen zu sortieren, sondern es schonte auch seine teuren Schuhe, die nicht im Matsch der aufgeweichten Wege versinken mussten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!