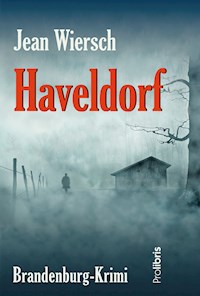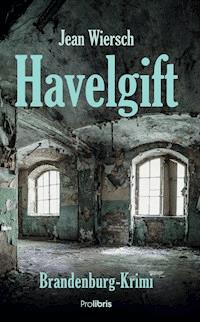Inhalte
Titelangaben
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Anmerkungen des Autors
Info
Jean Wiersch
Havelreime
Brandenburg-Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie des Autors. Ebenso
die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2018
Tel.: 0561/766 449 0, Fax: 0561/766 449 29
Titelbild: © Daniel Mikulla, Brandenburg
Kinderfoto © gabrielefusetto - adobe stockfoto
Schriften: Linux Libertine
jr!hand by www.fontframe.com/tepidmonkey
anke print by www.anke-art.de
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN E-Book: 978-3-95475-193-8
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95475-185-3
www.prolibris-verlag.de
Der Autor
Jean Wiersch, Jahrgang 1963, gehört seit 1994 der Polizei des Landes Brandenburg an. Er lebt mit seiner Frau
inmitten der Mark Brandenburg, am Ufer des wunderschönen Beetzsees. In der wasser- und waldreichen Region westlich von Berlin spielen
auch seine bislang sechs Kriminalromane, die bereits im Titel einen deutlichen
Bezug zu seiner Heimat tragen, der Havel:
Havelwasser, Havelsymphonie, Haveljagd und Havelgeister mit dem Ermittler Andrea Manzetti, Havelbande und Havelgift mit Jo Barrus und nun Havelreime, in dem Manzetti und Barrus gemeinsam einen Fall lösen.
Prolog
Juni 1953
Schwere Wolken bestürmten die Stadt. Sie bedrohten die Straßenzüge, waren Vorboten des nahenden Unwetters. Der Regen peitschte bereits über die Dächer, hinterließ feuchte Kühle. Ein grotesker Juni, der die Menschen hinter Fenster verbannte oder in warme
Jacken zwang.
Auch die Frauen in den Hallen des VEB Feinjute trugen ihre Winterpullover,
manche hatten sogar Mützen aufgesetzt oder Stirnbänder aus dicker Wolle über die Ohren gezogen. Das half zumindest gegen die kriechende Kälte, nicht aber gegen den dröhnenden Maschinenlärm. Dem war kein Kraut gewachsen.
Arbeitsbedingungen waren das! Wie im Mittelalter. Und trotzdem sollten sie immer
mehr schaffen, immer mehr Garn spinnen, immer mehr Stoffe weben. Die
Strickmaschinen durften nicht stillstehen, auf gar keinen Fall, egal wie es den
Frauen dabei ging.
Sklaverei – das hatten sie gestern in der Frühstückspause einstimmig beschlossen – Sklaverei sei das, was sich hier im Betrieb abspielte. Nicht einmal die
Gewerkschaft schien noch auf ihrer Seite zu stehen. »Menschenschinder seid ihr!«, hatte Ingrid dem Gewerkschaftsfunktionär zugerufen. »Nichts weiter als Menschenschinder.« Und alle hatten sie applaudiert. Auch sie, die junge Frau, die Gini genannt
wurde, hatte lauthals Beifall geklatscht.
Und heute? Heute war der Platz an Ingrids Strickmaschine leer. Abgeholt hatten
die sie. Mitten in der Nacht. Ohne Worte. Einfach so mitgenommen. Wie damals
die Gestapo.
Gini schaute zur Uhr über der großen Eingangstür. Halb elf. Seit sieben streikten die Arbeiter der Bau-Union im Stahl- und
Walzwerk. Ein Streik! Unvorstellbar im real existierenden Sozialismus. Aber
Hans, der Beifahrer der Spedition Pfaffe, der jeden Morgen die fertigen
Garnrollen und Stoffballen des Vortages abholte, der wusste es ganz genau. Er
hatte ihn mit eigenen Augen gesehen, den Zug der wütenden Arbeiter. Die Kollegen des Schlepperwerkes und der Volkswerft hatten sich
angeschlossen. Eintausend Demonstranten – Wahnsinn!
Doch es gab bereits Festnahmen, hatte Hans hinter vorgehaltener Hand erzählt. Einen Ulli zum Beispiel, den Ulli Tettenborn, den sollen sie bereits
eingesperrt haben.
Gini kannte diesen Ulli Tettenborn nicht. Aber was spielte das in diesen Tagen
auch schon für eine Rolle? Es war egal, ob man sich kannte. Sie alle, die sie in den Fabriken
malochten, waren Gleichgesinnte. Sie alle litten unter demselben Joch, waren
gleichermaßen betroffen von der Entscheidung der Parteiführung. Und die war eindeutig. Zehn Prozent mehr! Zehn Prozent! Das stelle man
sich mal vor. Und das bis zum 30. Juni, dem 60. Geburtstag von Walter Ulbricht.
Aber jeder wusste, das war nicht zu schaffen. Von niemandem.
Und der Lohn? Der blieb niedrig. Der wuchs nicht mit. Ausbeutung war das, reine
Ausbeutung, fand Gini.
Darüber hatten sie sogar gescherzt. Bitter.
»Im Kapitalismus gibt es die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen«, hatte der Gewerkschafter ihnen zugerufen. »Ja, ja«, hatte Ingrids Antwort gelautet. »Und im Sozialismus ist es genau umgekehrt.«
Aber trotz Scherzen blieb es eine Riesensauerei. Und so mussten auch die
Arbeiter im Stahlwerk zehn Prozent mehr bringen.
»Darüber haben sie diskutiert«, wusste Hans zu berichten. »Und dem Tettenborn, dem hat das zu lange gedauert, das Diskutieren. Er wollte auf die Sirene drücken, um sie alle aufzufordern, das Werk zu verlassen. Nur kam es nicht so weit.
Noch bevor Tettenborns Finger den Knopf berührten, hatte ihn der Werkschutz gepackt.«
Aber nun marschieren sie doch, dachte Gini, und rieb sich erfreut wie ein
kleines Kind die Hände und blickte wieder auf die Uhr. Gleich würde es zur nächsten Pause bimmeln und sie würde versuchen, etwas Neues zu erfahren.
Und dann war es endlich so weit. Mit dem Klingeln rannten sie alle zusammen.
»Habt ihr was gehört? Wo sind sie jetzt? Haben sie die Parteizentrale schon erreicht?«
Die Fragen überschlugen sich.
»Man sagt, sie sind zum Amtsgericht unterwegs«, wusste jemand. »Zur Untersuchungshaftanstalt in der Steinstraße. Die Eingangstür sollen sie eingedrückt haben. Und Richter Benkendorff hat nach der Polizei telefoniert.«
Auch Harry Benkendorff kannte Gini nicht persönlich. Nur vom Hörensagen, was kein gutes war. Die Bevölkerung hasste den Richter. Zu hart seine Urteile, viel zu hart. Insbesondere
gegen sogenannte Staatsfeinde. Viele Brandenburger hätten Benkendorff in diesen Tagen gerne hängen sehen.
»Sie sind jetzt beim Volkspolizei-Kreisamt«, rief eine der Frauen, die in der Verpackung arbeiteten.
Da überlegte Gini blitzschnell. Die Volkspolizei war hier gleich um die Ecke. Nur
ein guter Kilometer.
Und dann rannte sie auch schon los. Vorbei am Pförtner, raus auf die Bauhofstraße, Luckenberger Brücke, Puschkinplatz, Magdeburger Straße.
Nun stand sie vor der aufgebrachten Menge. Ihr Herz schlug wie wild. Ein
Anblick, der Gänsehaut auf ihre Arme trieb. Hunderte Menschen drängelten sich vor dem Polizeigebäude. Zumeist Männer. Und fast alle hatten die Fäuste in den Himmel gereckt. So etwas hatte Gini zuletzt vor acht Jahren erlebt.
Im Mai 1945. Da rannten Frauen, Kinder und alte Männer durch die Straßen, reckten die Arme in die Luft. »Vorbei! Vorbei! Der Krieg ist vorbei!«, hatten sie gerufen damals.
Als Gini sich dem Polizeigebäude näherte, erkannte sie einzelne Gesichter. Polizisten, die auf der Treppe standen. Jung waren sie, sehr
jung. Und sie versuchten, die entfachte Menge zurückzudrängen.
Dann erstarrte Gini. Was macht der denn da, schoss es ihr in den Kopf. Nein! Tu
das nicht! Um Himmels willen.
Keine zwanzig Meter von ihr zog ein Polizist seine Waffe und ballerte in die
Luft. Was sollte denn das? Hoffte er etwa, so die Menge beruhigen zu können? Fehlanzeige! Die ersten Arbeiter hatten ihre schweren Schuhe schon auf die
unterste Treppenstufe gesetzt, und von hinten drückten unerbittlich die anderen nach.
Gini ließ den Polizisten nicht aus den Augen. Auch er war jung. Vielleicht zwanzig. Und
er hatte Angst, das stand klar und deutlich in seinem Gesicht. Und aus dieser
Angst heraus nahm er den Arm herunter und schoss ein weiteres Mal. Dieses Mal
in die Menge, dieses Mal schoss der Polizist auf Menschen.
Gini zerriss es fast die Brust. Sie begann zu schreien. Neben ihr stürzte ein junger Mann zu Boden. Er schrie nicht, er fiel nur, und er blutete am
Kopf. Der Polizist hatte den Mann getroffen!
Da gab es für Gini kein Halten mehr. Sie drängte nach vorn, hin zur Treppe, und immer wieder rief sie: »Mörder, Verbrecher! Los, stürmt das Gebäude! Ihr Scheißverbrecher!«
Als sie an der untersten Stufe angekommen war, schlug sie wie wild um sich. Sie
stieß einfach drauf los. »Ihr verdammten Mörder!« Ihre Hände trafen wahllos Uniformen, mit aller Kraft. Endlich war sie an der Tür, drängte weiter, immer weiter, von unbändiger Wut vorangetrieben; griff zu, riss ein Plakat von der Wand und einen
Radioapparat zu Boden.
Und dann spürte sie nur noch den harten Schlag. Das Krachen hinten an ihrem Kopf.
1
November 1998
Manchmal passieren Dinge, von denen man später meint, dass es sie gar nicht gegeben habe, dass sie Produkt der Fantasie
begnadeter Erzählerinnen sind, quasi das Werk einer Scheherazade unserer Zeit. Und trotzdem
machen diese Dinge die Runde, meist sogar die ganz große. Es beginnt regelmäßig in der Nachbarschaft, sozusagen direkt am Ohr von Frau Kamischke. Dann
erwischt es Frau Blechinger von nebenan. Und da der Gatte der Frau Blechinger
sich nicht zu schade ist, es Herrn Schmabutzke anzuvertrauen, seinem Kollegen
an der Wurststrecke im Schlachthof, läuft die Geschichte ab da rasant von einem Ohr zum nächsten. Unaufhaltsam. Auch vor Stadtmauern macht sie nicht halt, landet sogar im
kleinen Städtchen Rathenow, wo die Schmabutzkes seit annähernd drei Generationen ihren Wohnsitz haben. Und wenn die mittlerweile zur
Dichtung mutierte Erzählung eines Tages wieder bei Frau Kamischke in Brandenburg anlangt, dann glaubt
die Gute steif und fest, dass es eine neue Geschichte ist, die sie da hört, weil mit der alten, mit der, die sie einmal auf den Weg gebracht hatte, hat
die jetzt rein gar nichts mehr zu tun. Sie ist mittlerweile so verändert, dass sie niemand wiedererkennt, selbst die geschichtenaffine Frau
Kamischke nicht. Stille Post.
Und so oder so ähnlich war es auch mit dem, was Jo Barrus an diesem Herbsttag passiert ist. Kaum
jemand spricht noch davon, weshalb es hier erzählt sei, etwas verändert nur, obwohl Frau Kamischke selbst vor dem Jüngsten Gericht Stein und Bein schwören würde, alles genauso aus sicherer Quelle erfahren zu haben, quasi jedes einzelne
Wort, für das sie ihre Hand sogar ins Fegefeuer legen würde. Und sie habe nichts, also rein gar nichts, nicht mal einen noch so winzigen
Buchstaben hinzugefügt, geschweige denn weggelassen. Schließlich, und darauf war Frau Kamischke sehr stolz, habe sie das überhaupt nicht nötig, ist sie doch die unmittelbare Nachbarin des Herrn Barrus, seines Zeichens
erster und einziger Privatdetektiv der Stadt. Weshalb also bitteschön sollte sie da ihre eigene Fantasie bemühen? Pah! Üble Nachrede so was.
Und so wusste Frau Kamischke an jenem grauen Novembermorgen des Jahres 1998 ganz
genau, dass der Herr Barrus, der ansonsten immer recht früh auf den Beinen war, was sie durch die dünnen Wände immer sehr gut hörte, dass der Herr Barrus also an jenem Morgen noch nicht aufgestanden war. Und
das konnte nur einen Grund haben, wie Frau Kamischke fand. Einen einzigen. Nämlich, dass der Herr Barrus schwer am Grübeln war. Angestrengt am Grübeln. Wahrscheinlich grübelte er über einen neuen Fall, der ganz bald, davon war Frau Kamischke überzeugt, in der Zeitung landen würde.
Und genauso war es auch. Fast jedenfalls, weshalb bereits hier redaktionell
eingegriffen werden muss, denn der Barrus lag zwar wirklich regungslos in
seinem Bett und grübelte, allerdings nicht über einen neuen Fall. Aber er grübelte, insofern Frau Kamischke nicht in Gänze Unrecht hatte. Und dieses Grübeln war ein seltsames, eines, das den Detektiv seit beinahe einer Stunde beschäftigte. Doch es ging, wie gesagt, nicht um einen neuen Fall, auch wenn Frau
Kamischke das so gern gehabt hätte, schon wegen der Frau Blechinger. Es ging um etwas ganz anderes, etwas
Profanes. Es ging um ihn. Um Jo Barrus selbst.
Und genau das hinderte ihn an diesem Morgen am Aufstehen, verdammte Scheiße noch mal. Dabei wäre es ganz einfach gewesen für den Barrus. Raus die Beine, erst das rechte, dann das linke, und auf mit dem
ungelenken Körper, hoch in die Senkrechte.
Doch so simpel war er nicht gestrickt, der Barrus. Und er tat gut daran, denn er
fühlte etwas, und das eben ließ ihn angestrengt grübeln. Ein Gefühl war das, dass einem das Speihen kommen konnte, wenn grausame Gedanken den Verstand traktieren. Es war an
diesem Morgen nämlich etwas nicht so, wie es sonst gewesen war. Und das ertrug der Barrus schon
immer nur schwer. Veränderungen. Das Einmischen des Schicksals in alte Gewohnheiten. Wie ihm das
zuwider war.
Also machte der Barrus das, was er am besten konnte, und zwar fluchen. Er schrie
laut Scheiße, so laut, dass Frau Kamischke auch wirklich jeden Buchstaben verstehen musste,
und riss die Augen auf, starrte auf den Wecker, als hätte der ihn gerade zutiefst beleidigt. Halb sieben. Und nun? Das war es nicht,
was anders war an diesem Morgen. Denn der Barrus wurde fast immer zwischen halb
sechs und halb sieben wach – Macht der Gewohnheit.
Normalerweise rollte er sich dann nach rechts und schob in dem Moment, da sich
sein Oberkörper in die Senkrechte brachte, die Füße in die vor dem Bett wartenden Latschen. Nur eben an diesem Tage nicht. Da war,
wie schon gesagt, etwas anders, irgendetwas war nicht wie immer. Aber was,
verdammt noch mal? Himmel, Arsch und Zwirn!
Um das herauszufinden, braucht man im Grunde nur alles so zu tun, wie man es
ansonsten jeden Morgen zelebriert. Allerdings nur bis zu dem Moment, bei dem
man nicht mehr weiterkommt mit der getreuen Wiederholung. Und das ist dann der
Umstand, nach dem man gesucht hat, der Augenblick, bei dem etwas anders ist,
bei dem einem, wie in der Bibel beschrieben, das Licht aufgeht.
Und da der Barrus als Detektiv ein kluger Kopf war, kam auch er auf diese
grandiose Idee. Er begann also mit den Handlungen, die er jeden Morgen vollzog,
und dies ganz der Reihe nach.
Als Erstes rieb er die Zunge gegen den Gaumen. Gleich mehrmals. Dann schob er
sie nach vorn an die Schneidezähne und weiter, bis sie zwischen den Lippen in die Freiheit drängte. Bestimmt hätte es ihn gefreut, wenn Zunge und Gaumen zu dem Schluss gekommen wären, dass er am Abend zuvor ein wenig zu tief ins Glas geschaut hatte. Das nämlich wäre ein Ergebnis gewesen. Obwohl, es hätte ihn an dieser Stelle auch nicht weiter gebracht. Denn ein wenig Wein zu viel
wären für den Barrus nicht das gewesen, was er als anders zugelassen hätte. Nicht, dass er jeden Morgen mit einem Brummschädel wach wurde, aber außergewöhnlich …? Nein, etwas Außergewöhnliches wäre das nicht. Und da Zunge und Gaumen sich an diesem Morgen nicht auf ein
gleichklingendes Votum einigen konnten, war der Barrus gezwungen,
weiterzusuchen.
Als Nächstes zog er ganz vorsichtig das rechte Bein unter der Bettdecke hervor. Er hob
es so weit an, wie seine steifen Knochen das zuließen, ohne dass Muskeln oder Sehnen rissen. Und er ließ es wieder nach unten fallen, das Bein. Und?
Ein kurzes Verharren, ein Funke im Gehirn. Dann war es da, das Andere. Endlich.
Noch einmal hob der Barrus das Bein, und noch einmal ließ er es fallen.
Ja, das war es. Unverkennbar.
Er hob beide Hände und klatschte sie gegeneinander. Noch einmal, noch einmal und wieder und
wieder. Der Barrus applaudierte wie ein kleines Kind im Zirkus und quiekte wie
ein Ferkel.
Nun wusste er endlich, was heute anders war. Und es war eine bittere Erkenntnis,
die seine gerade erst nach oben gewanderten Mundwinkel augenblicklich nach
unten zog. Eine Erkenntnis, auf die man an einem lichtscheuen Novembermorgen
nicht unbedingt wartet. Auch der Barrus nicht. Eine Erkenntnis, von der man
hofft, sie gehe an einem vorüber wie die Vorhölle oder wie die Neugier der Frau Kamischke, was irgendwie das Gleiche zu sein
schien.
Und als die Freude gewichen war, blieb ohne Zweifel der Umstand im Raum stehen,
dass er nichts mehr hörte. Der Barrus war taub. Und er war entsetzt. Entsetzt darüber, dass er taub war.
Wie würde es jetzt weitergehen mit ihm? Wie würde sein künftiges Leben aussehen? Wie würde er mit Hildi kommunizieren, mit Berit, mit Imre, mit der Sonntagsrunde?
Konnte er das überhaupt noch? Vielleicht mit kleinen Zetteln, wie damals in der Schule – (Willst du mit mir gehen? Ja – Nein – Mal sehen). Oder würden sie allesamt die Gebärdensprache erlernen müssen?
Wieder klatschte der Barrus in die Hände. Und immer noch hörte er nichts, rein gar nichts.
Endlich stand er auf und schlurfte ins Bad. Vor dem Spiegel drehte er den Kopf
erst nach links, dann nach rechts. Allerdings war das nichts weiter als
vergebene Liebesmüh. Es gelang ihm nämlich trotz kunstvollster Verrenkungen nicht, ins Innere der Ohren zu schauen.
Wie auch? Immer wenn die Gehörgänge des Barrus im Spiegel auftauchten, hatten seine Augen diesen schon wieder
aus dem Blick verloren. Warum war er nicht als Chamäleon auf die Welt gekommen? Himmel, Arsch und …
Der Verzweiflung nahe, sah der Barrus sich um. Dann zog er alle Schubkästen auf, die er greifen konnte. Vielleicht hatte Gisela ja einen ihrer schätzungsweise zwanzig Taschenspiegel hiergelassen, als sie ausgezogen war, damals.
Aber nein, Gisela war gründlich wie immer vorgegangen, sie hatte alles mitgenommen, wirklich alles,
folglich auch ihre dämlichen Taschenspiegel, in die sie unablässig geglotzt hatte.
So kam er also nicht weiter, der Barrus.
Erneut durchstöberte er die Schubläden. Irgendetwas Brauchbares musste es doch geben in diesem Haushalt. Und tatsächlich fand er endlich die Plastikdose mit den Wattestäbchen. Warum, muss man sich an dieser Stelle fragen, war er denn nicht gleich
darauf gekommen? Himmel, A… Allein Giselas Abwesenheit griff als Erklärung zu kurz, wurde als solche vom Barrus aber trotzdem erst einmal in die
engere Wahl gezogen.
Er angelte sich also ein Wattestäbchen, trat erneut vor den Spiegel und schob das gepolsterte Ende ganz behutsam
ins rechte Ohr. Er drehte es im Uhrzeigersinn, dann dagegen und zog es wieder
heraus.
Nichts! Nur eine geringe Menge gelbes Ohrenschmalz. Aber Geräusche? Fehlanzeige. Kein einziger Ton, nur dumpfe Taubheit. Auch das Klirren hörte der Barrus nicht, das er eigentlich hätte hören müssen, als das Zahnputzglas nebst Bürste ins Waschbecken kippte und in tausend Teile zerbrach.
»Eine verdammte Scheiße ist das«, fluchte er seinem Spiegelbild entgegen. »Eine gottverdammte Scheiße!«
2
Als der Barrus wenig später auf die Altstädtische Fischerstraße trat, ergriff ihn ein mittelprächtiges Frösteln. Nicht ungewöhnlich für Anfang November, und der Blick, den er hinauf in den Himmel richtete, verriet
ihm, dass auch dieser Tag des Jahres 1998 wieder ohne Sonnenstrahlen auskommen
musste. Brandenburg eben. So schön es hier in dieser wasser- und waldreichen Gegend im Sommer war, so grausam
konnte der Landstrich bei Eintreffen der herbstlichen Nebelschwaden sein. Dann
verging er sich an den Menschen. Dann zerquetschte er ihnen die Seele. Himmel …
Auf dem Weg zum Belmondo, der Weinhandlung am Neustädtischen Markt, steigerte sich des Barrus’ Unwohlsein also noch einmal auf das doppelte, kaum mehr auszuhaltende Maß. Er fand, dass der graue Himmel, die feuchte Kälte und das fehlende Gehör einfach zu viel für einen Mann in seinem Alter waren. Und die Straßenbahn, die auf der Jahrtausendbrücke an ihm vorbeirumpelte, tat ihr Übriges. Auch sie bot ihm nichts an! Keinen einzigen Laut, keinen Mucks gaben die
Stahlräder von sich, oder richtiger, der Barrus hörte ihr Kreischen nicht. So musste es sein, wenn Selbstmordgedanken geboren
wurden.
Aber war es wirklich das Alter? Verlor man heutzutage schon mit Mitte sechzig
die Fähigkeit zu hören? Der Barrus fing an, daran zu glauben.
Er war bereits kurz hinter dem Bollmannbrunnen in der Hauptstraße, als seine Aufmerksamkeit von einer Schaufensterauslage gefesselt wurde. Er
blieb abrupt stehen.
Sich jung zu fühlen ist keine Sache des Geldes.
Der Satz zog sich mit riesigen Lettern über die gesamte Breite des Schaufensters, und die Buchstaben dockten sich
allesamt wie die Saugnäpfe eines Kraken an des Barrus’ Gehirn.
Weil jedes Gehör einzigartig ist, erhalten Sie bei uns immer die bestmögliche Lösung für Ihre Hörbedürfnisse – und das zum Nulltarif.
Hatte er das richtig gelesen, oder trübte sich neben seinem Gehör auch schon der Blick? Ja wirklich, da stand es. Neun Buchstaben, die selig
gesprochen gehörten. Nulltarif! Das war genau nach seinem Geschmack.
Aber war ein Hörgerät überhaupt in der Lage, absolute Taubheit zu kompensieren? Der Barrus wusste es
nicht. Und um das hier an dieser Stelle herauszufinden, war es zu früh. Um acht Uhr hatten die Geschäfte noch geschlossen in dieser vermaledeiten Stadt. Him…
Also zog der Barrus weiter in Richtung Belmondo. Hildi würde wenigstens einen Kaffee und ein Croissant für ihn haben, und vielleicht auch tröstende Worte, obwohl er die ja im Moment nicht hören konnte. Trotzdem war dieser Gedanke ein Lichtblick an dem ansonsten trüb-beschissenen Novembermorgen.
3
»Espresso oder Cappuccino?« Hildi, die wie immer hinter dem Tresen stand, stellte ihre Frage mit hellwachen
Augen.
Doch der Barrus antwortete nicht, er sah Hildi nur an. Der Blick eines alternden
Dackels.
»Was ist? Was guckst du mich so an? Willst du einen Espresso oder lieber einen
Cappuccino zu deinem Croissant?«
Der Barrus zog die Augenbrauen hoch. Da seine Taubheit erst wenige Stunden alt
war, konnte er den Mitmenschen noch nichts von den Lippen ablesen. Auch nicht
von Hildis prallen und mit einem kräftigen Rot überzogenen. Er angelte also das Notizbuch und den Bleistift aus der
Manteltasche, schlug es auf, kritzelte ungelenk ein paar Buchstaben hinein und
reichte es dann über den Tresen.
»Du bist taub?« Hildi betrachtete ihn mit einer gehörigen Portion Skepsis. Sie kannte ihren Jo schon sehr lange und hatte einiges
mit ihm erlebt. Da war Vorsicht geboten.
»Ja«, knurrte der Barrus, obwohl er nichts von dem verstanden hatte, was Hildi ihn
gefragt hatte. Aber er wusste ja, was er ihr aufgeschrieben hatte, und er
wusste auch, dass Hildi Behauptungen, denen sie nicht über den Weg traute, immer als Frage wiederholte. Vorsichtshalber, um nicht verarscht zu werden, wie sie es auszudrücken pflegte.
Sie kam um den Tresen herum und baute sich mit der Gebärde eines altgedienten preußischen Feldwebels vor dem Barrus auf. Nur eben nicht in Uniform, dafür aber mit einem militärisch einwandfreien, weil stechenden Blick.
»Was ist das denn wieder für ein Unsinn? So schnell wird man nicht taub. Auch du nicht«, stellte sie barsch fest, ergriff mit beiden Händen des Barrus’ Kopf und zog ihn auf ihre Höhe herunter, was ein Bild abgab, als begännen zwei zugeneigte Affen, sich gegenseitig zu lausen. Dann suchte Hildi in des
Barrus’ rechtem Ohr die Ursache der angeblichen Taubheit.
»Hast du heute schon geduscht?«, fragte sie, um gleich darauf anzuordnen: »Nun hab dich nicht so. Komm mal mehr ins Licht.«
Als Hildi den Kopf des Barrus’ wieder freigab, um den menschlichen Fleischklops näher ans Schaufenster, respektive ins Licht zu schieben, nutzte dieser Klops die
sich bietende Gelegenheit zur Flucht und deutete gut zwei sichere Meter von
Hildi entfernt mit beiden Zeigefingern auf seine Ohren.
»Hildi, ich kann dich nicht hören. Ich bin taub. Du musst mir schon aufschreiben, was du mir zu sagen hast.«
Hildi, die ansonsten eigentlich nicht schwer von Begriff war, blickte ihn immer
noch skeptisch an, gab aber erst einmal nach. Das war wohl klüger bei einem Sturkopf vom Format eines Jo Barrus. Sie nahm den Notizblock und
schrieb ihre Frage auf.
Der Barrus fühlte sich, als er Hildis Botschaft gelesen hatte, wie in einem ganz schlechten
Film. Er schüttelte vehement den Kopf. Es hatte ihn schon als Kind bis aufs Messer gereizt,
wenn man ihm nicht glaubte, immer wieder andere Fragen stellte, von der jede
einzelne nur dazu diente, seine Behauptung zu hinterfragen, also eigentlich ad
absurdum zu führen. Und so war es heute noch.
»Nein«, blaffte er los. »Ich habe kein Wasser im Ohr, und ich beabsichtige auch nicht, welches
hineinzugießen. Ich bin heute wach geworden, und da war mein Gehör ohne Vorankündigung verschwunden.«
»Also kein Wasser«, stellte Hildi enttäuscht fest.
Der Barrus deutete wieder auf seine Ohren, worauf Hildi erneut zum Notizblock
griff.
»Nein«, schrie er, »kein Wasser, verdammte Scheiße noch mal.«
»Wer braucht Wasser hier?« Es war Imre, der alte ungarische Israeli oder israelische Ungar, der über dem Belmondo wohnte, Hildi in der Weinhandlung zur Hand ging und der gerade
zur Tür herein kam.
»Niemand braucht Wasser, Imre. Jo kann nichts mehr hören.«
Der Barrus machte automatisch noch einen weiteren Schritt zurück. Jetzt benötigte er Abstand, dringend. Denn nun standen schon zwei Heilkundige vor ihm, was
die Bedrohung aus seiner Sicht nicht schmälerte und weshalb er bereits bereute, dass ihn sein erster Weg an diesem Morgen
ins Belmondo geführt hatte und nicht zu einem HNO-Arzt, was die klügere Entscheidung gewesen wäre.
Voller Misstrauen blickte er auf die beiden Gestalten hinab, auf die sich
permanent bewegenden Lippen, von denen der Barrus auch ohne Kenntnis der Gebärdensprache ablesen konnte, dass sie gerade über ihn redeten.
»Er hat in Ohr Wasser vielleicht«, sagte Imre.
»Er sagt nein«, antwortete Hildi.
»Muss er legen Kopf zur Seite und springän auf einem Bein. Dann läuft Wasser wieder heraus.«
»Du musst es ihm aufschreiben. Er kann uns nicht hören. Oder mach es ihm am besten vor.«
Dem Barrus wurde die Situation langsam zu blöd. Die beiden Schamanen starrten ihn an, als sei er ein unbekanntes Wesen von
einem fernen Planeten. Ein Alien quasi. Und nun fing Imre auch noch an zu
tanzen. Zur Begrüßung des Außerirdischen vielleicht. Der Barrus schüttelte angewidert den Kopf. Imre hatte den seinen auf die linke Schulter gelegt
und sprang wie Rumpelstilzchen auf einem Bein herum, während er sich unablässig mit der flachen Hand gegen die Schläfe schlug. Der Barrus konnte es nicht fassen. Das Belmondo war zu einem
Tollhaus, zur Zentrale einer Irrenanstalt geworden. Fehlte nur noch, dass Hildi
ein Dutzend Hühnerknochen auf dem Fußboden verteilte, um darin seine Zukunft abzulesen.
»Ich habe kein Wasser im Ohr«, spuckte der Barrus hervor. »Ich bin taub, versteht ihr? Taub, taub, taub! Und langsam freue ich mich sogar über diesen Zustand, erspart er mir doch euer dummes Geschwätz. Kriege ich jetzt endlich einen Cappuccino? Himmel, Arsch und Zwirn.«
Das war eine klare Ansage. Sofort beendete Imre den Indianertanz und verschwand
mit Hildi in einiger Eile hinter dem Tresen, wo sich beide an dem großen Kaffeeautomaten zu schaffen machten. Das erste Vernünftige, dachte sich der Barrus, das die zwei heute zu Wege brachten.
Nachdem sich der Wasserdampf verzogen hatte, stellte Hildi ihm einen Cappuccino
auf den Tresen. Und wie eine Rechnung legte Imre einen Zettel daneben.
Wenn nicht ist Wasser im Ohr, dann ist vielleicht Gehörsturz. Ist gefährlich das, muss man nicht machen Scherz damit.
Der Barrus nahm wie immer einen gewaltigen Schluck des noch heißen Cappuccinos, als wäre seine Speiseröhre mit Asbest ausgeschlagen. »Was ist ein Gehörsturz?«, fragte er.
Imre drehte den Zettel um, während Hildi im Hintergrund telefonierte, schrieb etwas auf die Rückseite und schob ihn zu Barrus. Ist Infarkt im Ohr. Bekommen immer mehr ältere Menschen heute. Hat man Verlust von Gehör, als wäre verstopft Ohr mit Watte. Man muss handeln schnell, weil Ursache kann sein
Durchblutungsstörung.
Der Barrus zerknüllte den Zettel in der Faust. Jetzt waren sie wahnsinnig geworden. Jetzt gingen
die Pferde mit ihnen durch. Auch wenn der Barrus selten zu Mitleid neigte,
dachte er für den Moment daran, die zwei von ihren Qualen zu erlösen, wie es Polizisten bei angefahrenen Rehen tun, wenn der Jagdpächter nicht zu erreichen ist.
»Ihr spinnt ja!«, schrie er seinen angestauten Frust heraus. »Ihr habt eine Vollmeise. Alle beide. Euch juckt’s doch unterm Pony. Ich habe kein Wasser im Ohr und auch keinen Gehörsturz. Ich kann einfach nichts mehr hören. Ich bin taub. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Taub, taub, taub,
verdammt noch mal!«
Aber die beiden Schamanen, wie sie der Barrus in Gedanken mittlerweile
betitelte, ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Eisern zogen sie ihren Stiefel durch, und
das mündete darin, dass jetzt auch Hildi einen Zettel auf den Tresen legte.
Ich habe einen Rettungswagen gerufen. Sie müssen gleich hier sein. Du sollst dich solange hinsetzen und ganz ruhig bleiben.
Als der Barrus von der Notiz aufsah, hatte Hildi bereits wieder den
Gesichtsausdruck des altgedienten preußischen Feldwebels angenommen, während ihr ausgestreckter Arm in die Ecke des Belmondos zeigte, wo der Stammtisch
der Sonntagsrunde stand.
»Andiamo!«, sagte sie. »Andiamo!«
Und auch wenn des Barrus’ Gehör noch nicht wiedergekommen war, hatte er jeden Buchstaben von Hildis
italienischem Lieblingswort verstanden.
Auf geht’s!
4
Es war alles andere als leicht für den Barrus, diesen Schritt zu gehen. Aber von der Eingangstür des Belmondo bedrohte Hildis Blick seinen Rücken wie die Spitze einer Hellebarde. Und er wusste nur zu gut, was das zu
bedeuten hatte.
Was also sollte er machen? Ihm blieb nichts weiter übrig, als in den Rettungswagen zu steigen und sich ins Städtische kutschieren zu lassen, wie die alten Brandenburger das Klinikum in der
Hochstraße nannten. Er nahm sich vor, das Ganze wie ein Mann zu ertragen, aber kaum hatte
der Barrus die Pförtnerloge des Städtischen passiert, war sie auch schon da, die Panik. Als hätte der Barrus sie beim Christkind bestellt, fiel sie ihn bei jedem Klinikbesuch
an wie ein tollwütiger Hund, der ohne ein warnendes Bellen gleich auf die Kehle geht.
Mit gewaltigem Magendruck setzte er sich auf einen der harten Plastikstühle und harrte mit wachen Augen der Dinge, die da kommen sollten. Vielleicht würde aber alles auch nicht gar so schlimm sein und man dem Barrus sogar helfen,
was bedeutete, dass hier jemand sein Gehör wiederfand, ohne dabei wie ein indianischer Medizinmann auf einem Bein zu
tanzen und sich mit der flachen Hand gegen den Kopf zu schlagen. Der Barrus
stieß ein heidnisches Stoßgebet in den Himmel, was er mit erhobenem Zeigefinger unterstützte, und was standesgemäß auf Zwirn endete.
»Herr Barrus?« Die junge Schwester hatte sich nur einen Meter vom Barrus entfernt aufgebaut.
Ganz anders jedoch als Hildi, viel freundlicher, fast schon liebreizend,
weshalb es dem Barrus recht warm ums Herz wurde.
Dann streckte sie beide Arme nach ihm aus, als würde sie ihn mittels unsichtbarer Energieströme von seinem Stuhl ziehen können. Aber da der Barrus noch immer diesen Magendruck hatte, sann er trotz des
warmen Herzens den düsteren Gedanken weiter, nämlich dass sie, nachdem sie ihn hochgezogen hatte, den Gesichtsausdruck ändern und ihn in eine dunkle Kammer sperren würde, wo sie absonderliche Dinge mit ihm zu treiben gedachte, wie sie nur
liederlichen Frauen einfielen.
Dem Barrus zog sich die Gänsehaut bis zu den Schultern hoch. »Ich … wissen Sie, ich kann Sie nicht hören. Und außerdem bin ich ganz falsch hier. Ich sollte besser wieder gehen.«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf.
»Außerdem müssen Sie mir alles aufschreiben, was ich tun soll.«
Aber sie hatte wohl keine Lust zu schreiben. Sie lächelte und das auf eine Art und Weise, dass der Barrus gar keinen Zettel
brauchte, um nachzufragen, was sie von ihm wollte. Er stand auf und folgte
ihren unsichtbaren Energien wie ein Kaninchen, das sich willenlos der Schlange überlässt und von ganz allein in die dunkle Höhle hoppelt.
Man weiß ja, wie es zugeht in der Ambulanz von Krankenhäusern. Da war anders als im Deutschen Bundestag jeder Platz gefüllt, und dieses Spalier durchschritt der Barrus dann doch wieder mit einigem
Argwohn. Allerdings war es jetzt nicht die Krankenschwester, der er mit Skepsis
folgte, und auch die Verbände waren nicht das, was ihn verstörte. Es waren die Blicke der anderen Patienten. Blicke, die wie Nadeln stachen.
Zwar nicht so intensiv und bedrohlich wie der Hildische Hellebardenblick, aber
in der Summe genauso unangenehm.
Was mochten sie von ihm denken? Warum glotzten sie ihn so an? Hatte es
vielleicht mit dem Umstand zu tun, dass sie alle weißen Mull am Kopf trugen, der Nasen und Ohren bedeckte, und der sie auf eine unübersehbare Art und Weise zu Verbündeten machte? Dagegen kam der Barrus nicht an. Aus ihrer Sicht musste er
geradezu jungfräulich wirken, denn ihn zeichnete nicht mal ein Pflaster aus.