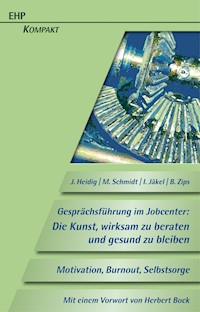Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Prozesspsychologen Gmbh
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Sachsen sind dieser Tage sehr wütend. Erst das Thema Migration, jetzt Corona. Manche setzen sogar die heutigen Proteste mit denen des Jahres 1989 gleich und fühlen sich wie damals. Dieses Buch geht der Frage nach, wie es zu den aktuellen Polarisierungen kommen konnte und was daraus folgt. Das Fazit fällt nicht besonders optimistisch aus: Für den Modus "Zuhören und Reden" scheint es in Sachsen an vielen Stellen einstweilen zu spät zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Sachsen und der „gefühlte Krieg“
Heimat, Wut und Trauma
Was wir eigentlich wollten und was daraus geworden ist
Buchempfehlung: Die Kultur der Hinterfragung
VORWORT
Mit der Freiheit verhält es sich wie mit einer umgekehrten U-Funktion, hat mein geschätzter Kollege Christoph Meißelbach einmal gesagt. Unter den Umständen totalitärer Herrschaft ist mehr Freiheit immer auch besser. Aber es gibt den Moment, an dem mehr Freiheit nicht mehr bedeutet, dass es besser wird, sondern ab dem mehr Freiheit irgendwie dazu beiträgt, dass es schwieriger wird, in einer Gesellschaft zusammenzuleben. Man kann dies auf die Individualisierung schieben oder an der Krise der Demokratie festmachen – oder diskutieren, was die Ursache ist. Für mich persönlich wird dieser Zusammenhang am deutlichsten, wenn man sich einmal die Diskrepanz zwischen dem, was viele Ostdeutsche seinerzeit am Ende der DDR wollten, und der Dynamik der heutigen Anti-Corona-Proteste verdeutlicht.
Die Situation heute hat nichts mit der Lage in der späten DDR zu tun. Niemandem wird der Mund verboten, niemand wird abgeführt. Aber manche Leute fühlen sich so, als seien sie Revolutionäre, und einige, so scheint es, wähnen sich gar in einer Art „gefühlten Krieges“. Als wären die Corona-Maßnahmen ein derart „letztes“ Ereignis, dass man unbedingt dagegen kämpfen müsste. Fakt ist, dass sich dieser Tage manche so fühlen wie „damals“. Dieses „Damals“ ist lange genug her, als dass man heute damit anstellen kann, was man möchte.
So wird die aktuelle Situation zur Projektionsfläche. Man reagiert auf die aktuellen Zeiten mit Emotionen aus der Vergangenheit. Den Herausforderungen unserer heutigen Demokratie wird mit aus sozialistischen bzw. autoritären Zeiten stammenden Emotionen begegnet. Die Mehrheit der DDR-Bürger mag seinerzeit Freiheit gewollt haben. Die oberflächlichen Freiheiten (Reisen, neue Autos) hat man zwar genossen, aber die Seele ist nicht mitgekommen – und das auch, weil man spätestens in Sachsen den entsprechenden politischen Bildungsbedarf deutlich unterschätzt hat.
In diesem Buch geht es um die Frage, was in Sachsen los ist und welche Gründe das hat. Gleichzeitig wird die Frage gestellt, was man tun kann. Allerdings fällt das Fazit skeptisch aus. Man kann derzeit, so fürchte ich, wenig tun. Dennoch lohnt es sich zu verstehen, warum manche auf heutige Herausforderungen mit Emotionsmustern aus der Vergangenheit reagieren.
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Eiligen Leserinnen und Lesern mag die Lektüre des ersten Kapitels genügen. Wer es genauer wissen möchte, lese das zweite Kapitel. Es geht um die Frage, warum es sich bei der gegenwärtigen Dynamik im Osten Deutschlands um eine Art Stellvertreterproblem handelt, das die Dimensionen eines zwar irgendwie schwachen und indirekten, aber in seiner Wirkung dennoch unterschätzten Traumas aufweist. Dieses Trauma wirkt wie ein Wiederholungszwang: Auf neue Probleme wird immer wieder mit alten Emotionen reagiert. Das dritte und letzte Kapitel ist nur für die sehr interessierte Leserschaft bestimmt. Das Kapitel wurde im April 2018 als Analyse der damaligen Situation in Ostdeutschland geschrieben und enthält viele Hintergründe, die in den anderen Kapiteln nur angerissen werden. Es wird deutlich, dass die wesentlichen Linien der heutigen Konflikte bereits früher zu ahnen waren.
Dieses Buch liefert keine Antworten. Auch wenn das zweite Kapitel eine Reihe von Abschnitten zum möglichen Umgang mit der Situation enthält, bleibt das Fazit wenig optimistisch. Angesichts der gegenwärtigen Lage in Sachsen steht nicht zu erwarten, dass die Stimmung auf kurze oder mittlere Sicht irgendwie „besser“ wird.
Die Idee zu diesem Buch geht auf ein Gespräch zurück, das ich im Dezember 2021 mit Ulrike Geisler und Bernd Stracke vom Institut B3 in Dresden geführt habe. In dem Gespräch ging es um die Frage, wie sich die aktuelle Situation gerade in Ostsachsen verstehen lässt. Wohl wissend, dass eine psychologische Erklärung der aktuellen Geschehnisse ihre Limitierungen hat, dass man also mit dem Begriff des Traumas nicht alles, aber vielleicht einen wesentlichen Teil der aktuellen Dynamik erklären kann, habe ich im Anschluss an das Gespräch die Kapitel 1 und 2 dieses Buches verfasst und einen älteren Text, der sich bereits mit dem gleichen Thema befasst (Kapitel 3), angefügt. Für Lesermeinungen bin ich dankbar ([email protected]).
Kollm (Quitzdorf am See), im Februar 2022
Jörg Heidig
SACHSEN UND DER „GEFÜHLTE KRIEG“
Meine letzte Reise nach Bosnien war desillusionierend. Dabei war ich schon bei meinen vorangegangenen Reisen einigermaßen ernüchtert. Aber ich war seinerzeit noch nicht ehrlich genug zu mir. Als KONNTE ich nicht glauben, was ich bei meinen neuerlichen Reisen sah, weil ich lieber glauben WOLLTE, was ich seinerzeit im Auslandseinsatz gedacht hatte, als ich nach dem bosnischen Krieg (1992-1995) drei Jahre lang half, das Land wieder aufzubauen.
Nach jenem Krieg gab es dort Hoffnung. Aber was ist aus der Hoffnung geworden? Was passiert, wenn die Hoffnung auf Jahrzehnte hin von einem schmutzigen Polit-Theater regelrecht „totgesessen“ wird?
Das ist Bosnien heute: Ein eigentlich schönes Land, regiert von ebenso korrupten wie nationalistischen Banden, die nur zusammenarbeiten, wenn der internationale Geldsack neue Millionen ins Land spucken möchte. Die Abwanderungsrate der jungen Leute ist hoch, die Geburtenrate marginal. Es ist nur eine Frage von Jahrzehnten, bis...
Ja, was eigentlich?
Das Ganze erinnert mich manchmal an Ostsachsen, wo ich lebe. Es gibt hier ein paar Leute, die an eine positive Zukunft der Gegend glauben. Aber wenn man genau hinsieht: Wenig junge Leute, dafür umso mehr ältere Herren mit schlechter Laune.
Wer will hier leben? Und vor allem: Warum?
Da beißt mich die nasse Katze in den Hintern: Warum lebe ich hier? Weil es schön ist, weil es meine Heimat ist, weil ich es nicht besser weiß? Weil ich an eine positive Zukunft der Region glaube?
Ja, klar: Die Gegend ist schön. Aber die Bedeutung der Dinge ergibt sich aus der Beziehung, die man zu den Dingen hat. Und Fakt ist, dass nur wenige junge Leute eine Beziehung zu dieser Gegend haben wollen. Heimat, so scheint es, ist vor allem eine Sache älterer Herren. Und von noch nicht ganz so alten Menschen, die genau das nicht glauben wollen.
Bosnien ist auch schön. Aber das hilft dem Land nicht. Es kommt kaum vorwärts. Es ist, so schien es mir beim letzten Besuch, tatsächlich lohnenswerter, sich heute Abend zu betrinken, als zu überlegen, was man mittel- oder langfristig mit seinem Leben anstellen könnte. Weil man sich wirklich anstrengen kann und trotzdem nicht weiß, ob daraus etwas wird.
Freilich weiß man das nie so richtig. Aber was ist, wenn man fast flehen muss, damit man einen versicherten Job bekommt? Oder wenn man trotz theoretisch gleicher Chancen in ethnisch getrennte Berufsschulen geschickt wird? Man geht quasi durch das gleiche Schultor und landet in unterschiedlichen Klassen. Das Unterscheidungskriterium? Der Name, der Glaube, der Wohnort.
Sachsen ist von so etwas weit entfernt. Hier gibt es das nicht. Warum soll man das also vergleichen?
Weil das Beispiel Bosnien zeigt, wo wir landen, wenn wir abschottenden, irgendwie „zurückblickenden“ Gedanken freien Lauf lassen. Damit meine ich nicht, dass wir im Krieg landen, damit meine ich, dass sich die schlechte Laune wie Mehltau über das Land legt, bis die Zukunft kaum mehr zu sehen ist und auch keiner mehr hierher ziehen will.
In Sachsen erscheint die Situation zunächst umgekehrt: Das vergiftete Klima entsteht nicht so sehr durch krasse Dummheiten „von oben“, sondern eher durch schlechte Laune „weiter unten“, in der Mitte der Gesellschaft. Aber ganz ähnlich wie Bosnien haben wir eine miese Geburtenrate bei gleichzeitig hoher Abwanderung, und wir haben wenig Zuzug.
Man könnte natürlich den sprichwörtlichen Spieß herumdrehen und mit der aktuellen Stimmung Werbung machen: Man plakatiere im Ruhrgebiet oder in Berlin, dass man nach Sachsen kommen solle, weil Deutschland dort noch „normal“ sei. Yihaa!
Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum sich ein Vergleich lohnt: In Sachsen haben wir Frieden, aber einen „gefühlten Krieg“ in den Herzen mancher wütender Zeitgenossen.
In Bosnien weiß man, was Bürgerkrieg bedeutet, und man hat lange gebraucht, um die direkten Kriegsfolgen hinter sich zu lassen. Es herrscht dort zwar Frieden, viele haben aber trotzdem zu wenig Perspektive, weil das Echo des Krieges in Form jenes verfluchten politischen Possenspiels noch andauert. Man braucht für jedes Jahr Krieg zehn Jahre, um die Schäden zu kompensieren. In Bosnien braucht man deutlich länger.
Während in Bosnien die traumatischen Folgen des Krieges offen liegen und die Leute gern anders leben würden, das aber eben kaum können, sehen wir in Sachsen die Ursachen für den „gefühlten Krieg“ in den Köpfen nicht, weil es kein katastrophales auslösendes Ereignis gab.
Gleichzeitig verhalten sich manche Sachsen so, als wäre gleich Krieg, als seien ein paar Migranten oder das Corona-Virus dergestalt „letzte“ Katastrophen, dass man Haus, Hof und Ruf riskieren müsste, um dagegen vorzugehen.
Man wähnt sich im Krieg, aber das Ganze findet nur affektiv statt. Der ach so kriegerische Faustschlag während einer Demonstration landet aber nicht am Kopf eines „Feindes“, sondern eines Polizisten – der zufällig auch der eigene Nachbar sein könnte.
Wo manche unserer Zeitgenossen „Krieg fühlen“, haben wir es rational „nur“ mit einer Demokratie zu tun, die gerade ihre jahrzehntelang gewohnten Komfortzonen verlassen muss, weil es härter wird... oder wir in Sachsen nur älter werden und uns „irgendwie unterlegen“ fühlen... oder wir gar nicht erst gelernt haben, wie Demokratie eigentlich geht... oder manchen von uns klar geworden ist, dass sie eigentlich gar keine Demokratie wollen.
War 1989 vielleicht doch ein Irrtum? Die meisten von uns wollten raus aus jenem Land namens DDR, wollten etwas anderes, gerade die Sachsen. Jetzt haben wir etwas anderes – mit allen Schwierigkeiten und Widersprüchen. Und nein, es ist gerade nicht einfach, politisch irgendetwas richtig zu machen.