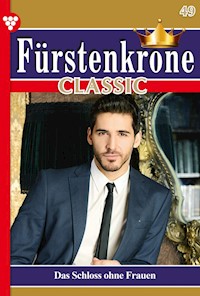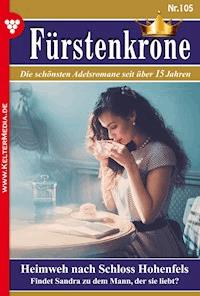8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Heimatkinder Box
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Sichern Sie sich jetzt die Jubiläumsbox - 6 Romane erhalten, nur 5 bezahlen! Die Heimatkinder verkörpern einen neuen Romantypus, der seinesgleichen sucht. Zugleich Liebesroman, Heimatroman, Familienroman – geschildert auf eine bezaubernde, herzerfrischende Weise, wie wir alle sie schon immer ersehnt haben. Während eines Sommerurlaubs lernt der junge Förster Hannes Burger die bildhübsche Städterin Sonja Rosen kennen. Obwohl er seit Langem mit Marett, einem Dirndl aus seinem Dorf, verlobt ist, folgt er der schwarzhaarigen Sonja in die Stadt und verlebt hier eine Zeit unbeschwerten Glücks. Aber dann folgt die Ernüchterung, denn er sieht Sonja an der Seite eines anderen Mannes. Voll Reue kehrt Hannes in die Heimat zurück, fest dazu entschlossen, Marett um Verzeihung und einen neuen Anfang zu bitten. Nur mit ihr, so weiß er jetzt, kann er glücklich werden. Doch kaum ist er zu Hause angekommen, erkennt er, dass er zu lange gewartet hat: Marett hat ihr Jawort einem anderen gegeben … E-Book 29: Die Omi hat kein Geld E-Book 30: Kleiner Bub ganz groß E-Book 31: Habt Mut zur Liebe E-Book 32: Josepha, komm doch wieder! E-Book 33: Mein Kind bekommst du nicht! E-Book 34: Wenn Kinder ein Geheimnis haben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Ähnliche
Inhalt
Die Omi hat kein Geld
Kleiner Bub ganz groß
Habt Mut zur Liebe
Josepha, komm doch wieder!
Mein Kind bekommst du nicht!
Wenn Kinder ein Geheimnis haben
Heimatkinder – Jubiläumsbox 6–
E-Book: 29 - 34
Jutta von Kampen Carola Vorberg Isabell Rohde Franziska Merz Franziska Hofer Kathrin Singer
Die Omi hat kein Geld
… aber Liebe im Überfluss
Roman von Jutta von Kampen
»Dableibm, Mama!«, jammerte das kleine Mädchen, und über seine runden Backen liefen heiße Tränen. Ihre kurzen schwarzen Locken waren von all der Aufregung und dem Kummer verwirrt und verschwitzt, ihr Kopfnäschen rot und sogar die brombeerdunklen Augen waren trüb und verweint! »Net weggehn!«, schluchzte es und klammerte sich an die hübsche junge Frau, die genervt zu ihrem feschen und grinsenden Begleiter hinsah.
Ihr Bruder stand daneben, sein Gesicht unter den weißblonden Stoppelhaaren war blass, und die großen braunen Augen blickten verschreckt. Aber er weinte nicht! Buben weinen nicht, schon gar nicht, wenn sie bald in die Schule kommen!
»Jetzt stell dich net so an, Michen!«, schimpfte die Mutter der beiden ungeduldig. »Ihr fahrt’s doch immer gern zur Oma?!«
»Vielleicht sollten wir sie wenigstens noch in den Bus setzen«, schlug der junge Mann mit stark italienischem Akzent vor.
»Bitte, Mama!«, meldete sich jetzt auch der Bub.
»Jetzt fangt der a no an!«, fuhr sie auf und schob das ungefähr drei Jahre alte Mädchen von sich. »Des dauert no a gute Stund – bis dahin sind wir längst in Italien! Und der Fahrer kennt die Kinder. Der kümmert si schon um sie!«
»Wie du meinst!« Der junge Mann zuckte die Schultern. »Hast du ihm Bescheid gesagt, Magda?«
»Warum machst du des net? Alles hängt an mir!«, explodierte sie jetzt. »Da! Er sitzt drin im Dienstzimmer! Ach was, ich geh rein! Hier wird mir ja doch nur vorgejammert!« Sie verschwand im Bahnhofsgebäude.
»Luigi …« Der Bub fasste die Hand des Italieners an.
Der wendete sich ihm aufmunternd zu.
»Keine Sorge, Girgl. Wir fahren erst, wenn euer Gepäck im Bus verstaut ist und ihr auch drinnen sitzt. Die Oma freut sich bestimmt, wenn ihr kommt!«
Der Girgl nickte. Das glaubte er schon.
»Aber – hat d’ Mami sie angeruf’n? Woaß, dass’ uns abhol’n muass?«
Nein! Das hatte sie nicht. Sie hatte Luigi erklärt, dass sie keine Lust auf eine Absage oder mindestens einen Haufen Vorwürfe haben würde.
»Von unterwegs ruf ma’s an, wann die Kinder scho auf’m Weg sand. Da kann’s dann nimmer ›Na!‹ sag’n!«
Aber das verriet er dem ohnehin verängstigen Buben besser nicht.
»Sobald ihr im Bus sitzt und wir unterwegs sind, erinnern wir sie noch mal!«
Girgl nickte stumm. Aha: Die Mama hatte es vergessen! Oder es auf später verschoben, damit die Oma nicht schimpfen konnte, weil sie mit dem Italiener wegfuhr. Der war zwar immer nett und schenkte ihnen ein Eis –, aber mit der Mama war er auch lieber allein.
Jetzt kam Magda mit dem lachenden Busfahrer heraus.
»So, könnt’s de Kinder net brauchen bei eierm Honeymoon?!« Ohne eine Antwort abzuwarten, packte er den riesigen Koffer und verstaute ihn, den Kinderwagen und die Tüten und Schachteln im Gepäckraum. Dann sperrte er den Bus auf. »Setzt euch glei hinter mi, dann seh i, wann’s was anstellt!« Er lachte wieder freundlich und blinzelte ihnen zu. »Die Oma freit si bestimmt scho! Aber es dauert no a bisserl: I kann net einfach früher wegfahr’n. Es woll’n auch no andre mit!« Und er verzog sich wieder in den Dienstraum.
Girgl nickte stumm, und Michen begann zu weinen.
»Da bleibm, Mama!«
»Des halt i net no a Stund aus!«, erklärte Magda gereizt. »Los! Steigt’s ein! Bussi! Brav sein! Wir hol’n euch, sobald mir a Wohnung g’funden ham!« Damit ergriff sie die Hand ihres Begleiters und zog ihn zu dem schicken Sportwagen, mit dem sie nun in ihre vorgezogenen Flitterwochen fahren wollten.
Luigi legte einen fabelhaften Kavaliersstart hin und drückte grüßend auf die Hupe, Magda drehte sich um und winkte lachend zurück, bis sie um die Ecke bogen.
Michen weinte immer noch, und auch Girgl winkte nicht, sondern sah ihr mit blassem Gesicht hinterher. Hoffentlich vergaß sie nicht, die Oma anzurufen!
*
»Endstation!«, rief der Busfahrer und wendete sich dann freundlich den beiden Kindern zu, die brav und still hinter ihm gesessen hatten. »So, jetzt müsst’s auch aussteig’n! Den Koffer stell i eich an d’ Haltestelln!«
»Aber – die Oma!«, flüsterte Girgl, der weit und breit keine Oma entdecken konnte. Die winkte ihnen doch immer entgegen und lachte und streckte die Arme nach ihnen aus!
Der Fahrer sah sich um.
»Die kimmt glei!«, erwiderte er. Er hatte sich lang genug um di zwoa gekümmert. Net amal zum Trinken hatte die Magda eana woas mitgebm, wo’s heit do so hoaß war! Zum Glück hatte er a Kracherl dabei g’habt.
Girgl stieg allein die hohe Treppe aus dem Bus hinunter, das Michen hob der Fahrer mit Schwung heraus, sie bedankten sich und stellten sich dann neben ihren Koffer und die anderen Gepäckstücke.
»D’ Oma kimmt glei!«, sagte er noch mal, wohl um auch sich zu beruhigen und startete in den Feierabend.
Die Kinder setzten sich auf das Bankerl im Wartehäuschen und warteten.
Aber die Oma kam nicht!
Michen begann wieder zu weinen, und weil er wirklich nicht wusste, was er tun sollte, weinte der Girgl dieses Mal mit.
Die Uhr schlug zwölf, und die Erstklässler kamen aus der Schule. Sie marschierten verwundert, mitleidig und verlegen an den zwei plärrenden Kindern vorbei. Manche kannten sie vom Sehen, aber warum sie da saßen, wussten sie natürlich auch nicht.
Schließlich überwog beim Hansi Breitner, dem Häuslerbuben, die Neugierde.
»Warum schreit’s denn a so?«
Des is a großer Bub! Der geht scho in d’ Schui!, überlegte der Girgl. Vielleicht …
Jetzt kam auch die Angela Fuchs, vom Förster.
»Ihr g’hört’s do der Frau Neuner?«, stellte sie fest.
»Aber d’ Oma holt uns net ab! Di woaß net, dass mir kema!« Der Girgl wischte sich mit der Hand übers Gesicht, dass er ganz grauslich verschmiert aussah. Das Michen sowieso.
Die Angela sah ihn gleichzeitig mitleidig und angewidert an. Außerdem roch das kleine Mädchen so streng …
»Ich sag’s dem Freilein!«, erklärte sie und machte Anstalten, wieder zum Schulhaus zurückzugehen.
Aber es war nicht notwendig.
Teresa Behr, die Grundschullehrerin der ersten Klasse, sechsundzwanzig Jahre jung, blond, mit bernsteinfarbenen Augen, von Kopf bis Fuß bildhübsch und dazu lustig und gescheit, kam auf ihrem Rad daher.
»Was haben wir denn hier?«, rief sie überrascht und hielt an.
Nachdem Hansi und Angela sich um die zwei Unglücksraben gekümmert hatten, waren auch die übrigen Kinder interessiert stehen geblieben. Teresa drängte sich zu dem weinenden und ziemlich schlecht riechenden Michen und dem Girgl, der immer wieder versuchte, tapfer zu sein, durch.
»Ihr gehört doch der Frau Neuner«, stellte sie dann fest.
»Ja! Aber d’ Oma woaß net, dass mir kema, und jetzt hat’s uns net abg’holt!«, schniefte Girgl.
»Oje«, meinte Teresa voller Mitgefühl. Sie war jung genug im Ort, um zu wissen, dass die brave Magdalena Neuner eine ausgesprochen missratene Tochter und diese zwei uneheliche Enkelkinder hatte. Liebe Kinder – aber sie gingen ihr immer im Weg um. »Wisst ihr, wo die Frau Neuner heute arbeitet?«, wendete sie sich an die neugierig herumstehenden Erstklassler.
»I glaub, beim Gansiwirt!« Der Hansi wusste das, weil seine Mama dort putzte und erzählt hatte, dass sie die Neuner-Magdalena dort getroffen habe.
»Gut! Dann bring ich euch jetzt mal dorthin!«, sagte Teresa. Sie lud den schweren Koffer auf ihr Rad und verteilte das übrige Gepäck an die Kinder, die sie neugierig begleiteten. Der Hansi kam ohnehin mit, weil er, wenn die Mama dort putzte, beim Ganswirt was zum Essen bekam.
Dann setzte sie die pausenlos weinende Michen in den Sportwagen – sie schämte sich über ihre volle Hose, aber was sollte sie tun?! – Girgl schob, und so zogen sie alle zum Gasthof ›Zur goldenen Gans‹.
*
Gern kam Magdalena Neuner nicht in den Gasthof ›Zur Goldenen Gans‹, aber leider konnte sie es sich nicht aussuchen, welche Arbeit sie annahm. Sie war gelernte Weißnäherin, und das war heute ein sehr seltener und – selten benötigter Beruf. Sie hatte es bei den Armen Schulschwestern gelernt, ebenso wie das Sticken und Klöppeln, Stricken und Häkeln. Dass die Magdalena nicht gern im Gasthof ›Zur Goldenen Gans‹ arbeitete – dieses Mal war es ohnehin nur zum Flicken –, hatte einen besonderen Grund. Obwohl sie eigentlich auch nicht gern in die ›Alte Post‹, am anderen Ende des Dorfes, ging oder in einen der großen Bauernhöfe.
Am liebsten ging sie in den Pfarrhof, obgleich man dort womöglich noch sparsamer war, aber doch wenigstens freundlich, und ein gutes Essen bekam sie auch. Zudem machte ihr die Arbeit an den schönen Altardecken und kostbaren Messgewändern viel Freude.
Sie achtete nicht auf die aufgeregten Stimmen, die aus dem Treppenhaus bis zu ihr in die Nähstube drangen. Sie war froh, wenn sie in die leidigen Streitereien und Eifersüchteleien der Dorfbewohner nicht mit hineingezogen wurde.
Doch dann hörte sie das Weinen von Kindern –, und da fiel es ihr schon schwerer, die Ohren zu verschließen.
Aber ehe sie noch zu einem Entschluss kam, ob sie nachschauen sollte oder besser nicht, flog die Kammertür auf, und Josefa Angerer, die Wirtin, schoss herein und keifte: »Also, des geht fei net, dass die Bankerten von deiner Schlampen von Tochter hier zu mir ins Haus kema! Was denk’n sich denn die Gäst?! Mir sand a anständigs Haus, und dass du hier was verdeane derfst, hast nur unsrer christlichen Einstellung zu verdank’n!«
Magdalena verstand nicht gleich.
»Wieso? Ich versteh net! Die Kinder sind doch bei der Magda!«
»Ha!«, machte die Wirtin und lachte schrill. »Schee war’s!«
Und da drängte sich auch schon laut weinend der fünfjährige Girgl, seine zweijährige Schwester Michen hinter sich herziehend, an der Wirtin vorbei. Der Girgl ließ die Hand von Michen los und stürzte auf die Magdalena zu: »Oma! Oma! Gell, wir derf’n bei dir bleib’m?«
Das Michen fiel hin, als der Bruder sie losließ, und schrie nun, wenn möglich, noch mehr.
»Jessasmaria!«, stieß Magdalena hervor, sprang auf und nahm das Michen auf den Arm. »Net weinen! Ihr seid’s ja jetzt bei mir!«, versuchte sie, das schluchzende Mädchen zu trösten.
»Ja, und wia soll des jetzt weitagehn?«, fragte die Wirtin empört und stemmte ihre Arme in die ausladenden Hüften.
Das hätte die Magdalena auch gern gewusst. Aber dass sie hier mit den beiden Kindern nicht bleiben konnte, das war ihr natürlich klar.
»Ich bring die zwei jetzt mal heim.«
»Und die Arbeit?! Bevor des net alles in Ordnung ist, kann ich dir nix zahl’n!«, machte ihr die Wirtin sofort klar.
»Natürlich net«, sagte die Magdalena mit einem Seufzer. »Ich hol die restliche Flickarbeit heut Abend ab und mach sie daheim fertig.«
»Aber dass mir koa Dreck hinkommt – mit dene Schratzen!«
Magdalena schluckte ihre Antwort hinunter und sagte nur: »Schon recht.« Dann packte sie ihre Siebensachen zusammen, nahm das Michen wieder auf den Arm und den Girgl an der Hand und stieg mit ihnen vorsichtig die steile Treppe aus dem Dachgeschoss hinunter, wo sich die Kammern der Angestellten und auch die Nähstube befanden.
»Jetzt simma froh, gell, Oma«, sagte der Girgl und seufzte erleichtert. Auch das Michen weinte nicht mehr, sondern lachte ein bisschen und gab der Oma ein feuchtes Busserl auf die Backe.
»Freilich bin ich froh, dass ihr mich besucht!«, sagte Magdalena und erkundigte sich dann: »Wo ist denn die Mama?«
»Mama ist weg!«, sagte Michen und gab der Oma noch ein Busserl.
»Girgl!«, fragte Magdalena mit wachsender Besorgnis. »Was hat die Mama gesagt?«
»Die Mama und der Onkel Luigi sand nach Italien g’fahr’n. Und später fahr’n mir auch!«, berichtete Girgl. »Du woaßt scho, der mit dem guaten Eis! Gelato!«, sagte er dann lachend bayrisch-italienisch und sichtlich sehr stolz.
»Moment …« Einen Augenblick glaubte Magdalena, ihr würde schwindlig werden. Sie blieb stehen, ließ den Girgl los und hielt sich mit einer Hand am Treppengeländer fest. Dann wurde ihr klar, dass sie es sich jetzt nicht leisten konnte, verzweifelt oder schwindlig zu sein. »Sollt ihr mir was ausrichten?«, fragte sie, allerdings mit nur sehr schwacher Hoffnung.
»Die Mama hat dir an Brief g’schrieb’n. Der is im Koffer!«
»Ah ja!« Ein Glück, dass der Girgl so vernünftig war. Mit fünf schon vernünftiger als seine Mutter mit dreiundzwanzig! Ein Kunststück war das freilich nicht! Sie nahm ihn wieder an der Hand und stieg mit den beiden weiter die Treppe hinunter.
Hinter ihr kam die Wirtin schimpfend und jammernd über die Unzuverlässigkeit von Leuten wie der Magdalena und ihrer Schlampentochter.
»Seid’s no da?!«, schimpfte sie, als Magdalena den Riesenkoffer betrachtete, der neben dem Sportwagen aus dritter Hand in der Diele auf sie wartete. Beim Girgl war er aus zweiter Hand, jetzt beim Michen aus dritter! Und sie wagte gar nicht an den lustigen und temperamentvollen Italiener zu denken. Und an ihre Tochter schon zweimal nicht!
»Des geht scho, Oma«, sagte der Girgl aufmunternd »Der Luigi hat den Koffer auf den Wagen gelegt und das Michen draufgesetzt!«
»Hast recht!«, erwiderte Magdalena und lachte ihn an. »Ein Glück, dass ich dich hab’!«
»Seids jetzt bald draußen?!«, fauchte die Wirtin.
Die Tür zur Gaststube hatte sich geöffnet, und das runde Gesicht ihrer Tochter schaute grinsend und schadenfroh heraus. Und auch die Küchentür öffnete sich, und der Wirt erschien in der Diele.
»Di brauch ma hier net!«, fuhr ihn seine Gattin an, und er verschwand ebenso schnell wieder, wie er aufgetaucht war. Dafür schaute jetzt die Köchin heraus und freute sich, dass es jemand anderer als sie war, der jetzt das Fett abbekam.
»Di sand aber bees!«, stellte der Girgl fest, als er neben Magdalena, die den Kinderwagen samt Michen und übrigem Gepäck schob, hertrabte. Er trug die Tasche seiner Oma.
Michen thronte auf dem großen alten Koffer und fand das sehr lustig.
»Oma, sing!«, forderte sie.
»Ich kann jetzt nicht!«, sagte Magdalena und hätte fast zu weinen angefangen. »Später, Michen!«
»Jetzt samma glei da!«, freute sich der Girgl, als sie am Ortsende ankamen. Für ihn war die Welt jetzt wieder in Ordnung, da sie bei der Oma waren!
Auch die Magdalena atmete auf. Ihr war, als hätte sie die Blicke, die sie aus jedem der Höfe verfolgten, im Rücken gespürt.
Was hatte die Magda sich nur wieder gedacht?! Sie hatte doch eine gute Stellung als Kellnerin in der Tölzer Weinstube. Die Besitzer waren ältere Leute. Gerade das hatte Magdalena beruhigt! Ihre Tochter war nämlich ebenso hübsch wie leichtfertig. Es fiel ihr schwer, dies zuzugeben, aber man konnte wirklich nicht anders sagen. Sie war siebzehn gewesen, als der Girgl auf die Welt kam – der Sohn ihres damaligen Arbeitgebers. Natürlich wurde sie von der Frau hinausgeworfen. Aber er war wenigstens so anständig, ihr eine neue Stellung zu besorgen. Mit dem Erfolg, dass sie auch mit dem neuen anbandelte: das Michen war das Ergebnis. Und weil ihr jetziger Arbeitgeber vermutlich zu alt war, hatte sie sich mit dem schwarzlockigen Luigi angefreundet, der nur im Sommer in Tölz eine Eisdiele hatte, im Winterhalbjahr kellnerte er in München.
Aber wieso waren sie jetzt nach Italien gefahren?!
Magdalena war etwas atemlos, als sie den Wagen mit dem schweren Koffer und Michen den kleinen Abhang hinaufschob, auf dem direkt am Waldrand ihr Häusl stand.
»Mei, is hier schee!«, rief der Girgl begeistert wie immer, wenn er die Oma besuchte.
Michen ließ sich vom Koffer herunterplumpsen und rief: »Burle! Burle!«
Und schon kam ein hochbeiniger Dackelmischling aus dem Vorgarten hervorgeschossen, wo er sich gleich neben der Gartentür ein Loch unter dem Zaun durchgebuddelt hatte, und sprang kläffend erst an Magdalena, dann an Girgl und zuletzt an Michen empor, so dass die gleich wieder auf ihrem dicken Windelpopo saß. Aber dieses Mal lachte sie entzückt und ließ sich von Burle das Gesicht abschlecken, bis die Oma Einhalt gebot. Dem machte ihr durchdringender Duft nichts aus!
Inzwischen waren auch die beiden Katzen, Mimi und Mucki, zur Begrüßung erschienen. Sie verhielten sich natürlich zurückhaltender und vornehmer, und rieben sich nur schnurrend an den Beinen von Magdalena und Girgl. Dem Michen wichen sie aus: Es war in seiner überschäumenden Begeisterung noch zu ungeschickt.
Wie sich alle freuten! Am liebsten hätte Magdalena geweint. Obwohl das natürlich dumm war! Aber was dachte sich Magda –, sie hier mit den Kindern alleinzulassen! Wie sollte das gehen mit ihrer Arbeit?!
»Die schönen Bleame!«, rief Girgl bewundernd, und Michen tauchte sein Knopfnäschen tief in eine dunkelrote Rose. »Mhm!«
Das Häuschen war winzig, aber mit viel Liebe eingerichtet. Wenn man zur Haustür hereinkam, waren links die Küche und rechts die gute Stube. Neben der Küche ging eine Treppe, so steil wie eine Hühnerleiter, in das Dachgeschoss hinauf. Hier waren die Zimmerdecken alle schräg. Es gab eine größere Kammer und eine kleinere. Hier hatte Magdalena mit ihrer Mutter geschlafen, und später sie mit ihrer Tochter Magda. Außerdem gab es noch ein winziges Bad. Es war wirklich sehr bescheiden.
Aber das alles fiel nicht ins Gewicht, denn der Blick aus jedem der kleinen Fenster war wie ein wunderschönes Bild. Nach Süden schaute man in das hübsche, alte Dorf Hohenried mit der von einem Zwiebelturm gekrönten Kirche, nach Norden sah man in den prächtigen Mischwald, aus dem im Winter die Rehe, Hirsche und Hasen bis an den Gartenzaun kamen, nach Westen sah man über weite Wiesen und Weiden und nach Osten auf die Bergkette, welche das Hohenrieder Tal vor den kalten Winden beschützte.
Das Häusl mit dem kleinen Garten hatte Magdalenas Mutter von deren Vater bekommen. Sie hatte in einem feinen Haushalt gedient, und der Sohn des Hauses hatte das hübsche Mädchen verführt. So fein, dass er sie geheiratet hatte, war er allerdings nicht gewesen! Immerhin hatte er dieses Haus, eine Jagdhütte der Familie, ihr überschrieben und die Ausbildung seiner Tochter bezahlt.
Kennengelernt hatte Magdalena ihren Vater nie. Sie hatte ihn eigentlich auch nie vermisst. Sie und ihre Mutter lebten brav und bescheiden. Sie arbeiteten beide im Gasthof zur Goldenen Gans als Bedienung, und sie verdiente zusätzlich als Weißnäherin.
Und dann passierte Magdalena das Gleiche wie ihrer Mutter: Es liegt halt in der Familie!, sagten die Hohenrieder spöttisch. Der Jungwirt vergaffte sich in das bildhübsche Madl, schlank und rank, wie sie noch heute war, mit einem feinen G’sichterl, großen himmelblauen Augen und wunderschönem goldblonden Zöpfen, die sie jetzt freilich in einem großen Knoten trug. Aber als sie schwanger wurde, da wollte er nix mehr von ihr wissen. Die Josefa vom Waldhof konnte ihr zwar nicht das Wasser reichen, was das Aussehen anging, dafür aber brachte sie ein Bankkonto mit in die Ehe, das alle Schönheitsfehlerl vergessen ließ.
Dass die beiden auch weiterhin in der goldenen Gans arbeiteten, war, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Immerhin blieb ihnen das Häusl, und der damalige Jungwirt und jetzige Wirt steckte ihnen heimlich hin und wieder was zu. Vielleicht hoffte er nach dem Tod der Mutter, dass die Magdalena ihn über den Besen von Ehefrau, den er sich aus Geldgier angetan hatte, hinwegtrösten würde. Aber daraus wurde nichts. Genau wie ihre Mutter lebte sie braver als die meisten übrigen Dorfbewohner.
Nur die Magda, die war halt so ganz aus der Art geschlagen! Kein bisserl wie Mutter und Großmutter – sondern genauso, wie es die Dorfbewohner auch diesen beiden so gern und so grundlos nachsagten.
Das bewies auch wieder einmal der Brief, den sie für ihre Mutter in den Koffer gelegt hatte.
Hi, Mamilein! Du bist doch so lieb und kümmerst Dich um die zwei, bis i wieder heimkomm. Luigi meint, i soll sei Familie kennenlernen, bevor wir heiratn. I weiß net genau, wann i widerkomm, Bussi euch 3.
Eure Magda und Mama.
Nicht nur wegen der Rechtschreibfehler! Sie wusste schließlich, oder sollte es wissen, aber wahrscheinlich hatte sie es in ihrer Kopflosigkeit wieder vergessen oder nicht dran gedacht, dass ihre Mutter vor Beginn der Sommersaison besonders viel zu tun hatte. Sie musste die Bett- und Tischwäsche der beiden Gasthöfe durchsehen, flicken, was sich noch lohnte, und eventuell neue nähen.
Und wie sollte das mit den beiden Kindern gehen, zumal sie Michen noch nicht einmal in den Kindergarten geben konnte, weil sie nicht sauber war. Wahrscheinlich hoffte Magda, dass sie das bei der Oma lernte …
Aber weil Magdalena die beiden Kinder heiß und innig liebte und zudem noch schrecklich Mitleid mit ihnen hatte, weil sie keinen Vater hatten und ihrer Mutter nur im Weg umgingen, schob sie diese Überlegungen beiseite und beschloss, sich über ihren Besuch zu freuen.
Irgendwie würde es schon gehen!
Zum Glück war sie ja keine uralte Oma von siebzig und mehr Jahren! Sie war Anfang vierzig, und weil sie schlank wie ein junges Mädchen war, wirkte sie sogar noch jünger. Wenn die Schwierigkeiten des Lebens ihr vorzeitig ein paar graue Haare beschert hatten, so gaben diese dem ursprünglichen Goldblond nur einen aparten Silberschimmer. Das Blau ihrer Augen war noch immer so klar wie vor zwanzig Jahren, und ihre Zähne waren noch genauso weiß und gesund, und ihr hübscher Mund – ja, es war nicht nur der Ganswirt, der bedauernd an früher dachte und ob er nicht doch die falsche Braut gewählt hatte!
Die Hohenrieder Damen und auch die aus den benachbarten Weilern und nicht wenige aus den Dörfern rund um Lenggries fanden es ungerecht vom Herrgott, dass er an einem ›schlechten Mensch‹, wie sie die brave Magdalena aus Neid bezeichneten, die Jahre so spurlos vorübergehen ließ. Während sie selbst sehr wohlhabend und imposant, oder auch mager und angsteinflößend aussahen.
Dass die Magdalena noch immer so jugendlich wirkte, lag wahrscheinlich auch daran, dass sie einfach keine Zeit fand, über das Altwerden oder Jungbleiben nachzudenken. Sie hatte andere Sorgen.
»Was schreibt denn die Mama?«, erkundigte sich der Girgl. Sie strich ihm über sein kurz geschnittenes blondes Haar. Er schlug ganz in ihre Familie, nur hatte er die braunen Augen seines Vaters geerbt.
»Sie schickt uns allen viele Bussis, aber sie weiß noch nicht genau, wann sie wiederkommt«, gab sie zur Antwort.
»Des macht nix!«, fand der Girgl, der eigentlich Georg hieß. »Mir sand gern bei der Oma, gell, Michen?!«
»Ja!«, piepste das Michen, das auf den schönen Namen Maria getauft war, und zog die gerade vorbeistreichende Mimi am Schwanz, um sie festzuhalten. Die Mimi miaute protestierend, und der Girgl befreite sie vom Zugriff der kleinen Schwester.
Ein Glück, dass alle drei Tiere so brav und geduldig waren!
»Ich frei mich auch, dass ihr da seid!«, versicherte Magdalena und zog die beiden an sich. Es wurde ja Sommer! Irgendwie würde es schon gehen!
*
Es ging sogar erstaunlich gut.
Der Anfang, bis Magdalena mit ihrer Arbeit für die Ganswirtin fertig war, war zwar etwas kompliziert und mühsam, weil sie nur abends und nachts arbeiten konnte. Die Josefa Angerer war nicht bereit zu erlauben, dass sie die Kinder mitbrachte. Aber dann ließ der brave alte Pfarrer Gottlieb Brenner seine geschwätzige Haushälterin Annamirl nachschauen, ob sie nicht irgendwelche Näharbeiten hätten, und weil er neben ihr stand, als sie Kasten und Schränke und Truhen durchsuchte, fand sich eine ganze Menge.
Daraufhin raffte er sich zu einem der ihm vom Arzt dringend verordneten Spaziergänge auf und besuchte die Magdalena in ihrem Häusl am westlichen Ende von Hohenried.
»Ja, Herr Pfarrer! Grüß Gott! Wie schön, dass Sie uns die Ehre geben!«, begrüßte sie ihn überrascht und herzlich. »Darf ich Ihnen was anbieten?«
»Ein Glas Wasser!«, schnaufte der Hochwürdige. Er war ziemlich beleibt, was daran lag, dass er von der Verwandtschaft auf dem Waldhof sehr gut und kalorienhaltig versorgt wurde. Denn solange er noch im Pfarrhof seinen geistlichen Aufgaben nachgehen konnte, waren sie nicht wegen des allgemeinen Ansehens verpflichtet, ihn zu sich zu holen. Schließlich war er ja ein jüngerer Bruder des Großvaters selig, des Mitbegründers des jetzigen Wohlstands des Waldhofes. Und sich dem Gerede der Mitmenschen mehr als unbedingt notwendig aussetzen – das mochte keiner.
Natürlich brachte die Magdalena ihm nicht nur ein Wasser, sondern einen selbst eingeweckten Obstsaft aus den Beeren im rückwärtigen Teil ihres Gartens. Dann rief sie den Girgl und die Michen, die im Sandhaufen mit viel Wasser eine Burg bauten.
»So groß seid’s ihr schon«, bewunderte der alte Pfarrer die zwei, als sie schmutzig und fröhlich ihm die Hand reichten. »Der Georg und die Maria!«
»I heiß Michen!«, verbesserte ihn die prompt, und er lachte.
»Freilich, bis du a richtige Maria bist, dauert es noch a bisserl.«
Dann fragte er die Magdalena nach ihrer Tochter. Und weil die nur seufzte, antwortete der Girgl für sie: »Die Mama is mit dem Luigi nach Italien! Und später derfn mir zwoa auch hinfahr’n!«
»So, so«, sagte der Herr Pfarrer und fragte nicht weiter. Dann erkundigte er sich, ob die Magdalena in den nächsten Tagen Zeit hätte, weil sich im Pfarrhof so viel angesammelt hätte …
»Gern komm ich, Hochwürden, des wissen S’ doch!«, rief sie und schaute dann die zwei Kinder an.
»Es ist halt …«
»Ja, die bringen S’ nur mit, Magdalena. Freili können S’ die net allein lassen!«
»Und der Burle?« Girgl legte den Arm um den in der sommerlichen Hitze heftig hechelnden Hund.
»Der is auch eingeladen!«, lachte der Pfarrer. Er hätte selbst gern einen Hund. Aber sein Hausdrachen erlaubte es nicht. Nur in diesem besonderen Fall konnte sie schlecht etwas sagen. Das wäre unchristlich.
Seitdem arbeitete die Magdalena im Pfarrhof, die Kinder spielten in dem schönen großen Pfarrgarten, und der Burle lag im Schatten der Fliederbüsche und hoffte, dass der große kastrierte Kater Butzi der Haushälterin vorbeikam, damit er ihn jagen konnte.
Heute Mittag hatte es wunderbare Dampfnudeln mit ganz süßer, dicker Vanillesoße gegeben. Es war nämlich Freitag.
Der Herr Pfarrer Brenner hatte sich nach dem Essen in sein Studierzimmer zurückgezogen, um die Predigt für Sonntag vorzubereiten. Doch es war so sommerlich warm und die Fliegen summten so einschläfernd, dass er den Herrn Jesus, der von dem großen Kruzifix über dem Schreibtisch traurig auf ihn herabschaute, um Verzeihung bat und sich erst einmal auf das große Sofa legte.
Die Annamirl hatte zuerst noch in der Küche herumgefuhrwerkt, recht laut, weil sie es immer fuchste, wenn die Magdalena kam und jetzt auch noch die Bambsen von ihrer Schlampentochter mitbrachte. Von dem Hundsvieh ganz zu schweigen. Doch dann hatte auch sie sich in ihre Kammer verzogen.
Das Michen war auf dem Liegestuhl im Garten eingeschlafen, erschöpft von dem vielen guten Essen. Neben ihr lag schnurrend der wohlgenährte Butzi, den Burle, der mit dem Girgl zusammen ein Bilderbuch anschaute, scharf im Auge behaltend.
Nur die Magdalena ruhte nicht. Sie saß in einem der vielen leer stehenden Zimmer des großen Pfarrhofs über ihrer Arbeit und dankte dem Himmel, dass der nette Pfarrer Brenner ihr erlaubte, die Kinder mitzubringen. Von Zeit zu Zeit trat sie ans Fenster und schaute hinunter in den Garten, ob da auch alles in Ordnung war.
Für die nächste Zeit hatte sie hier genug zu tun! Bei den über hundert Jahre alten Altartüchern löste sich auf Grund der modernen scharfen Waschmittel die kunstvolle Stickerei auf, und sie musste sie nacharbeiten. Außerdem verstand sie, brüchige Stellen so fein zu stopfen, dass man es nicht einmal mit einem Vergrößerungsglas erkennen konnte. Die Arbeit hier hätte ihr auch ohne das wahrhaft christliche Verhalten des alten Geistlichen Freude gemacht.
Sie hörte, dass es an der Haustür läutete, und bedauerte, dass er in seinem Mittagsschlaf gestört wurde. Schimpfend stieg die Annamirl die Treppe hinunter: »So was Rücksichtsloses! Die wissen doch, dass der Hochwürdige nimmer der Jüngste is mit seine achtzig!«
Magdalena schmunzelte vor sich hin.
Dann hörte sie einen schrillen Aufschrei, dann trampelten mehrere Leute – dem Schritt nach Mannsbilder – die Treppe herauf, und dann riss die Annamirl die Kammertür auf.
»Mei, Magdalena! So a Unglück!«, schrie sie. »Da! Die kema zu dir!«
In der Tür standen mit unglücklichen Gesichtern der dicke Dorfpolizist Robert Ausmann und ein jüngerer Kollege, der vermutlich aus Lenggries angereist war.
»Sand Sie die Magdalena Neuner?«, fragte Ausmann, obwohl er sie seit Kindesbeinen kannte.
»Ja, um Himmels willen, was ist denn?«, flüsterte Magdalena, und alles Blut strömte ihr zum Herzen.
»Wir müssen Ihnen eine traurige Mitteilung machen«, nahm der jüngere Beamte das Wort. »Heut Früh ist auf dem Revier in Lenggries die Nachricht eingegangen, dass die Frau Magda Neuner, dreiundzwanzig Jahre alt, Wohnsitz hier in Hohenried, bei einem Autounfall in der Nähe von Florenz ums Leben gekommen ist. Sie sind die Mutter?«
Magdalena brachte keinen Ton heraus, mühsam nickte sie.
»Hier, die Unterlagen. Die brauchen Sie für die Beerdigung. Herzliches Beileid!«
»Mei, Magdalena, es tuat mir echt leid!«, sagte der Dorfpolizist und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Heiß war ihm – nicht nur wegen der sommerlichen Temperatur.
»Dank schön«, flüsterte sie und dachte: Girgl! Michen! Und: Du warst doch noch so jung, Magda! Und dann kamen ihr endlich die Tränen.
Die beiden Polizisten zogen sich zurück, froh, die unangenehme Aufgabe erledigt zu haben. Auf dem Weg zur Haustür begegnete ihnen der Pfarrer, den der ungewohnte Lärm aufgeschreckt hatte.
»Jessasmarendjosef!«, stieß er hervor, als er hörte, was passiert war, und bekreuzigte sich gleich mehrmals. »Der Herr gebe ihr die ewige Ruh! Und dem Italiener auch. Mei, die arme Magdalena! Und die zwei Kinder … Wo sie’s eh so schwer hat!«
*
Die Überführung wäre zu teuer gekommen, deshalb wurde die leichtfertige Magda auf dem gleichen Friedhof in Italien beerdigt wie ihre letzte Liebe, der fesche Luigi.
Wahrscheinlich wär ihr das sowieso am liebsten gewesen, tröstete sich Magdalena.
Aber weil sie nicht wollte, dass die Kinder ganz ihre Mutter vergaßen, stellte sie im Blumengarten ein schönes Marterl auf: ein Holzkreuz mit einem Blechdach, damit das Foto von der Magda vor Regen und Schnee geschützt war. Im Sommer blühte es hier sowieso rundherum. Und in der schlechten Jahreszeit würde sie mit den Kindern einen Daxenkranz flechten und an das Kreuz hängen.
Jeden Sonntag ging sie mit den Kindern zum Marterl, und dann beteten sie zusammen ein Vaterunser und ein Gegrüßet seist du, Maria.
Das heißt: Sie und der Girgl beteten. Das Michen hörte nur zu. Mehr konnte man von ihr auch nicht verlangen.
Einmal, es ging auf Weihnachten zu, fragte das Michen…
»Kimt die Mama mit dem Christkind?«
Die Magdalena schluckte vor Schreck und wusste nicht, was antworten.
»Des is net so einfach«, vermutete der Girgl, und dann schauten beide die Oma an und erwarteten eine genauere Auskunft.
»Die Mama is jetzt oben im Himmel, beim lieben Gott und die Engerl«, begann die und hoffte auf eine Eingebung. »Und von dort oben schaut sie runter und passt auf, dass euch nix passiert!«
»Aber – mir ham do an Schutzengel!«, erinnerte der Girgl sie.
»Ja. Der passt am Tag auf!«, erklärte Magdalena. »Und nachts, da passt die Mama auf!«
»Und du moanst, dass sie da Zeit hat?«, zweifelte der Girgl, der noch in Erinnerung hatte, dass die Mama die Abende und oft auch Nächte anderswo zu tun hatte. Auf alle Fälle nicht bei ihren Kindern.
»Jetzt scho«, erwiderte Magdalena und musste bei allem Kummer ein wenig lachen.
Was für ein Glück bei allem Unglück, dass sie die beiden Kinder hatte! Und die Kinder sie! Eigentlich lebten sie doch recht gut in dem kleinen Häusl. Und mit der Hilfe vom Himmelvater würde es auch gut weiter gehen.
*
Aber auch wenn der nette alte Pfarrer Brenner sie dieses Mal ungewohnt großzügig bezahlte – schon auch, weil es auf Weihnachten zuging –, wusste Magdalena oft nicht, wo sie das Geld fürs tägliche Leben herbringen sollte. Auf dem Sozialamt erklärte man ihr, dass sie als Haus- und Grundbesitzerin keine Ansprüche stellen könnte, und was die Alimente der Väter ihrer Enkel anging: ihre Tochter habe sich ungeschickterweise jeweils mit einer größeren Summe abfinden lassen, und wo die geblieben wäre, könnten sie ihr leider nicht sagen.
Man behandelte die arme Magdalena alles andere als freundlich. Und sie war verzweifelt, weil sie nicht zu Unrecht annahm, dass es ihren beiden Enkeln genauso ihr Leben lang anhängen würde wie ihr selbst, dass sie unehelich geboren waren. Obwohl die Kinder dafür wirklich nichts konnten.
Es zeigte sich ja heute schon im Dorf, dass man die beiden ausgrenzte: Die Bauernkinder durften nicht mit ihnen spielen und, die Kleinbauern- und Arbeitskinder machten es ihnen nach, um ihrerseits nicht ausgeschlossen zu werden.
Dem Michen machte das nix aus: Sie war noch mit der Oma und den Haustieren völlig zufrieden. Aber der Girgl stand oft traurig am Rand des Sportplatzes hinter der Schule und sah zu, wie die Buben am Nachmittag dort Fußball spielten.
Da war es kein Ersatz, dass die Oma mit ihnen einen Schneemann baute und sogar eine Schneeballschlacht machte, als über Nacht der Winter in dem Bergtal einzog, mit Unmengen Schnee und riesigen Eiszapfen, die von den Dachtraufen herunterhingen. Das Michen quietschte vor Vergnügen, aber der Girgl blieb ernst. Er hätte lieber mit den Dorfbuben gespielt.
Die Magdalena war mindestens so unglücklich wie der Girgl. Deshalb dachte sie sich etwas ganz besonderes für Weihnachten aus.
Am Heiligen Abend stellte sie den beiden große Teller mit Weihnachtsplatzerl an das Kuchlfenster, von dem aus man besonders gut auf die Straße hinausschauen konnte, bis zum Dorfplatz, wo vor der Kirche der wunderbare große Christbaum stand, geschmückt mit unzähligen Kerzen.
»Von da aus könnt’s genau sehn, wann’s Christkindl kommt oder der Nikolaus oder a Engerl – wen’s vom Himmel halt schicken!«, sagte sie. »I bin glei wieder da!«
Sie zog eine warme Jacke über und lief durch die rückwärtige Tür hinaus zum Geräteschuppen.
Drinnen in der warmen Kuchl drückten sich die Kinder die Nasen am Fenster platt. Schön war’s draußen mit den Schneeflocken, durch die man wie durch einen Schleier den leuchtenden Christbaum sehen konnte.
»Da! Schaug!«, rief Michen plötzlich.
Wahrhaftig: Eine große Sternschnuppe fiel vom Himmel, und es sah aus, als würde sie genau bei ihnen im Garten landen.
»Des war’s Christkind! Jetzt is kema!«, schrie auch Girgl ganz aufgeregt. Sie sprangen von den Stühlen, die ihnen die Oma ans Fenster gerückt hatte, und wollten hinauslaufen. Doch genau in dem Moment kam die Oma herein.
»Hast es g’sehn?!«, riefen sie aufgeregt. »A Licht is vom Himmel g’fallen!«
»Freilich hab ich’s g’sehn!«, erwiderte Magdalene mit Tränen in den Augen. »Deswegen bin ich doch hier. Kommt’s! Schnell, zieh ma was über, damit ihr net krank werd’t!«
Sie schlüpften in ihre Winterjacken und Stiefel und setzten warme Pudelmützen auf. Die Oma nahm an jede Hand ein Kind, und so gingen sie zusammen durch die rückwärtige Tür in den Garten. Der Burle und die zwei Katzen durften auch mit hinaus und die Bescherung miterleben.
»Mei!«, flüsterte der Girgl ganz ergriffen. »Is des schee!« Das Michen sagte gar nix.
»I glaub«, sagte Magdalena mit zitternder Stimme. »I glaub, des hat uns die Mama g’schickt!«
»Ja! Ja! Ganz bestimmt!« Der Girgl nickte eifrig. »Dürf ma jetzat hingeh?!«
»Aber freilich«, sagte die Oma, und langsam stapften sie durch den Schnee zu dem Marterl hin.
Vor dem Holzkreuz stand ein kleiner Tannenbaum, auf dem viele bunte Kerzen brannten. An den Zweigen hingen glitzernde Kugeln und viele wunderbare Süßigkeiten, viel schönere, als es im Kramerladen gab! Und garantiert schmeckten sie auch viel besser. Um den Christbaum herum lagen eine Menge Packerl. Alle in schönes Papier gewickelt und mit goldenen und silbernen Bändern verschnürt.
»So vui!«, staunte der Girgl.
Das Michen wollte gleich ein Packerl aufreißen, aber die Oma hielt sie zurück.
»Noch net! Jetzt müssen wir uns erst bedanken!«, und sie stimmte das alte Weihnachtslied an: »Stille Nacht, heilige Nacht!« Der Girgl sang schon ganz richtig mit, und auch das Michen konnte ein paar Worte mitsingen.
»Des is ja a Schlitten!«, schrie der Girgl am Ende des Liedes. So viele Packerl lagen auf dem, dass man ihn fast nicht gesehen hätte! »Mei! A Schlitten!«
»A Schlitten!«, jauchzte auch das Michen.
Dann hielt die beiden nix mehr. Sie rissen die Packerl auf: Wollfäustling und Pullover und Strickjacken und warme Socken – lauter schöne bunte Sachen und alles ganz neu!
Mit am schönsten aber war ein großes dickes Märchenbuch mit vielen bunten Bildern. Das war nicht mehr ganz neu, doch das fiel den beiden nicht auf.
»Da les ich euch jetzt im Haus was vor«, versprach die Oma.
»Und der Christbaum?«
»Den nehmen wir natürlich auch mit rein!«
Der Girgl zog den Schlitten mit den vielen Geschenken, das Michen sammelte die bunten Papiere und Bänder auf – zumindest probierte sie es! – und die Oma trug den kleinen Baum, der gescheiterweise von den Engerln in einen Ständer gesteckt worden war, so dass er auch im Zimmer net umfiel.
Zum Abendessen gab es heiße Schokolade und so viele Platzerl, wie man nur essen konnte. Jedes Kind durfte sich eine Geschichte aussuchen. Der Girgl wollte die vom tapferen Schneiderlein hören und das Michen eine, in der das Christkind vorkam.
So ein wunderschönes Weihnachtsfest!
Die Kinder konnten nicht verstehen, weshalb der Oma immer wieder die Tränen kamen.
*
Eigentlich konnten sich die magere Genoveva Richter, die Wirtin von der Alten Post, und die dicke Josefa Angerer, die Ganswirtin, nicht ausstehen. Aber wenn es drum ging, jemanden auszurichten, dann waren die zwei ein Herz und eine Seele. Jetzt standen sie beieinander an der Treppe, die zum Friedhof hinaufführte, dem Gottesacker, in dessen Mitte die Kirche lag.
Mit scharfen Augen kontrollierten sie, wer kam und wer sich wieder einmal vor dem Gottesdienst drückte.
Die Glocken läuteten und luden feierlich zur Mitternachtsmette ein. Der Himmel war wie dunkelblauer Samt, und die Sterne glitzerten und funkelten wie unzählige Diamanten. Es war eisig kalt. Dick vermummt trafen die Kirchgänger ein, die Hohenrieder und auch die aus dem umgebenden Weilern. Ob das Wetter hielt? Oder ob bis zum Ende der Mette es wieder geschneit hatte, so dass man womöglich an einem steilen Bergweg mit dem Wagen hängen blieb?
»Da schaug, Genoveva! Der Fuchs, der Förster kommt auch mit seiner Tant und dem Madl«, stellte die Josefa fest.
»Der kommt doch bloß wegen der Behr, der Lehrerin«, meinte die Postwirtin gehässig.
»Ja, mit de Lehrerinnen hamma koa Glück. I bin bloß froh, dass die Kathi mit der Schul fertig is.«
»Des Freilein Seifert war ja ganz nett, damals, als unsre Kinder in d’ Schui gangen sand. Aber jetzat – gehörat sie eigentli in d’ Rent!«
»So is. Da schaug, da kommt’s mit der Neuen!«
Doch das interessierte die Postwirtin im Moment nicht. »Aber wen i nirgendswo seh, des is die Magdalena. Net amal in d’ Weihnachtsmett’n geht’s! Es ist echt a Schand!«
»Was kannst von der erwart’n«, meinte die Josefa verächtlich.
»Sie kann doch die kleine Michen nicht allein zu Hause lassen!«, mischte sich ungebeten die Grundschullehrerin Teresa ein, welche die letzten Worte der beiden mitbekommen hatte.
»Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!«, erwiderte die Genovea Richter spitz.
»Hätten Sie ihr jemanden zum Aufpassen für die Kinder geschickt?«, gab Teresa hitzig zurück. Dieses Giften, wo die brave Frau Neuner es ohnehin nicht leicht hatte!
Da nahm sie jemand beim Arm und sagte vergnügt: »Frohe und friedliche Weihnachten, meine Damen!«, und zog sie mit sich in die Kirche.
»Ausnahmsweise haben Sie recht«, gab Teresa zu und lachte den Diplom-Forstwirt Rasso Fuchs an. »Wenigstens in der Heiligen Nacht sollte man sich nicht streiten. Auch nicht, wenn die anderen so bös daherreden!«
*
Es waren nicht viele, die es gut mit der Magdalena Neuner und ihren Enkeln meinten. Dazu war sie viel zu brav und hübsch und bescheiden. Das konnte es doch einfach net geben!
Gut meinten es der alte Pfarrer, die junge Lehrerin und auch die Förster Fuchs und seine Tante. Aber die gehörten nicht so ganz zu der Dorfgemeinschaft dazu. Deshalb traute sich auch die Angela hin und wieder, mit dem Girgl und dem Michen zu spielen. Das freute die beiden, auch den Girgl. Obwohl sie ja bloß a Madl war.
Dann gab es noch einige, die neutral waren, sich nicht einmischen wollten, wie der Dorfpolizist, die Lehrerfamilie Pöschl und noch ein paar wie zum Beispiel der Ganswirt, der nach dem Tod von der Magda, weil er glaubte, die Magdalena trösten zu müssen, weil er schließlich an der kurzen Existenz von der Magda mitschuldig war, so zusammengestaucht worden war, dass er sich jetzt net amal mehr getraute, in der Kirch auch nur in ihre Richtung zu schauen.
Es war nicht zu übersehen: seit die Kinder der armen Magda im Dorf waren, machte man es der Magdalena noch schwerer.
Es ging auf Ostern zu. Im Pfarrhof gab es schon seit längerer Zeit beim besten Willen nix mehr zum Nähen oder Flicken. Auch die Tante Rosa Fuchs fand nix mehr, weil die Magdalena auch noch so flink war und die Rosa bis vor Kurzem alles selber gerichtet hatte. Bei der Lehrerin Teresa Behr fand sich sowieso nix. Die war ja kaum ein Jahr in Hohenried, und ein richtiger Haushalt war es auch nicht.
Immer wieder schaute die Magdalena in ihr Sparbuch, aber es geschah einfach kein Wunder: Es blieb leer.
Anschreiben bei der Kramerin – unmöglich! Also nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und suchte den Herrn Pfarrer auf. Die Kinder blieben daheim, vielleicht kam später die Angela vorbei, wenn sie mit den Hausaufgaben fertig war.
»Mei, Magdalena!«, begrüßte Pfarrer Brenner sie und ahnte nichts Gutes. »Bring uns an Kaffee und an Zopf«, wendete er sich dann an die Annamirl, die abwartend in der Tür zu seiner Schreibstube stehen geblieben war. »Und dann lass di net länger von deiner Arbeit abhalten!«
Beleidigt legte die Annamirl daraufhin ein ganz dünn geschnittenes Stück Zopf auf den Teller von der Magdalena und ein kaum dickeres auf den vom Hochwürden.
Ungläubig, wie weiland der heilige Thomas, schaute der auf seinen Teller.
»Was soll denn das sei? Glei bringst den ganzen Hefezopf rein und a Marmalad und a Butter auch noch.«
»Des braucht’s do net«, murmelte Magdalena verlegen.
»Und wie s’ es braucht!«, widersprach ihr der Pfarrer. »Und was übrig bleibt, des bringst dem Girgl und dem Michen mit. Keine Widerrede!« Und er schlug mit der Hand auf den Tisch, dass das Geschirr gefährlich tanzte und die Annamirl ganz erschrocken zusammenfuhr.
»Sand’s alle recht ekelhaft?«, fragte er nach einer Weile freundlich, weil im Gegensatz zu ihm selbst die Magdalena kaum einen Bissen hinunterbrachte und nur hin und wieder einen kleinen Schluck Kaffee trank.
Sie nickte und schluckte, dieses Mal an ihren Tränen.
»Ja, ja. Da tun’s alle so christlich und dann sand’s so beinhart!«, seufzte er.
»I – hab fast gar keine Arbeit mehr und i weiß einfach net, wie’s weitergehn soll«, flüsterte sie und wagte nicht, ihn anzuschauen. »Und jetzt kommt der Girgl doch in d’ Schul und da braucht er neue Kleider und die teuren Schulsachen …«
»Mei«, sagte der Geistliche wieder und seufzte gleich noch mal, »ich bin ja eigentli schon längst in der Rent. Mich gibt’s ja gar nimmer – eigentli. I bin ja bloß noch da, weil ich mir leisten kann, alles umsonst zu machen, die ganze Arbeit. Du weißt schon: weil mei Familie halt auf’m Waldhof sitzt!«
Die Magdalene nickte. Natürlich wusste sie es.
»Aber vielleicht, Hochwürden, wenn Sie jemanden wüssten, der eine Arbeit für mich hat?«
»Mit’m Fuchs könnt i mal reden«, dachte der Pfarrer laut. »Der hat do an guten Draht zum Grafen …, und ja!« Sein dickes gutmütiges Gesicht leuchtete auf: »Ich hab’s! Mit den Damen von unserem katholischen Frauenbund!«
Magdalena sah ihn ganz entsetzt an.
»Na, na, keine Sorg! Ich weiß schon, was du meinst. Ich wird es ihnen als Fastenopfer aufreden: das sie als gute Christenmenschen verpflichtet sind, den Notleidenden zu helfen! Da können’s dann net aus. Wart nur ab!«
Er war voller Tatendrang und konnte es kaum erwarten, die beiden Vorsitzenden vom Verein, die Ganswirtin und die Postwirtin, aufzusuchen.
Des waren vielleicht zwei Weiber! Sie hatten sich net einigen können, wer die 1. und die 2. Vorsitzende werden sollte, also hatte er damals einfach bestimmt, dass es zwei 1. Vorsitzende gab! Ja, damals! Da war er noch flotte siebzig gewesen und offiziell in Amt und Würden.
Er packte der Magdalena den ganzen Zopf ein und die Butter und die Marmelad auch noch und schob sie höchst befriedigt über seinen Einfall in bester Laune zum Pfarrhof hinaus.
Nicht ganz so frohgemut machte sie sich auf den Heimweg. Aber immerhin brachte sie ihren beiden Herzerln etwas Gutes zum Essen mit!
*
Eine außerordentliche Versammlung? Natürlich waren alle neugierig, was es geben würde.
Aber dann …
Die Damen vom Katholischen Frauenbund hörten sich mit empörten Gesichtern, bleiern schweigend, die Worte des geistlichen Herren an.
»Also, meine Damen? Was is?«
Schweigen.
»Vielleicht sollt ma beten, damit der Heilige Geist uns was eingibt!«, schlug er nicht ganz ohnen Bosheit vor.
»Uns fallt scho was ei!«, erwiderte die Josefa Angerer giftig.
»Aber halt net jetzt glei«, fügte die Genoveva Richter hinzu.
Pfarrer Brenner wuchtete sich aus dem Sessel hoch. Wahrscheinlich war es besser, wenn er die Damen unter sich ließ.
»Also, ich erwart euer Nachricht!«, sagte er und verließ den Gasthof zur Alten Post. Die Sitzungen des Vereins wurden nämlich immer abwechselnd in einem der Gasthöfe abgehalten, bei Kaffee und Kuchen. Selbstverständlich musste eine jede zahlen. Aber das konnten sie alle. Denn Mitglieder waren nur die ›Besseren‹ aus dem Dorf.
Und jetzt ging es los!
»Was der sich einbild’t!«
»Der tät auch besser in Rent’ gehen!«
»So a Gesindl auch no unterstützen!«
»Soll’s doch in d’ Stadt gehen, da fallt so jemand net auf! Da sand viele so!«
»Der greisliche Bua kommt jetzat zu unsre Kinder in d’ Schul und verdirbt ihr’n Charakter!«
Es ging lange hin und her. Aber dann hatte die Josefa eine geradezu glorreiche Idee!
*
»Wir sind halt schon so alt!«, sagte Paula Hausner wieder einmal traurig zu ihrem Mann, dem Konditormeister Hans Hausner.
»Ach was!«, widersprach der verärgert. »Im besten Alter sind wir!«
»Wir könnten eher die Großeltern von einem Baby oder Kleinkind sein, haben sie uns gesagt auf dem Sozialamt. Du warst doch dabei!«, erinnerte sie ihn mit tränenschwerer Stimme.
Nicht selten hatte Hausner das Gefühl, dass die sogenannten ›Ruhetage‹, an denen die Konditorei und das Café geschlossen waren, noch anstrengender waren als die normalen Arbeitstage. Freilich, er hätte sich auch Kinder gewünscht: einen Buben, der einmal das im Holzkirchner Ortszentrum erstklassig gelegene Geschäft und Café übernommen hätte. Oder auch ein Mädel. Ihm war beides recht gewesen. Oder auch zwei Kinder – dann hätte eines die Konditorei und das andere das Café übernommen. Aber es hat einfach nicht geklappt, trotz aller Versuche. Sie hatten sich wirklich von Herzen gern, er und seine Paula, auch heute noch. Aber inzwischen war er zweiundfünfzig und die Paula achtundvierzig. Da passierte nichts mehr. Auch wenn sie jünger aussah, wenn sie heiter im Geschäft stand. Jetzt, verheult, sah sie genauso alt aus, wie sie war!
»Wir könnten doch heut nach München fahren«, schlug er vor. »Du könntest dir ein neues Dirndl kaufen.«
»Dirndl gibt’s bei uns in Holzkirchen grad genug und ich hab eh so viele«, wehrte sie uninteressiert ab.
»Und zum Dallmayer gehen und schaun, was die in ihrer Konditorei anbieten …«
»Da war ma doch erst!«
»Ja, willst lieber aufs Land, in die Berge?«
»Ich möcht’s noch mal auf dem Sozialamt probieren!«, stieß sie hervor.
Hans sah sie traurig an: »Da war ma auch erst!«
»Bitte, Hans!« Schon wieder kamen ihr die Tränen. Sie stammte aus einer kinderreichen Familie und erinnerte sich daran, wie lustig es immer zugegangen war. Auch wenn es finanziell oft eng gewesen war – die Kinder hatten es nie gespürt, das hatten sie erst später verstanden. Und jetzt, da es ihnen soooo gut ging – da war niemand da, der sich mit ihnen darüber freuen konnte! Auch ihren Geschwistern ging es gut. Die hatten alle nur ein Kind. Da war es ohnehin leichter. Aber sie – sie hatten gar keines.
»Na schön«, gab Hans nach. »Dann gehn ma halt no mal hin. Aber am Nachmittag könnten wir doch wenigstens etwas unternehmen …«
»Ja, wenn wir in Stimmung sind!«, erwiderte Paula. Aber sie war gleich besserer Laune: Sie wollte noch nicht so schnell aufgeben. Sie sprang auf, um sich schick und möglichst jugendlich zu kleiden. In dem Moment läutete es.
»Geh du hin!«, sagte sie.
Mit einem Seufzer stand Hans vom Frühstückstisch auf und ging an die Tür der über den Geschäftsräumen gelegenen Wohnung.
»Ja, Herr Meiser, Frau Kuhn! Ja, was wollen denn Sie bei uns? So eine Überraschung!« Und er wendete sich um und rief über die Schulter zurück: »Paula! Komm mal! Die vom Sozialamt sind da!«
Paula zog schnell einen Bademantel über und kam aus dem Bad.
»Ja, so was! Wir haben grad von Ihnen g’redt. Wir wollen wieder mal vorbeischauen!«
»Und das ist jetzt gar nimmer notwendig!« Herr Meiser lächelte säuerlich. Anders konnte er nicht. »Dürfen wir eintreten?«
»Aber bitt schön, natürlich. Wir sind noch beim Frühstück, weil heut und morgen doch unsre Ruhetage sind!« Paula machte die Tür zum Wohnzimmer auf, vor dem auf dem großen Balkon gedeckt war.
»Sehr schön haben’s es hier!«, stellte Frau Kuhn bewundernd fest. »Sonnig und windgeschützt zugleich!«
Paula wollte nochmals frischen Kaffee zubereiten, aber die beiden Beamten lehnten ab.
»Wir trinken ihn gern kalt: Davon werden wir schöner!«, scherzte Herr Meiser ganz ungewohnt. Sonst war er immer abweisend und eher ekelhaft.
»Aber von gestern haben wir noch eine wunderbare Buttercremetorte. Wie wär’s damit?«, erkundigte sich Hans zuvorkommend.
»Da sag i net nein«, sagte Frau Kuhn schnell, bevor Meiser ablehnen konnte.
»Die schmeckt heut noch genauso frisch wie gestern, am Sonntag!«, versicherte der Konditor. Sie hatten von den Resten ein paar Kuchenstücke in den Kühlschrank gestellt, um sie selbst zum Kaffee zu essen. Davon holte er jetzt eine appetitliche Auswahl.
Frau Kuhn hatte ihre Torte blitzschnell aufgegessen, und bevor sie noch fragen konnte, legte ihr Paula ein anderes Kuchenstück auf: Schwarzbeerkuchen mit Butterstreusel, köstlich!
»Mei!«, sagte Frau Kuhn. »Kein Wunder, dass Sie hier in Holzkirchen den besten Ruf von allen haben!«
»Trotzdem sollten wir jetzt zum Grund unseres Besuches kommen«, fand Herr Meiser säuerlich. Er hatte nur wenig von seiner Torte probiert. Sein Magen erlaubte so deftige Kost nicht. Das brachte der oft deprimierende Beruf mit sich. »Sind Sie noch immer an einer Adoption interessiert?«
»Aber freilich! Das wissen Sie doch!«, riefen Hans und Paula gleichzeitig.
»Wir hätten etwas Passendes«, fuhr Meiser fort, während sich Frau Kuhn schnell und unauffällig wieder ein Stück Kuchen in den Mund schob.
»Ein Baby?!«, jubelte Paula.
»Nein«, war die strenge und bestimmte Antwort. »Dafür sind Sie einfach zu alt. Es sind Geschwister.«
»Wir nehmen gern zwei!«, rief Paula wieder.
»Ja, wirklich!«, stimmte Hans sofort zu.
»Ein Bub von sechs und ein Mädel von drei Jahren!« Er zog aus seiner Tasche zwei Fotos und reichte sie den beiden.
»Mei!«, flüsterte Paula verzückt. »Is die dantschig!«
»Der schaut aus, als ob er gescheit wär!«, fand Hans und betrachtete den Girgl, der auf dem Foto fröhlich lachte.
»Es sind zwei – hm – uneheliche Kinder …«, fuhr Meiser fort.
»Da können die zwei nix dafür!«, stellte Paula energisch fest.
»Auch ihre Mutter war schon uneheliclh!«
»Wer weiß, was da der Grund war!«, sagte Paula wieder. »Es gibt auch schlechte Mannsbilder!«
»Und auch die Großmutter!«, schloss Meiser. »Und deshalb darf man sie nicht in dieser Familie lassen.«
»Aber – was sagt denn die Mutter?«, fragte Paula, die sich nicht vorstellen konnte, dass eine Frau zwei so liebe Kinder einfach hergab.
»Die ist tot. Verunglückt«, sagte Frau Kuhn, die inzwischen auch das zweite Stück aufgegessen hatte. »Und die Großmutter hat kein g’scheiten Beruf. Die kann sie nicht ernähren. Und dann natürlich: der Einfluss! Bei Ihnen wär das ganz was anderes!«
»Und in dem Alter kann man sie auch noch zurechtbiegen«, glaubte Meiser, sie beruhigen zu müssen.
»Da hab ich keine Sorg«, sagte Hans. »So nett, wie die ausschaun!«
»Ja, ja! Wirklich! Ich mag sie jetzt schon!« Paula schaute die Fotos strahlend an: einmal das vom Girgl und dann das von der Michen. »So lieb!«
»Sie wären also bereit, es mit den beiden zu probieren?«
»Wieso probieren! Wir möchten sie ganz sicher!«, rief Paula erschrocken.
Meiser lächelte erleichtert. Es war nicht einfach gewesen, die zwei anzubieten mit diesem Stammbaum! Und beide hatte bisher schon zweimal niemand nehmen wollen. Aber die Damen vom Katholischen Frauenbund in Hohenried hatten ihm die Zustände, unter denen die Kinder dort lebten, so schaurig geschildert, dass er es bei den Hausners versucht hatte, obwohl die fast schon an der Altersgrenze waren. Na ja, es handeltes sich ja nicht um Neugeborene! Und eigentlich waren die beiden wirklich noch sehr rüstig, sozusagen im besten Alter. Und in zehn Jahren, wenn es anfing nachzulassen, waren die Kinder aus dem Gröbsten heraußen, so Gott will, und der Bub vielleicht schon in der Lehre bei seinem Adoptivvater.
Meiser war keinesfalls hartherzig. Aber man musste sich in dem Beruf einfach eine dickere Haut zulegen, sonst hielt man nicht durch! Nicht umsonst hatte er immer wieder Magengeschwüre. Er würde sich von Herzen freuen, wenn diese beiden Kinder in ordentliche Verhältnisse kämen, aus der inneren und äußeren Verwahrlosung dieser Familie heraus.
»Wann können wir denn hinfahren und die Kinder holen?«, fragte Paula und betrachtete noch immer verliebt die Fotos. »Heut hätten wir Zeit!«
Meiser setzte sein saures Lächeln auf, was nicht unbedingt etwas bedeutete. Er lächelte immer so.
»Der Amtsarzt muss sie noch gründlich untersuchen, nachsehen, ob sie überhaupt geimpft sind und so weiter. Aber ich denke: nächste Woche, wenn Sie wieder Ruhetage haben.«
»Ja, damit wir uns auch um sie kümmern können, beide«, stimmte Hans sofort zu. »Du«, wendete er sich an Paula, »red doch gleich heute mit der Fatme, ob sie bei uns aushelfen könnte die nächsten Wochen.
Bis die Kinder sich ein bisserl eingewöhnt haben!«, erklärte er den Besuchern.
»Das ist gescheit!«, fand die Frau Kuhn und schickte einen sehnsuchtsvollen Blick zur Kuchenplatte.
»Ich pack Ihnen den Rest ein!«, rief Paula sofort und sprang auf. »Herr Meiser?«
»Danke, nein«, sagte der, lächelte wieder säuerlich und legte die Hand auf seinen Bauch, »mein Magen, wissen Sie!«
*
»Oma! Da kimmt wer!«, schrie Girgl und rannte in die Kuchl. Magdalena wischte sich eine Strähne aus der Stirn und damit etwas Mehl ins Gesicht, was er sehr lustig fand. »Wann gibt’s die Pfannkuchen?«
»Glei. I schau erst mal, wer da kommt!«
Inzwischen schlug die Kuhglocke am Gartentürl an, und sie eilte hinaus, sich die Hände an der Schürzen abwischend. Im Vorgarten blieb sie wie angewurzelt stehen. Träumte sie? Das gab’s doch net!
»Ja, Magdalena, da schaugst!«, sagte mit gütigem Lächeln die Josefa Angerer, die Ganswirtin, und neben ihr stand mit genauso falschem Grinsen die Genoveva Richter aus der alten Post. »Uns hast net erwartet?«
»So a Überraschung!«, erwiderte die Magdalena und hoffte, dass man ihr nicht ansah, wie mulmig es ihr wurde. Der Besuch – der konnte nix Gutes bedeuten!
»Derf ma reinkommen?«, erkundigte sich die Genovea scheinheilig.
»Ja, natürlich! Entschuldigung! Ich war nur so überrascht!« Magdalena machte das Gartentürl auf und geleitete die beiden gefährlichen Besucherinnen in ihre Stuben. »Entschuldigt – ich leg nur noch den Schurz ab!«
»Lass dir nur Zeit«, säuselte die Josefa.
Die Magdalena eilte in die Kuchl und holte drei Gläser und die letzte Flasche von ihrem Stachelbeersaft, um den beiden Damen etwas anzubieten.
Währenddessen schauten sich die zwei alles ganz genau an und strichen mit dem Zeigefinger über die Bilderrahmen und Buchrücken. Leider blieb kein Staubkörndl hängen.
»So, da bin i wieder!« Magdalena war ganz atemlos vor Aufregung.
Die beiden ließen sie einschenken und probierten dann mit Kennermiene.
»A bisserl sauer!«, fand die Josefa, »aber sonst schon guat!«
»A bisserl zu dickflüssig«, meinte die Genoveva, »aber net schlecht.« Und dann rührten beide ihr Glas nimmer an.
Aber das machte der Magdalena nix, weil die Kinder den Saft grad bei der Hitz gern mochten, und eigentlich hatte die Flasche sie eh gereut, wo’s die letzte war.
»Mir kema im Namen des Katholischen Frauenbundes«, verkündete die Josefa nun, »um dir eine freidige Botschaft zu überbringen.«
»Der Herr Pfarrer Brenner hat uns dein Anliegen vorgetragen«, säuselte die Genoveva.
»Von deine finanziellen Schwierigkeiten, mit der Magda ihre Kinder …«, meldete sich wieder die Josefa zu Wort.
»Aber – aber – !«
»Na, da brauchst di net zu schama, da kannst ja nix dafür!« Jetzt war wieder die Genoveva dran. Die beiden ersten Vorsitzenden sprachen immer abwechselnd.
Besser, sie sagte nix mehr und wartete ab!
»Durch unsere Vermittlung hamma a wunderbare Pflegestellte für der Magda ihre Kinder gefunden. Für alle zwoa!«
»Aber – wieso – i versteh net ganz …«, stammelte Magdalena und hoffte, sich verhört zu haben.
»Des is do zu vui für di. Wo du scho mit der Magda alloans net z’recht kema bist, sonst war sie doch net –, du verstehst scho«, meinte die Josefa voller Verständnis.
»Aber na! I wui die Kinder net hergeb’n! Wir gehörn doch zam! Na, da habt ihr was falsch verstanden! Auf koan Fall geb i die Kinder her!«
»Du derfst net so egoistisch sein, Magdalena«, mischte sich wieder die Genoveva ein. »So was kost du dene zwoa gar net bieten, so an Wohlstand!«
»Aber Geld is doch net des Wichtigste!«, rief Magdalena verzweifelt.
»Aber beruhigend is es scho, wenn der Bua an g’scheiten Beruf lerna ko und später mal des scheene G’schäft übernehmen. Und für das Madl is a gnua da.«
»Aber nein, nein! Da habt ihr alles falsch verstanden!« Die Magdalena wurde so laut, dass die Kinder sie hörten und besorgt aus dem Garten hereinkamen.
»Is was, Oma?«, fragte der Girgl.
»Mir ham a scheene Überraschung für eich zwoa«, erwiderte Genoveva mit falschem Lächeln, während Magdalena versuchte, sich vor den beiden zusammenzureißen. »Ihr derft in die Stadt! Nach Holzkirchen. Zu ganz brave und wohlhabende und sehr solide Leit!«
Der Girgl musterte die fremde Frau, dann nahm er die weinende Oma an der Hand: »Was is denn, Oma?«
Das Michen stand immer noch in der offenen Tür, den Finger im Mund und betrachtete besonders die Josefa, die sie in sehr schlechter Erinnerung hatte, misstrauisch.
»I geb euch net her! Nie und nimmer!«, schluchzte Magdalena, und Michen verstand zwar net, um was es ging, weinte aber vorsichtshalber laut mit.
Die Ganswirtin erhob sich, ein Standbild der Empörung.
»Da siegt ma’s wieder…, bloß an sich selber denkst! Schama solltest di! Kimm, Genovea, koa Wort des Danks. Aber des hätt ma uns ja denk’n kenna!« Sie ergriff ihre Handtasche, und dann rauschten die beiden Damen sehr zufrieden mit dem Erfolg ihrer Mitteilung aus dem Haus.
»Was is denn, Oma?«, fragte der Girgl jetzt zum dritten Mal, und auch Michen kam nun näher.
»Oma, was woll’n denn di?«, schluchzte sie ängstlich.
Magdalena schlang die Arme um die beiden, drückte sie an sich und weinte herzzerbrechend.
»Na, i geb euch net her! Nie und nimma!«
*
I muss mi zamreißen!, ermahnte sich Magdalena. Es ging nicht an, dass sie sich gehen ließ und die Kinder noch mehr verängstigte, indem sie weinte. »Kommt’s! Wir b’suchen jetzt den Herrn Pfarrer!«
Zum Herrn Pfarrer gingen die beiden gern. Der hatte immer was Gutes für sie: einen Rest vom Hefezopf oder Schmalznudeln oder sonst was Feines. Die Stimmung schlug um, und Magdalena atmete auch auf. Bestimmt wurde es nicht so schlimm! Bestimmt hatten die zwei Nebelkrähen ihr nur Angst machen wollen.
Als sie ins Pfarrhaus kamen, war gerade die nette Frau Behr zu Besuch.
»Stör ma?«, fragte Magdalena besorgt, denn sie hatte das ungute Gefühl, dass man eben über sie gesprochen hatte.
»Aber du doch net, Magdalena!«, sagte Hochwürden Brenner herzlich. »Und ihr zwei schon überhaupt net!« Er rief der Annamirl, sie solle in der Kuchl den Kindern was vom mittäglichen Apfelstrudel geben. »Und viel Vanillesoß dazu!«, ordnete er an.
Die zwei strahlten und folgten der Haushälterin, die sie ungewöhnlich freundlich betrachtete.
»Wann geht’s denn los?«, erkundigte sie sich, kaum dass sie in der Küche waren.
»Woaß net!«, erwiderte der Girgl und schob sich eine große Ladung Apfelstrudel in den Mund.
Die Annamirl lachte schadenfroh.
»Esst’s nur, esst’s nur! Aber bald kriegt’s lauter gute Sachen. Die Hausners ham a Geld!«
Die Kinder verstanden zwar net, was sie meinte, aber der Apfelstrudel schmeckte wunderbar!
Im Studierzimmer des Pfarrers herrschte einen Moment Schweigen, dann fragte der Geistliche: »Hast es schon gehört, Magdalena?«
Sie wurde schneeweiß …
»Hochwürden, des kann doch net wahr sein?! Man will mir die Kinder wegnehmen?!«
»So derfst du des net sehn, Magdalena«, versuchte er, sich zu verteidigen. Er hatte sich die Unterstützung des Frauenbundes ja auch anders vorgestellt! »Für die Kinder ist das eine große Chance! Die Hausners sind sehr anständige Leute, wirklich. Ich hab mich bei mei’m Amtsbruder in Holzkirchen erkundigt. Echt christlich!«
Magdalena lachte auf: »Des sand die Josefa und die Genoveva auch!«
»Na!«, widersprach der Pfarrer energisch. »Des sand’s überhaupt net! Des meinen sie bloß! Und viele andre auch«, setzte er brummig hinzu.
Und dieses Mal stimmte ihm die Teresa Behr zu, die bisher schweigend daneben gesessen war.
»Es würde ihnen dort bestimmt gut gehen«, sagte sie, nicht wirklich überzeugt, aber um die verzweifelte Frau Neuner zu trösten. »Sie wären wirklich bestens versorgt, der Girgl könnte einmal Konditor werden und die Michen das Café übernehmen.«
»Wo’s mit der Ausbildung heut doch gar net einfach is!«, glaubte der Pfarrer sie erinnern zu müssen.
»Aber – aber – i mag sie doch so gern! Und sie hängen doch auch an mir! Jetzt besonders, wo ihre Mutter tot is!« Magdalena kamen die Tränen. »Geld is doch net alles!«