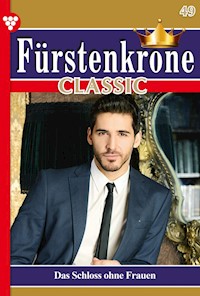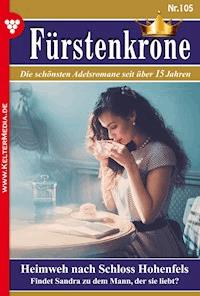Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fürstenkrone
- Sprache: Deutsch
In der völlig neuen Romanreihe "Fürstenkrone" kommt wirklich jeder auf seine Kosten, sowohl die Leserin der Adelsgeschichten als auch jene, die eigentlich die herzerwärmenden Mami-Storys bevorzugt. Romane aus dem Hochadel, die die Herzen der Leserinnen höherschlagen lassen. Wer möchte nicht wissen, welche geheimen Wünsche die Adelswelt bewegen? Die Leserschaft ist fasziniert und genießt "diese" Wirklichkeit. "Fürstenkrone" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. »Wenn du glaubst, dass du mich enterben musst, lieber Papa«, sagte Gero Erbprinz von Bärenburg zu seinem Vater, dem Fürsten Ferdinand von Bärenburg, und bemühte sich dabei, um Himmels willen weder zynisch noch amüsiert zu klingen, »ich versichere dir, dass ich mit dem Pflichtteil voll und ganz zufrieden bin. Das ist bestimmt mehr, als heutzutage auch der erfolgreichste Maler verdienen kann.« Fürst Ferdinand sah aus, als würde er im nächsten Augenblick explodieren. Er war ganz weiß vor Zorn und suchte nach Worten. »Es tut mir leid, Papa.« Gero seufzte. Anscheinend hatte er doch nicht den richtigen Ton getroffen. »Es tut mir wirklich leid, ich will dich nicht kränken! Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nur mehr mit Bankdirektoren und Industriemanagern zu tun habe, dann werde ich depressiv. Zugegeben, ich lebe gern gut, aber es muss keineswegs so aufwendig sein wie unser Haushalt hier.« Fürst Ferdinand schnaubte wie sein Wappentier, ein wilder Bär mit drohend erhobenen Tatzen. »Das ist es ja, weswegen ich dich enterbe! Du und das lockere, um nicht zu sagen, verkommene Künstlervölkchen, mit dem du dich Tag und Nacht herumtreibst …« Gero seufzte wieder. Sie hatten schon hundertmal darüber diskutiert. Was die Ansicht seines Vaters über sich mit Kunst befassende Menschen betraf, so war die schlicht mittelalterlich. Da half es nichts, wenn er auf Rubens, van Dyck, Leonardo oder Michelangelo hinwies – bestenfalls erkannte er diese Genies als Ausnahmen an. »Wir haben einen großen Besitz, ein großes Vermögen, aber du scheinst dir nicht darüber im Klaren zu sein, wie schnell sich das in Nichts und womöglich noch Schulden auflöst«, fuhr sein Vater ihn an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fürstenkrone – 290 –Aglaja – meine Muse
Unveröffentlichter Roman
Jutta von Kampen
»Wenn du glaubst, dass du mich enterben musst, lieber Papa«, sagte Gero Erbprinz von Bärenburg zu seinem Vater, dem Fürsten Ferdinand von Bärenburg, und bemühte sich dabei, um Himmels willen weder zynisch noch amüsiert zu klingen, »ich versichere dir, dass ich mit dem Pflichtteil voll und ganz zufrieden bin. Das ist bestimmt mehr, als heutzutage auch der erfolgreichste Maler verdienen kann.«
Fürst Ferdinand sah aus, als würde er im nächsten Augenblick explodieren. Er war ganz weiß vor Zorn und suchte nach Worten.
»Es tut mir leid, Papa.« Gero seufzte. Anscheinend hatte er doch nicht den richtigen Ton getroffen. »Es tut mir wirklich leid, ich will dich nicht kränken! Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nur mehr mit Bankdirektoren und Industriemanagern zu tun habe, dann werde ich depressiv. Zugegeben, ich lebe gern gut, aber es muss keineswegs so aufwendig sein wie unser Haushalt hier.«
Fürst Ferdinand schnaubte wie sein Wappentier, ein wilder Bär mit drohend erhobenen Tatzen.
»Das ist es ja, weswegen ich dich enterbe! Du und das lockere, um nicht zu sagen, verkommene Künstlervölkchen, mit dem du dich Tag und Nacht herumtreibst …«
Gero seufzte wieder. Sie hatten schon hundertmal darüber diskutiert. Was die Ansicht seines Vaters über sich mit Kunst befassende Menschen betraf, so war die schlicht mittelalterlich. Da half es nichts, wenn er auf Rubens, van Dyck, Leonardo oder Michelangelo hinwies – bestenfalls erkannte er diese Genies als Ausnahmen an.
»Wir haben einen großen Besitz, ein großes Vermögen, aber du scheinst dir nicht darüber im Klaren zu sein, wie schnell sich das in Nichts und womöglich noch Schulden auflöst«, fuhr sein Vater ihn an.
Ehe er etwas sagen konnte, polterte sein Vater weiter.
»Du brauchst mir nicht zu erzählen, dass du weder trinkst, noch spritzt noch der Spielleidenschaft verfallen bist. Das weiß ich. Aber – wird es auch in … hm … zehn Jahren noch so sein?«
»Papa!«, stöhnte Gero verzweifelt. Hätte er sich nur nicht auf diese neuerliche Diskussion eingelassen! Es endete doch immer so! Jetzt kam er gleich auf die verkommenen Weiber aus der Künstlerszene zu sprechen …
»Du brauchst nur in die Fänge so eines – hm … Frauenzimmers zu kommen!« Aha! Da war er schon so weit! »Stell dir vor, sie steckt dich mit Aids an – oder irgendeiner anderen scheußlichen Krankheit …«
»Papa!«, ächzte Gero wieder und verbarg sein Gesicht in den Händen.
»Ich weiß, wovon ich rede!«, fuhr der Fürst fort. »Und ich gebe dir noch einmal Bedenkzeit. Über kommendes Wochenende! Am folgenden Montag habe ich einen Termin bei Rechtsanwalt Dr. von Felsenstein. Ich werde ihn nicht mehr verschieben.«
»Das brauchst du auch nicht, Papa!«, sagte Gero, er war jetzt ebenfalls wütend. »Ich werde meine Einstellung garantiert nicht ändern!«
Sein Vater presste die Lippen aufeinander und funkelte ihn wütend an, und Gero sah genauso zornig zurück. Der Fürst hatte ihn zu dieser unerfreulichen Auseinandersetzung in seinem Atelier in der Stadt aufgesucht. Jetzt stand er auf, und auch Gero erhob sich.
»Sehe ich dich nochmals? Oder – höre ich wenigstens von dir?«, fragte der Fürst.
»Wenn du es wünschst …«, erwiderte Gero gekränkt.
Es ging ihm nicht um die Erbschaft. Es ging ihm um die veraltete und ihm nicht nachvollziehbare Einstellung seines Vaters zu dem Beruf, der für ihn mehr bedeutete als alles Geld und Gut. Er war Vorzugsstudent auf der Akademie der Schönen Künste gewesen. Man sagte ihm eine große Zukunft voraus. Er hatte bereits in internationalen Galerien mit Erfolg mehrmals ausgestellt. Und das alles sollte er aufgeben und sich der todlangweiligen Verwaltung eines Riesenvermögens widmen? Nein! Niemals! Er würde eintrocknen wie eine Dörrpflaume!
»Ich wünsche es!«, sagte der Fürst nach einer kleinen Pause.
Wieder maßen sich die beiden mit Blicken. Es war ihnen beiden nicht bewusst, wie ähnlich sie sich waren … innerlich wie auch äußerlich.
Wenn meine Frau noch lebte!, dachte der Fürst.
Wenn meine Mutter noch da wäre!, dachte Gero.
Dann wäre alles einfacher, und es käme nicht zu diesem unerfreulichen Streit!, dachten beide.
Fürst Ferdinand von Bärenburg stand kurz vor seinem siebzigsten Geburtstag. Er war schlank, hochgewachsen, hatte volles weißes Haar, einen gleichfalls weißen kleinen Spitzbart, eine edel gebogene Nase und schöne, große, graue Augen unter dichten dunklen Brauen. Er sah aus, wie man sich einen Fürsten vorstellt und wie sie leider nicht immer aussehen.
Der Erbprinz, der keiner sein wollte, war noch größer, als sein Vater, schlank, drahtig, sportlich trainiert, hatte dunkles Haar und einen – wie die Damen seiner Kreise, aber auch die anderen fanden – sehr aufregenden Mund, er war glatt rasiert, hatte die gleiche Nase wie sein Vater und auch die gleichen schönen Augen unter dichten Brauen und Wimpern.
Er hatte lange, schmale und doch kräftige Hände.
Aristokratische Hände – sagten die adeligen Damen.
Künstlerhände – fanden die Mädchen und Frauen, die das Entsetzen seines Vaters waren.
Und was die Damen aus den gebildeten bürgerlichen Kreisen anging, so vertraten sie die Ansicht, er hätte die Hände eines Schönheitschirurgen.
Gero grinste dann und erwiderte der jeweiligen Dame, dass er die Hände seiner Mutter geerbt habe. Sie war eine Principessa aus Rom gewesen, und ihre Vorfahren hatten Künstler gefördert und unterstützt, wie es eigentlich auch die Vorfahren der Bärenburger getan hatten.
Nur es waren eben nie die Söhne und Töchter aus der Familie gewesen, die sich diesem unwürdigen Beruf hingaben.
Langsam, mit gesenktem Kopf ging der Fürst zur Tür des großen Ateliers. Zum ersten Mal fiel es Gero auf, wie die Schultern seines Vaters nach vorne sanken.
»Papa«, sagte er unglücklich, »ich will mich nicht mit dir streiten! Ich will dir nicht wehtun! Aber – es ist doch mein Leben! Du willst doch auch nicht, dass ich unglücklich und unzufrieden bin …«
»Nein, nein«, murmelte der Fürst. »Natürlich nicht. Aber … Ich hänge auch an unserem Besitz. Die Vorstellung, dass er leichtsinnig durchgebracht wird … dass … grässliche Leute in dem schönen alten Gebäude herumlaufen …«, er schüttelte den Kopf und brach ab.
Er hatte die Hand bereits auf die Türklinke gelegt, doch er konnte sich noch nicht durchringen zu gehen. Er wartete, hoffte noch immer, dass Gero einlenken würde.
»Willst du dir meine letzten Bilder ansehen?«, fragte der nun.
Der Fürst zauderte einen Moment. Und gerade, als er zustimmen wollte, flog die Tür auf, und herein stürzte ein bildhübsches, etwas verwegen zurechtgemachtes Mädchen mit tomatenroten Haaren, schwarzen Lippen und schwarz lackierten Fingernägeln, abenteuerlich ummalten Augen, einer knallengen Jeans, einer nietenbesetzten Lederjacke und dazu diese Klumpfußstiefel, die der ganze Graus des ein Leben lang sehr eleganten Fürsten waren.
»Gero! Liebling!« Sie flog dem Erbprinzen an den Hals. »Ich habe die Rolle! Oh, ich freue mich ja so! Es ist natürlich nicht die Hauptrolle – aber immerhin! Ich habe eine echt gute Szene mit dem Sohn des Mörders, der mich als Schwiegertochter ablehnt, und dann werde ich umgebracht … Super!, sage ich dir!« Jetzt erst bemerkte sie den Fürsten. »Oh! Du hast Besuch!« Sie musterte ihn neugierig.
Gero machte Anstalten, sie seinem Vater vorzustellen. Doch der winkte energisch ab.
»Ich höre von dir!« Draußen war er.
»Wer war denn das?«, fragte Lena Bergen. »Der sah ja enorm gut aus! Wie die Könige im Theater!«
»Das war mein Vater«, sagte Gero und löste ihre Arme von seinem Hals. »Ich hoffe, deine schauspielerischen Auftritte sind erfolgreicher, als der hier eben war!«
»Ich habe gestört?«
»So kann man es nennen!« Gero sah ihr bekümmertes Gesicht und musste unwillkürlich lachen. »Zieh keinen solchen Flunsch. Es ist nicht so schlimm. Ich bin nur eben enterbt worden!«
»Enterbt?! Ehrlich? Aber das ist ja grauenhaft! Verdienst du denn genug, um davon zu leben? Notfalls kann ich dir ja unter die Arme greifen – ich meine, wenn ich gerade eine Rolle habe!«
»Sehr lieb!« Er legte lachend den Arm um sie. »Aber es geht auch ohne deine Unterstützung!«
»Aber wenn du mal was brauchst …«, beharrte Lena.
»Reden wir von was anderem«, lenkte Gero ab. »Du hast also die Rolle bekommen?«
»Ja!«, sagte sie und erging sich begeistert in Details, während sie sich auszog, um für Geros ›jagende Diana‹, das Gemälde, an dem er zurzeit arbeitete, zu posieren.
Er hörte nur mit halbem Ohr zu.
Sie war ja liebenswert, die kleine Lena. Und er mochte sie auch, aber für die Dauer … Wenn er daran dachte, dass sie ihm von ihren paar Kröten etwas abgeben wollte. Nein, das wäre zu verpflichtend! Abgesehen davon, dass er wirklich nichts brauchte! Hatte sie nicht kürzlich mit Igor Palinski heftig geflirtet? Jedenfalls wollte der sie als Modell haben. Das war gut! Sie war ja wirklich bildschön gewachsen. Und dem Bildhauer gefiel sie offensichtlich auch sonst.
»Ich mag nicht mehr!«, sagte Gero plötzlich in ihr Geplauder hinein. »Ich bin heute nicht in Stimmung!«
»Das kann ich gut verstehen!«, rief Lena. »Bist du wenigstens in der Stimmung zu feiern? Palinski hat einen Riesenauftrag bekommen, hat mir Mona erzählt. Und er gibt heute eine Bottleparty. Kommst du mit? Ich möchte auch meine erste größere Fernsehrolle feiern!«
»Einverstanden!«, sagte Gero und hängte das Bild wieder zu. Er wusch sich im Bad die Hände – außer dem großzügigen Atelier bestand die Wohnung aus Schlafzimmer und Salon, Küche und einem Bad – und betrachtete nachdenklich sein Gesicht im Spiegel. Sollte er noch unter die Dusche gehen? Nein, das war zu gefährlich mit Lena. Er würde nur das Hemd wechseln.
Er lächelte ihr zu, als sie hinter ihm im Spiegel auftauchte. Sie war noch immer im ›Kostüm‹ der Diana.
»Und?«, fragte sie einladend.
»Jetzt nicht«, wich er aus.
»Ich verstehe – der Krach mit deinem Vater!«
Er nickte. Sie war wirklich süß. Er musste sich unbedingt von ihr trennen, denn er wollte ihr nicht wehtun. Aber er brauchte auch ein anderes Gesicht für seine Diana. Die Figur war in Ordnung. Aber die Göttin, die keusche Göttin der Jagd, hatte nicht das unbedarft hübsche Gesicht eines rotzfrechen kleinen Mädchens …
Lena sah ihm eine Weile zu, wie er sein Hemd zuknöpfte, dann ging sie hinaus.
»Sag, Gero!«, rief sie zurück. »Hättest du etwas dagegen, wenn ich Palinski Modell stehen würde?«
Aha! Die beiden waren sich schon einig! Ausgezeichnet.
»Aber natürlich nicht«, erwiderte Gero zufrieden.
»Ich könnte dann aber nicht mehr so oft zu dir kommen …«
»Das ist auch nicht mehr notwendig«, meinte Gero. »Ich habe das Bild so weit fertig.«
»Es ist – weil ich doch auch die Proben habe. Und die Aufnahmen. Du verstehst?«
»Vollkommen!« Gero lächelte. Es hätte sich wirklich nicht besser treffen können!
Er war jetzt richtig, in Stimmung zu feiern.
*
Dr. Kurt Berghoff, der Leiter Gesellschaft für Unternehmensberatung Mackintosh in Deutschland, lächelte seine neue Mitarbeiterin an.
Es sollte zuvorkommend sein, war aber unpersönlich. Er war ein so brillanter Geschäftsmann, dass es ihm sogar im privaten Bereich kaum möglich war, persönlich zu sein. Jedenfalls behauptete das seine Frau, und seine halbwüchsigen Kinder sagten es noch um einiges deutlicher.
»Setzen Sie sich doch, Frau von Veichten!«, forderte er Aglaja auf.
»Danke.« Sie war nicht nervös, nur neugierig, was der hohe Chef von ihr wollte. Bisher hatte er nie direkt mit ihr verhandelt, sondern dies immer einem seiner Herren überlassen, die nur für bestimmte Gebiete zuständig waren.
Aglaja war ebenso elegant wie dezent angezogen. Sie passte vorzüglich in das Büro ihres Chefs mit der schwarzen Ledersitzgruppe und den kühlen Möbeln aus Chrom und Glas. Die Grünpflanzen, die herumstanden, verbesserten vielleicht die Luft, machten die Atmosphäre aber keineswegs anheimelnder.
Aglaja trug ein klassisches Kostüm in Hellgrau, Seidenbluse, Strümpfe und Pumps eine Schattierung dunkler, eine halblange Perlenkette mit schönem rosa Luster und Brillantschloss, die dazu passenden Ohrstecker, an der rechten Hand einen Siegelring, das Wappen war in einen Ceylonsaphir geschnitten, der die rauchblaue Farbe ihrer großen Augen hatte, und an der linken einen antiken Diamantring. Ihr dunkelgoldenes Haar hatte einen rötlichen Stich, der wohl nicht ganz echt war, denn ihre Haut war sanft gebräunt und ohne Sommersprossen. Ihre Nase war nicht zu klein, aber klassisch geformt, ihr Mund verriet mit seinen vollen Lippen Leidenschaft, ihr Kinn mit dem Grübchen Energie, ihre schlanke Gestalt mit den bemerkenswert schönen Beinen, von denen der Rock gerade noch die schmalen Knie sehen ließ, verriet beste Rasse.
Das Lächeln des hohen Chefs wurde eine Spur weniger geschäftlich. Nicht, dass er persönlich an ihr interessiert gewesen wäre! Du liebe Zeit! So etwas brachte nur unerwünschte Verwicklungen und Ärger. Aber so, wie sie aussah, war sie bestimmt ein Gewinn für das Unternehmen. Dass sie kompetent war, war ohnehin selbstverständlich. Dr. Ernst Gäbler, der mit einer scheußlichen Erkältung zu Hause im Bett lag und ihr direkter Vorgesetzter war, hatte ihm dies mehrmals bestätigt.
Aglaja ließ die Musterung gelassen über sich ergehen. Schließlich gab sie ihr Gelegenheit, den Chef gleichfalls einzustufen.
»Ich habe eine Überraschung für Sie«, sagte er nun mit dem etwas angetauten Lächeln.
»Ich bin neugierig!« Auch ihre Stimme war angenehm, weich, dunkel, sie würde kaum loskeifen, wie dies leider auch manche Herren taten.
»Dr. Gäbler ist krank.«
Sie nickte. Das war kaum die Überraschung.
»Ich habe gestern abend noch mit ihm telefoniert, und er hat mir vorgeschlagen, dass Sie ihn vertreten sollen.«
»Oh!« Sonst nichts. Es war besser, abzuwarten, ehe sie sich dazu äußerte.
»Fürst Ferdinand von Bärenburg hat sich für den heutigen Vormittag zu einer ausführlichen Besprechung bei Dr. Gäbler angesagt. Er kommt von auswärts. Es scheint dringend zu sein. Sie sollen ihn beraten!«
Jetzt schluckte Aglaja doch.
»Ich habe mich zwar kürzlich mit den Unterlagen befasst …«
»Eben!«
»Aber ich bin mir nicht sicher. Es handelt sich ja um die verschiedensten Unternehmen. Ich bräuchte etwas Zeit, um mich besser einzuarbeiten.«
»Ich überlasse es Ihnen, wie Sie im Gespräch mit dem Fürsten dies überbrücken. Sollte er nicht zufrieden sein, wird er das bestimmt sagen!« Er lächelte spöttisch. »Er ist nicht der Typ, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Ich selbst bin heute beim Minister für Arbeit. Und auch sonst ist niemand frei. Ich möchte auf keinen Fall, dass der Fürst umsonst hier anreist.«
Aglaja stand auf.
»Ich werde mir Mühe geben. Entschuldigen Sie mich jetzt, ich will versuchen, mich noch ein wenig mehr zu informieren.«
»Ich erwarte heute Abend Ihren Bericht!«
Aglaja war entlassen.