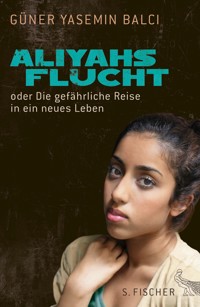23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Unsere Freiheit ist nicht verhandelbar.« Als türkische Gastarbeiter kamen Güner Balcis Eltern nach Berlin, ins Neuköllner Rollbergviertel, eine Großsiedlung mit achteckigen Betonklötzen. Für sie war der Einzug in eine Wohnung mit eigenem Bad ein Meilenstein des Ankommens in der Fremde. Anfang der 1980er-Jahre verwandelte sich der Kiez, in dem ihre Tochter noch eine unbeschwerte Kindheit erlebte, in einen sozialen Brennpunkt. Die Söhne arabischer Großfamilien beherrschten das Geschehen. Ein reaktionärer Islam machte sich breit, der Mädchen und Frauen die Selbstbestimmung verweigerte. Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie – egal, von welcher Seite sie angreifen Güner Balci erzählt von Selbstbehauptung und Scheitern, von Freundschaft und Verlust in einem Viertel, das zu ihrer Lebensschule wurde. Eine leidenschaftliche Liebeserklärung an ihr Heimatland. Klartext über die Probleme einer Einwanderungsgesellschaft »Ich liebe meine Heimat, meine Sprache, meine Hood, meine Leute und unsere in der Verfassung garantierten Werte, Menschenwürde, Gleichberechtigung, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Lange Zeit galten sie als unbestreitbar, heute sehe ich sie bedroht.« Erstmals erzählt Güner Balci sehr persönlich über ihr Aufwachsen im Berliner Rollbergviertel. »Güner Balci ist eine hochbegabte Fernsehjournalistin und Schriftstellerin.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Eine Demokratin mit einem klaren Kompass – immer kritisch und mit dem Finger auf den schmerzhaften Realitäten, aber auch getrieben von der Zuversicht, dass sich zusammen eine bessere Welt schaffen lässt. Eine Heldin unserer Zeit, die sich weder von Drohungen noch von Beleidigungen einschüchtern oder gar ausbremsen lässt.« Tolerantia Awards 2025
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten wurden einige Namen, charakteristische Merkmale von Personen sowie Örtlichkeiten und andere Details verändert.
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Jesco Denzel
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44 b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
Mein Heimatland
Ein Stück Zucker
Back from the USA
Down Under
Dreizehn
Hulusis Trauma
Gott war noch nie auf unserer Seite
Im Land der Autos und der Ordnung
Mal Sonne, mal Regen, so ist das Leben
Plastikschuhe aus der Großstadt
Die Balci-Taugenichtse
Stift statt Wischmopp
Wollhosen mit Gummizug
Der Kosmos meiner Kindheit
Gründerzeitviertel und Taubenfriedhöfe
Wir Kinder vom Rollberg
Das Leben der anderen
Stefanie und der Kindergeburtstag
Yara, die Meisterhexe
Meine Arabqueen
Die Kunst des Klauens
Knallhart seelenlos
Roberto Blanco im Briese-Eck
Mein Vater hatte einen Garten
Ein adliger Hund
Die Rosen-Witwen
»Is nüscht frei und wird auch nüscht frei!«
Die traurige Pfingstrose
Der geköpfte Walnussbaum
Reise in die Türkei
Moby Dick auf der Todesroute
Lockruf Gummibärchen
Besuch im Gefängnis
Meine Verwandten
Sommer auf dem Balkon
Atatürks finale Lösung
Hrant Dink, die Taube
Dogan, der Revoluzzer
Saz spielen in Berlin
Die Sache mit den Mädchen
Die Schwarzen Jahre
Weibliche Aliens
Im Mädchengefängnis
Der Einzug der Geschlechterapartheid
Die Notlage der Mädchen
Im Dickicht der Heimlichkeiten
Die Bauchfreien
Echte und falsche Muslime
Glaube und Angst
Die Macht der Imame
Unsichtbar werden: die Mädchen
Stimmen des »Südens«
Vergewaltigungen im Arabischen Frühling
Silvesternacht in Köln
Imame als »Schlichter«
»Wozu Polizei?«
Von Helden und Gescheiterten
Das Böse besiegen
Die »Amis« in Berlin
Liebe gegen Cash
Marianne und die falschen Männer
Noteinsatz
Die Schmuckschatulle
Bruderzwist
Kleine Brötchen backen
Das Leben ist ungerecht
Nasrins Geheimnis
Pamuks Hütte
Mein Rollbergbruder
Pitbulls und Schadenfreude
Leben ist nichts für die Schwachen
Messer am Hals
Hassprediger
Tascis Freitagspredigten
Sunnitische Hetze
Ein Märchen mit tödlichem Ausgang
Männerwelten
Panter Preis für eine Postkarte
Kreuzberger Boheme
Großer Bruder
Yontavolta
Atatürk über dem Schrankbett
Cesar mit dem Sternschnuppenhimmel
Das verbrannte Puppenhaus
Emily-Erdbeer-Puppen
Yener und seine Giftspritzen
Tick, Trick, Track und ich
Tante Imos, mein Basislager
Eine Bank am Hermannplatz
Seelenschaden
Zeinab und ihre Brüder
Ines und ihre Gold-Mama
Missbrauch
Wallah-Carmen
Der arabische Freund
Die berüchtigte Großfamilie
Der Dunkelmann des IS
Meine Sippe
Tante Imosch auf dem Sofa
Elvis auf dem Grabstein
Mit Turkish Airlines auf den Friedhof
Vom Leben und Sterben
Reise nach Dersim
Aleviten und Sunniten
Das Sivas-Massaker
Liebe ist Leben
Judenhass
Ideologischer Import
Liberale Stimmen aus der muslimischen Welt
Identitätsstiftend: muslimischer Antisemitismus
Der Vormarsch der Extremisten
Propalästinensische Aktivisten
Die selbst ernannten Palästinenserfreunde
Meine Sinti-Familie
»Zigeuner!«
Tschabo
Familienzusammenführung
Die Schatten des Holocaust
Vierzig Tage, vierzig Nächte und kein Thema
Das Amt
Exoten und Bürger zweiter Klasse
Wir mögen uns doch alle – wirklich?
»Ungeeignet« – der Shitstorm
Nicht einschüchtern lassen
Was es braucht
Unser Blick auf Migranten
»Irgendwann muss man gehen«
Mein Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für Lilith, Neo und Jesco
Zitat
Vielleicht muss das so sein, dass wir irgendwann verschwinden. Sodass zukünftige Generationen […] gezwungen sind, unseren Spuren zu folgen, sich zu fragen, wer wir waren, was wir einander angetan haben und warum.
Pierre Jarawan, Am Ende bleiben die Zedern
Mein Heimatland
Mein Heimatland sind tanzende Schneeflocken im Scheinwerferlicht einer stürmischen Winternacht. Spaziergänge im Dunkeln mit zu vielen Kindern auf einem Schlitten. Hermannplatz. Hasenheide. Ofenwärme. Die Hände meiner runden Tanten, die nach Zwiebeln riechen. Blubbernde Kessel mit rotschwarzem Tee. Knarzende Treppenaufgänge in Altbauwohnungen. Der würzige Duft von roter Bohnensuppe. Der Anblick meiner Semah tanzenden Mutter. Wettspringen vom Beckenrand im Columbiabad. Die rauen Hände meines Vaters. Voll aufgedrehte Autoradios mit Django-Reinhardt-Musik. Brigitte Mira und Harald Juhnke, Fernsehabende mit Hans Rosenthal, während im Radio Orhan Gencebay Saz spielt.
Mein Heimatland ist die Bude von Curry-Helmut auf der Karl-Marx-Straße, unser Pilgerstern an grauen Herbsttagen. Da standen wir dann alle zusammen – Polizisten vom Rollbergabschnitt, große und kleine Ganoven, meine Freunde Oskar, Roby, Mautzi, Ali und Co. – bei Schaschlik nach Helmuts Geheimrezept und erzählten uns den neuesten Tratsch. Manchmal fuhr Dimi mit seinem schnittigen 8er-Mercedes vorbei, ein andermal Thorsten mit dem klapprigen Chevy Van. Ab und zu konnte auch ich mit meinem Opel Commodore B Coupé posen. Mein Vater war so stolz, dass ich seine Begeisterung für alte Karren teilte, er wusste nicht, dass ich kaum Geld für die Tankfüllung hatte.
Heimatland ist ein ozeanisches Gefühl, es sitzt tief im Kopf, im Bauch und im Herzen. Es macht, dass einem schwarz wird vor Augen und alles schmerzt, wenn einer für immer geht. Es macht, dass man vor Aufregung vibriert, wenn man jung ist und noch aus dem Vollen schöpft. Es begleitet einen, egal wo man ist, weil es der Ort ist, der uns schon im Land der Kindheit formt. Es kann überall sein und hat seine Wurzeln dort, wo man seine prägendste Zeit erlebt hat.
Mein Heimatland ist der Rollbergkiez, ist Neukölln, ist Berlin. Es ist der Aussichtsturm, der archimedische Punkt, von dem aus ich die Welt zu erfassen und einzuordnen versuche. Bis heute ist das so.
Die Geschichte meiner Familie begann in den höhlenartigen Bergdörfern meiner Ahnen im ostanatolischen Dersim und fand ihre entscheidende Fortsetzung in einer Neuköllner Zwei-zwei-halbe-Zimmer-Wohnung mit Bad und Zentralheizung. Die Zeitmaschine hatte meine Eltern in einer Dreitagereise aus archaischen Sippenzwängen mit vererbbaren Machtansprüchen in einen funktionierenden Rechtsstaat katapultiert, wo die Welt für sie so viel weiter wurde – trotz aller Hindernisse, Schwierigkeiten, die ihnen die Selbstbehauptung in der Fremde abforderte. Was ihnen, den Bergmenschen, so viel Mut zum Aufbruch und eine gravierende Neuorientierung abverlangte, wurde mir im Mariendorfer Weg auf der Geburtsstation als Mitgift für mein Leben in die Wiege gelegt: Demokratie. Gleichheit. Freiheit. Nur weil ich auf den Schultern meiner Eltern stehen kann, bin ich dorthin gekommen, wo ich heute bin.
Deutschland ist für mich das beste Heimatland. Ich liebe meine Sprache, meine Hood, meine Leute. Ich liebe mein Land, vor allem aber seine in der Verfassung garantierten Werte, Menschenwürde, Gleichberechtigung, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Lange Zeit galten sie als unbestreitbar, bestimmten unsere Gesellschaftsordnung, heute sehe ich sie bedroht. Durch die einen, die ihnen den Kampf angesagt haben, aber auch durch die anderen, die überhaupt nicht mehr wissen, was sie daran haben, und nicht erkennen, was verteidigt werden muss. Sie setzen leichtfertig ausgerechnet das aufs Spiel, was ziemlich einmalig ist in der Welt.
Noch nie waren demokratische Staaten so offen und massiv unter Beschuss wie heute. Noch nie war es so leicht wie heute, mit einem Klick Falschmeldungen, Propaganda und Hass in Millionen von Köpfen zu verankern. Das, was wir jahrzehntelang als gesichert empfunden haben, das geeinte Europa mit seinen universellen Menschenrechten und einem System, das eine größtmögliche Freiheit erlaubt, steht zunehmend allein da in einer Welt, in der Autokraten sich verbrecherisch verbünden und immer mehr Macht und Einfluss gewinnen.
Die Weltordnung sortiert sich gerade neu. Der russische Angriff auf die Ukraine, der Überfall der Hamas auf Israel, der maßlose Krieg in Gaza, der Rechtsdrift in Europa und Amerika, die ungelösten Fragen der Migration und zahllose andere schwerwiegende Konflikte, die hier angeführt werden könnten, halten uns vor Augen, dass die fetten Jahre vorbei sind, in denen Freiheit, Wohlstand und Sicherheit bleibende Errungenschaften zu sein schienen.
Aber dieses Buch ist keine Reise zu den aktuellen weltpolitischen Konfliktherden. Es ist ein kleiner Ausflug in meine Welt als Neuköllner Kind mit Gastarbeitergeschichte. In meinem Rollbergdorf wurde das Fundament gelegt, auf dem ein Haus aus Erfahrungen, Erlebnissen, Erinnerungen entstand, die mich geprägt haben. Und mich früher als andere in dem bunten Kosmos meiner Kindheit die Gefährdungen erkennen ließen, die uns heute ständig beschäftigen.
Der Rollbergkiez war meine Lebensschule. Hier konnte man auf dem Spielplatz lernen, wie rasant eine selbst ermächtigte Truppe Sittenwächter allen ihre Normen und Vorstellungen mit Gewalt aufzwang und Angst erzeugte. Wie Gefolgschaft, Gehorsam, Loyalität abgefordert und auch geliefert wurden. Wie das als gottgefällig legitimiert wurde, was in Wahrheit im Interesse einiger war. Ihre ersten Opfer waren die Mädchen im Kiez, sie verschwanden aus der Öffentlichkeit und der Mitgestaltung, mussten zu Schattenwesen werden, denen die Selbstbestimmung abgesprochen wurde.
Wo Frauen verachtet und entrechtet werden, trifft es auch andere – Homosexuelle, Juden und viele weitere Minderheiten. Wenn wir dazu schweigen und uns selbst verbieten, die dafür Verantwortlichen offen zu benennen und zur Rechenschaft zu ziehen, wird es irgendwann niemanden mehr geben, der gegen eine solche Enteignung unserer Grundrechte aufsteht. Das lehrt die Geschichte.
Neukölln ist ein Ort, an dem globale Konfliktthemen wie im Brennglas wahrgenommen werden können. Vieles, was das Land bewegt, hat hier einen Echoraum mit Tiefenwirkung. Kein Ort in Deutschland hat mehr Kontroversen um integrationspolitische Prozesse entfacht wie dieser, nirgendwo sonst in der Republik gibt es eine so langjährige unaufgeregte Tradition, sich den öffentlichen Debatten über eine Einwanderungsgesellschaft zu stellen.
Hier gibt es kriminelle Clans, die das Land ausrauben, das sie als Flüchtlinge einst aufgenommen hat. Hier gibt es Muslime, die sich offen gegen den Hamas-Terror stellen, obwohl es ihre persönliche Sicherheit dramatisch gefährdet. Hier gibt es Hanukkah-Feiern im Rathaus, während auf der Sonnenallee Halbstarke zur nächsten Intifada aufrufen. Ich begegne Migranten, die gegen Antisemitismus kämpfen, und kenne Hetzprediger, die jeden Freitag ihren giftigen Hass verbreiten und das Land, in dem wir leben, schmähen können. Von Neukölln kann man lernen, was uns gefährdet – aber ebenso, was es braucht, um das, was uns zusammenhält, zu schätzen, zu schützen, zu stärken gegen alle, die unsere freie Gesellschaft bekämpfen.
Wer glaubt, eine solche Entwicklung könne nur hier, in einem von muslimischen Familien und einer arabisch-türkischen Community geprägten Kiez entstehen, sollte sich in der Weltpolitik umschauen. Der Kotau vor den Mächtigen dieser Welt ist umso tiefer, je mehr sie jedes Regelbewusstsein, auf dem eine liberale Demokratie basiert, vermissen lassen, ja es sogar bewusst missachten. Mögen diese selbst ermächtigten Weltenlenker Putin, Trump, Musk heißen oder die Namen der vielen anderen tragen, die ihnen nacheifern – es gibt sie auch bei uns. Noch wirken die hiesigen AfD-Vertreter im Vergleich wie spießige Möchtegern-Radikalinskis, aber sie lernen von den Performances der role models auf der Weltbühne. Je öfter wir ihnen Tor und Tür zur zunehmenden Indienstnahme unserer demokratischen und öffentlichen Institutionen aufmachen, desto stärker werden wir selbst zu Mitverantwortlichen einer Entwicklung, die sich immer weiter von fundamentalen demokratischen Werten entfernt – bis sie, düstere Annahme, möglicherweise zum Totengräber unserer freiheitlichen Grundordnung wird.
Die Zahl derer, die diese freie Demokratie verachten und verabschieden wollen, wächst; wenn wir sie stoppen wollen, müssen wir schnell sein. Wir müssen aufhören, ihre Angriffe als Ausdruck von Meinungsfreiheit zu verteidigen. Wir müssen aufhören, die Kritik an demokratiefeindlichen Praktiken als »islamophob« abzuwehren. Wir müssen reden, offen und ehrlich, über alles, was uns ausmacht, was schützenswert ist und was uns bedroht. Wir müssen dort, wo es etwas zu klären oder zu verändern gibt, Denkgefangenschaften und -verbote überwinden und dort, wo Ideologien unsere freie Gesellschaft zerstören wollen, unmissverständlich Grenzen ziehen und gegebenenfalls zurückschlagen. Alle Extremisten – ob Nationalisten, Islamisten, Faschisten – dürfen nicht länger von unseren freiheitlichen Werten profitieren, um diese zu zersetzen.
Wir müssen deshalb rechtsstaatliche Wege erkunden, um reaktionäre Moscheen zu schließen, und alle Möglichkeiten nutzen, der rechtsextremen AfD entgegenzutreten – bis hin zum Verbot dieser Partei. Noch verfügen wir über das juristische Besteck, um einzuschreiten. Wir müssen nationalistische Haltungen frühzeitiger erkennen und stärker ahnden. Die Meinungsfreiheit muss für alle Antidemokraten, egal welcher Herkunft, enge Grenzen haben. Wir befinden uns in einem Kampf für unsere Werte gegen die Feinde unserer Gesellschaft. Er kann nicht mit mahnenden Worten gewonnen werden, es braucht eine klare Machtdemonstration.
Berlin 2025
Ein Stück Zucker
Aus dem Radio des Dorfältesten hatte mein Vater als kleiner Junge von einer anderen Welt gehört. Einer Welt, in der Kinder ohne Feldarbeit und Schläge aufwuchsen, zur Schule gehen durften und Buntstifte bekamen. Da wollte er hin.
Als er dreizehn war, lief er fort aus den Bergen Dersims in Ostanatolien. Es sollte noch Jahre dauern, bis er nach Bayern kam.
In meinem Schrank stapeln sich Quality-Street-Blechbüchsen von Aldi und Kaffeedosen von Tchibo, das Zuhause vieler Erinnerungen an vergangene Zeiten. Darin findet sich zwischen vielen Zeitungsausschnitten, einem abgelaufenen Reisepass und dem alten Führerschein meines Vaters, einem grauen Lappen, ein etwas verknittertes Foto, das einen kleinen Mann in dunkelblauem Anzug und weißem Hemd am Flughafen Tegel zeigt. In seinen von Arbeit gegerbten Händen ein Strauß roter Rosen. Das Haar ist akkurat gescheitelt, ein kleiner Kamm wird wie immer in seiner rückwärtigen Hosentasche gesteckt haben.
Mein Vater.
Neben ihm, traurig und übernächtigt: ich. Wie ein Nirvana-Groupie im Liebeskummerdelirium.
An diesem Frühlingstag 1994, ich war neunzehn, als ich aus San Antonio, Texas, von einem Schüleraustausch zurückkam, blinzelte die Sonne durch die dreckigen Scheiben des Tegeler Flughafens, und durch die Schlieren sah ich schon aus einiger Entfernung meinen Vater aufgeregt auf und ab laufen. Als er mich endlich kommen sah, drückte er einem vorüberlaufenden Reisenden seinen Fotoapparat in die Hand und bat ihn um eine Aufnahme von uns beiden.
Mein Vater strahlt, seine Augen sind voller Stolz auf mich gerichtet. Er weiß nicht, dass ich beinahe doch nicht in den Flieger nach Hause gestiegen wäre, ich habe es ihm nie erzählt. Dabei hätte er es vielleicht sogar gutgeheißen, wenn ich, Tausende Kilometer entfernt von zu Hause, ausgebrochen wäre aus den Verpflichtungen einer geordneten Lebensführung und mich in ein Abenteuer gestürzt hätte. Mit Jason Krieg, einem SHARP-Skin, dessen Schussverletzung am rechten Unterarm von einer heftigen Auseinandersetzung mit Rechtsextremen zeugte und der allein schon deshalb mein Herz erobert hatte, weil er Bob Marley verehrte. Aber ich war zu pflichtbewusst, um kurz vor den Abiprüfungen die Schule zu schmeißen und mein Leben umzukrempeln. Ich hatte keine Lust, es den vielen Orientierungslosen in meinem Rollbergviertel nachzutun, die Tage und Nächte rauchend, kiffend und trinkend auf der Spielplatzbank gegenüber unserer Wohnung verbrachten.
Back from the USA
Ich blieb also nicht in Texas, ich plante damals auch nicht, noch mal für längere Zeit in ein anderes Land zu fahren, obwohl es mich sehr reizte, mir die Welt anzugucken. Auch wenn ich gerade erlebt hatte, wie sogar das große weite Amerika zu einem bedrückend engen Raum zusammenschnurren konnte, der sich fast wie ein Knast anfühlte.
Als Neuköllner Jugendliche war ich es gewohnt, dauernd mit meinen Freunden draußen im Kiez abzuhängen, bis spätabends. In San Antonio bei Familie Gonzales gab es nur die gemeinsamen Familienstunden vor der Glotze oder den eigenen TV-Abend im Kinderzimmer. Nach draußen zu gehen ohne Aufsicht, war nicht drin.
»Siehst du den Strommast dahinten, gleich neben der Bushaltestelle?«, fragte mich mein Gastvater, als ich das erste Mal einfach mal einige Schritte vors Haus gehen wollte. Wir standen beide vor dem Panoramafenster des Wohnzimmers. »Da haben sie vor zwei Wochen einen Jugendlichen erschossen.«
»Was???«
»Ja, sie haben ihn erschossen, einfach so.«
»Aber was hat das mit mir zu tun?«
Er wurde ungehalten, als er feststellen musste, dass die Gewaltmeldung mich nicht sonderlich beeindruckte. Er konnte ja nicht wissen, dass ich davon zu Hause im Rollberg schon einiges erlebt hatte.
»Hier geht niemand allein aus dem Haus! Wir tragen die Verantwortung für dich. Wenn du spazieren willst, fahren wir dich mit dem Auto zur Mall.«
Tatsächlich fuhren sie mit mir dann regelmäßig zu Ausflügen in die große Einkaufsmall, wo es nach Burgern, Pommes und Pizza roch und man unablässig von Werbeansagen und kitschiger Musik berieselt wurde. Amerika war eben nicht überall die freie Welt, von der mein Vater so schwärmte; auch meine nette hispanische Gastfamilie in San Antonio hatte sich als eifrige Verteidigerin der überall aufgestellten Verbotszonen erwiesen.
Für meinen Vater aber war Texas die weite Welt, aus der seine Tochter nach Hause kam. Die Welt mit ihren vielen Möglichkeiten, die zu erkunden er selbst dereinst so sehnsüchtig erhofft hatte und die doch unerreichbar für ihn geblieben waren. Mahmut kam nur bis Hof in Bayern. Manchmal stelle ich ihn mir vor, wie er, ein gut aussehender junger Mann, zwischen seinen Schichten am Fließband und den kurzen Nächten in den Arbeiterunterkünften seinen Lebenswünschen nachhing. In den ersten Jahren war es noch die Vorstellung, mit dem in Deutschland verdienten Geld ein neues Leben in Istanbul zu beginnen; ein Haus zu bauen, vielleicht ein Geschäft zu gründen, im Dorf seiner Eltern Urlaub zu machen oder dort eine Hütte zu errichten. Er wäre so gern nicht nur von Berlin nach Pülümür, sondern durch die ganze Welt gereist.
Später dann, nach vielen Jahren als Arbeiter in den Berliner Kabelwerken, wird er gespürt haben, dass die Zeit an ihm vorbeigeflogen war und seine Träume ausgewaschen hatte. Nicht er, sondern ich durfte erleben, was er sich einst gewünscht hatte, und er war stolz darauf, wenn sich manches davon in meinem Leben erfüllte. Dafür hatte er sich von seiner Minirente mein Taschengeld für Texas abgespart und sich in seinen dunkelblauen Anzug geworfen, als er mich vom Flughafen abholte – für ihn war mein Ausflug in die USA ein Grund zum Feiern. Und zu feierlichen Anlässen trug er immer seinen Anzug, mochte es ein Elternabend an der Schule sein oder mein Geburtstag.
»Papa, warum hast du dich so schick gemacht?«
»Na, wir gehen doch dein Schule heute.«
»Ja, zur Schule, Papa, nicht auf eine Hochzeit.«
»Is wichtiger als Hochzeit.«
»So ’n Quatsch, Papa!«
»Schule is ordentliche Welt. Arbeiten studierte Leute da. Muss man auch bisschen anpassen sich!«
Wenn meine Eltern das Schulgebäude betraten, wagten sie dort kaum aufzutreten, stiegen die Treppenstufen betont leise hinauf, und jeder, der ihnen auf ihrem Weg zu meiner Klasse begegnete, wurde mit einer fast peinlichen Bewunderung begrüßt. So wichtig ihnen eine gute Schulbildung für ihre Kinder war, für sich selbst, das spürte ich immer, hatten sie das Gefühl, hier eigentlich nicht hinzugehören. Schon im Kindergarten war mir aufgefallen, dass sie anders auftraten als Väter und Mütter, die eine Schulkarriere hinter sich, vielleicht sogar Abitur oder ein Studium absolviert hatten.
Meine Lehrerinnen und Lehrer mochten meinen Vater. Der kleine Mann in seinem ausgebürsteten dunkelblauen Anzug amüsierte sie mit seinem Ausländerdeutsch, seinem Charme und der Ehrerbietung, die er ihnen ganz unverstellt erwies. Aber ich glaube nicht, dass sie sich vorstellen konnten, welch ein Glücksgefühl es für ihn war, dass seine Tochter auf eine »ordentliche« Schule ging. Selbst nach Jahren noch war das für ihn fast nicht zu glauben – das Größte, was ein Mann wie er erreichen konnte. Auf Elternabenden holte er aus der Innentasche seines Jacketts Notizheft und Stift hervor, obwohl er kaum schreiben konnte. Er hatte nur für eine kurze Zeit zur Grundschule gehen können, mehr war nicht drin gewesen für einen Jungen aus einem Bergdorf im ostanatolischen Dersim, in dem Kinder an Grippe starben, weil der nächste Arzt drei Tagesmärsche entfernt war.
Dass seine Jüngste in Amerika gewesen war, war für meinen Vater etwas so Außergewöhnliches, dass er es jedem erzählte. Dabei war ich gerade mal vier Wochen in San Antonio gewesen. Andere müssen gedacht haben, ich hätte dort Jahre gelebt.
Erst viel später habe ich verstanden, welch ein Abenteuer es auch für ihn gewesen sein muss, gleichsam mit mir von Pülümür nach San Antonio zu kommen. Ein Abenteuer, mit dem er mir eine Vielzahl neuer und ungewöhnlicher Erfahrungen ermöglichte. Die mochten mir damals längst nicht alle gefallen, aber später merkte ich, dass sie mir Wege aufzeigten, die ich sonst bestimmt nicht gegangen wäre. Und ich hatte dabei die Welt mit ihren vielen verlockenden Chancen entdeckt, sodass ich beschloss, mich niemals mehr von irgendjemandem einschränken zu lassen.
Als Kind im Neuköllner Rollbergviertel weiß man von solchen Wegen nichts. Man hat keine Vorbilder. Niemand erzählt einem von den vielen Möglichkeiten, die es gibt, auszubrechen aus einer Wirklichkeit, in der sich das Leben in einem klar umrissenen Quadrat abspielt. Im Rollberg aufzuwachsen, bedeutete, dass man schon froh sein konnte, wenn die Eltern nicht soffen und prügelten. Dass andere Kinder und Jugendliche, aus bessergestellten Familien und in anderen Kiezen groß geworden, an internationalen Austauschprojekten und Sprachkursen teilnehmen, um die besten Voraussetzungen für ihre Zukunft zu erwerben, wusste ich damals alles nicht.
Aber ich spürte den unverhohlenen Stolz meiner Eltern. Er stärkte mir oft den Rücken, machte mich selbstbewusst und ließ mich meine eigenen Wege gehen. Manchmal allerdings brachte er mich auch in schwere Verlegenheit. Ich bekomme Schweißausbrüche, wenn meine Mutter, seit ich das Amt einer Integrationsbeauftragten für den Bezirk Neukölln innehabe, vor anderen prahlt: »Sie kann fünf Sprachen und arbeitet für den Senat!«
Dabei ist mein Schulenglisch gerade gut genug, um ausländische Touristen durch Berlin zu lotsen, und mein Französisch reicht höchstens für eine Tischreservierung im Restaurant, für mehr nicht.
Down Under
Mein Vater lebt nicht mehr. Dabei hatte er doch unbedingt sehr alt werden und dabei so lange wie möglich unabhängig bleiben wollen. Er kochte gern und gut. In seiner kleinen Küche in der Schöningstraße 19, Hinterhof, erste Etage, hatte er ein gut sortiertes Gewürzregal und immer eine Flasche Distelöl, weil er überzeugt war, dass alle anderen Fette Gift für sein Herz waren. Als Diabetiker und Herzpatient achtete er sehr auf seine Ernährung. Die guten Dinge, die er im Reformhaus sah, waren immer etwas Besonderes für ihn, aber meist unerschwinglich.
Um fit zu bleiben, lief er in seinen Sportschuhen täglich lange Strecken durch die Stadt. Als seine Hausärztin für einen kleinen oberflächlichen Eingriff an seiner Haut die Blutverdünner absetzte, ahnte er nicht, dass ihn das sein Leben kosten könnte. Wie anderen seiner Gastarbeiterkollegen wurde ihm mangelnde Aufklärung und blindes Vertrauen zu Menschen, die einen weißen Kittel tragen, zum Verhängnis.
Ich vermisse seine rauen Arbeiterhände. Ich erinnere mich noch genau daran, wie es sich anfühlte, wenn er mir als Kind die Tränen aus dem Gesicht strich. Ich war sein »Goldstück«, das sagte er so oft, dass ich heute noch manchmal seine Stimme zu hören meine, die mich mit diesem Namen ruft.
Ich habe einige Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass er mir etwas sehr Kostbares mit auf den Weg gegeben hat, etwas, das für ihn von zentraler Bedeutung war: den Glauben an Freiheit, an die unendlichen Angebote, die sie dem eröffnet, der für sie auch dann einzustehen bereit ist, wenn es ungemütlich wird. Gerade dann.
Nach seinem Tod fand ich in seinen Hinterlassenschaften zwischen Kinderzeichnungen und Postkarten, die ich ihm aus dem Schullandheim geschickt hatte, auch seinen Reisepass, darin das Visum für Australien. Es sollte unsere große gemeinsame Reise werden. Vielleicht hoffte er, dort seinen einst besten Freund Piro wiederzusehen, den es nach Down Under, nicht nach Deutschland, gezogen hatte. Das Geld für unser geplantes Australienabenteuer hatte mein Vater sich von seiner Rente abgespart. 635 DM betrug sie, 350 DM gingen für die Miete drauf. Um nicht »zum Amt« gehen zu müssen, machte er für gut betuchte Rentner die Gartenarbeit. Für Australien legte er dabei noch ein paar Schichten drauf.
Dreizehn
Antreten konnten wir unsere große gemeinsame Reise nicht mehr, der Tod kam uns dazwischen. Ich habe den Pass meines Vaters aufgehoben, er liegt zwischen lauter Schwarz-Weiß- und bunten Fotos aus einer analogen Welt, die die Geschichte meiner Familie erzählen. Sie sollen meinen Kindern zeigen, dass ihr gutes Leben nur möglich ist, weil andere dafür auf ihrem Weg auch etwas verloren haben. Mein Vater hat seine Heimat, so, wie er sie gekannt hat, nie wiedergesehen – mit ihren reißenden Flüssen, den tiefen Schluchten und Wäldern. Die Geisterdörfer in den Bergen Dersims sind heute Ruinen und deren dicke Steinmauern die letzten Zeugen einer zunehmend verblassenden Geschichte.
So schön diese Wildnis war – nie hatte sie die Sehnsucht meines Vaters nach einem Leben jenseits von Ziegenherden und Bienenvölkern verdrängen können, einem Leben, das für Kinder Schuhe, Buntstifte und Spieltage statt harter Feldarbeit bereithielt. Die fast im Rauschen des Weltempfängers erstickten Nachrichten aus dem Radio des Dorfältesten hatten davon erzählt. Sie sprachen von einer Welt, die im verlausten Kopf des kleinen barfüßigen Mahmut zu einer mächtigen Traumlandschaft heranwuchs. Seit er sie kannte, war er entschlossen, eines Tages dorthin zu gehen, es brauchte nur eine Gelegenheit.
Und sie kam. Als sein Vater ihn eines Tages wegen eines gestohlenen Zuckerstücks windelweich schlug, wartete er nur noch auf den Moment, da er genug Kraft und Mut beisammenhatte, um von zu Hause wegzulaufen und sich in den Wäldern der Ausläufer des Taurusgebirges durchzuschlagen. Zu Fuß und per Anhalter gelangte er nach Istanbul. Da war er dreizehn, arbeitete in der Stadt auf Baustellen, als Putzkraft, als Tagelöhner und in einer Großbäckerei, schlief mal hier, mal dort und hatte es letztlich einem vornehmen jüdischen Geschäftsmann zu verdanken, dass er in der großen, wilden Metropole am Bosporus nicht unterging. Die Freundschaft mit diesem Mann, dessen Namen mein Vater leider nie erwähnte, hat seine politischen Ansichten geprägt. Mein Vater verabscheute zeitlebens jede Ideologie, jeden Extremismus und vor allem jedwede Schattierung von Antisemitismus. Antisemiten verkörperten für ihn immer eine Anhäufung schlechtester Charaktereigenschaften.
In Istanbul blieb er nicht. Eines Tages steckte er seine Lira ein und fuhr von Sirkeci in Istanbul nach Münchberg bei Hof.
Hulusis Trauma
Es waren die 1960er-Jahre, und bei den einfachen Menschen in der Türkei herrschte Aufbruchstimmung. Eine Arbeit in Deutschland versprach die Aussicht auf ein besseres Leben, auch ohne eine gute Schulbildung, auch ohne Geld. Die meisten Gastarbeiter kamen aus armen Verhältnissen, so wie auch Hulusi, ein Freund meines Vaters. Sein Name stammt aus dem Arabischen und bedeutet »aufrichtig« und »herzlich«.
Hulusi machte sich gemeinsam mit seiner Frau Hatice auf den Weg, auch ihr dreijähriger Sohn ging mit auf die große Reise. Hulusi wollte seine schwangere Frau nicht mit dem Kleinen im Dorf zurücklassen. Er hat diesen Entschluss sein Leben lang bereut. Nach zwei Tagen hielt der Zug plötzlich mitten in der Nacht an. Hulusi und seine Familie waren zuvor noch nie mit einem Zug gefahren und waren durch den unvorhergesehenen Stopp verunsichert und aufgeregt. Sie wussten nicht, was der Halt bedeutete. Sie wollten doch unter keinen Umständen ihren Bahnhof verpassen, so erzählte es uns meine Mutter später.
Irgendjemand im Zug hatte gesagt, dass man hier aussteigen müsse, also kletterten Hulusi und Hatice mit ihrem Sohn aus dem Waggon. Es war stockfinster und kein Bahnhof in Sicht. Als sie erkannten, dass sie auf den Gleisen eines herannahenden Zuges standen, war es bereits zu spät. Hatice sprang zur Seite, doch ihr kleiner Sohn blieb zurück. Sein Tod wurde für die Familie zum unauflösbaren Trauma, einem Schicksalsschlag, von dem sie sich nie wieder erholte. Hulusi und Hatice bekamen noch drei Kinder, trennten sich jedoch später. Hulusi trank, er starb einsam und schwer krank auf den Treppenstufen zur Wohnung seines Sohnes Tarik. Er hatte ihn noch ein letztes Mal sehen wollen, doch seine drei erwachsenen Kinder hatten seit Langem schon jeden Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen.
Ich erinnere mich gut an Onkel Hulusi, der gern mit uns im Tiergarten grillen ging. Meist packten wir gemeinsam die Autos voll bis oben hin mit Essenssachen, Klappstühlen, Bällen und anderem Spielzeug, auch das Radio kam mit. Dann fuhren wir, eine ganze Autokolonne von Verwandten und Freunden, von Neukölln zur großen Wiese vor dem Reichstag, um dort bis zum Abend zu bleiben. Onkel Hulusi scheute keine Mühen, uns Kindern den Aufenthalt im Park so schön wie nur möglich zu gestalten. Einmal weinte ich, weil meine Eltern mir nicht erlaubt hatten, einen Sack mit Spielsachen mitzunehmen. Da kam Onkel Hulusi, nahm den Sack und stopfte ihn in sein Auto.
Ich wusste aus den Erzählungen meiner Mutter aber auch, dass seine Hand locker saß und seine Familie die Hölle der Gewalt durchlebt hatte. Solche Gewaltausbrüche waren in den ersten Gastarbeitergenerationen keine Seltenheit: Das Leben in der Fremde bedeutete Stress, oft Verzweiflung und Trauer.
Gott war noch nie auf unserer Seite
Mein Vater hatte viele Freunde, aber zu fast allen verlor er im Laufe der Jahre den Kontakt. Die früheren Beziehungen und Netzwerke, wie man sie in den Dörfern gepflegt hatte, wurden immer brüchiger. Viele Gastarbeiter versanken in Einsamkeit. Mit dem Alter veränderte sich ihre Lebenssituation. Wir Kinder hatten oft ohnehin keine Lust auf Verwandtenbesuche, wir empfanden die ganzen Familien- und Zugehörigkeitszwänge eher als lästig. Warum sollte man sich mit Cousinen und Cousins verstehen, wo es doch eine ganze Stadt voller Menschen gab, mit denen man meist viel mehr teilen konnte? Das verstanden die Alten nicht.
Einer der wenigen, mit denen mein Vater bis zuletzt regelmäßig telefonierte, war Piro Yilmaz. Piro, so nannten sie einander als Zeichen einer bestimmten zazaischen Wahlverwandtschaft, die ich nie so richtig begriffen habe. Piros wirklichen Namen kenne ich gar nicht, obwohl er in meiner Erinnerung einer von Vaters besten Freunden war.
Piros Vater war ein Dede gewesen, ein Weiser, ähnlich wie mein Großvater, der über heiße Steine laufen und mit selbst gebastelten Amuletten das Böse bannen konnte. Piro Yilmaz hatte nicht viel übrig für solche Mythen und Legenden, über Glauben und Aberglauben machte er sich nur lustig. Wahrscheinlich hatte mein Vater ihn deshalb so gern. Und vermutlich auch, weil Piro etwas von gutem Whisky verstand.
Piro Yilmaz wollte nicht in Deutschland bleiben. Ihn zog es ins geheimnisumwobene Australien. Dahin wollte er am liebsten auch meinen Vater locken.
»Piro«, umwarb Yilmaz meinen Vater, »dort gibt es Vögel in allen Farben und Formen, Tiere, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Und das Land, so unendlich weit!«
»Piro Yilmaz«, hielt mein Vater dagegen, »hier gibt es Ordnung, die Deutschen sind gute Menschen, sie haben uns gut aufgenommen. Bei Gott, was hat uns die Türkei gegeben?! Das hier ist echtes Mutterland.«
»Piro Mahmut, hör auf mit Gott! Der war doch noch nie auf unserer Seite!«
Dann lachten beide, machten Witze über Gott und über Menschen, die sie kannten.
Meine letzte Erinnerung an die beiden Männer ist das Bild, als sie in ihren blank polierten guten Schuhen das Auto meines Vaters umkreisten, einen Ford Transit, eine Familienkutsche mit selbst genähten Vorhängen, dabei hatte mein Vater bisher doch immer die viel eleganteren Gastarbeiterkarren wie den Opel Kapitän oder den Opel Diplomat gefahren. Aber der Ford sollte seiner ganzen Familie Platz bieten, denn er wollte mit uns, seinen vier Kindern, und Fatma, unserer Mutter, in die Türkei reisen, Verwandte besuchen.
Im Land der Autos und der Ordnung
Seine Leidenschaft für alte, formschöne Autos mit viel Chrom und weicher Federung habe ich geerbt. Jahrelang schleppte ich einen alten Opel Rekord D von 1976 wie ein Totem durch alle Etappen meines Lebens. Oft staubte er in einer heruntergekommenen Garage vor sich hin, um dann immer mal wieder eine Runde durch Berlin zu drehen.
Im Jahr 2000 hatte ich ihn zufällig auf einem ziemlich abgewrackten Autoplatz entdeckt und, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, für damals 1200 DM gekauft. Da wusste ich noch nicht, dass es so ein Opel Rekord D gewesen war, mit dem meine Eltern 1974 mit meinen Geschwistern zum ersten Mal wieder in die Türkei gereist waren. Meine Mutter war mit mir schwanger, als sie ihr Heimatdorf in Dersim besuchten. Irgendwie muss ich in ihrem Bauch die besondere Federung des Opels wie eine Wiege empfunden haben, die ich später in meinem Leben wiederholen wollte.
Als ich meinem Vater den glänzenden Wagen zum ersten Mal vorführte, liefen ihm Tränen über die Wangen, und bei einem Glas Tee erzählte er mir von der ersten großen Reise in die einstige Heimat. Aber da hatte er in meinem Heimatland längst Wurzeln geschlagen.
Von Deutschland war er nicht mehr wegzubringen. In seinen Augen war es das Land der Ordnung, der sicheren Arbeitsverträge, der Wohnungen, in denen es warm wurde, das Land, in dem die Männer sonntags Krawatten trugen, alle Kinder zur Schule gingen, das Land, in dem sich mit ein wenig Verzicht die Träume des kleinen Mannes in naher Zukunft verwirklichen ließen. Das war das Versprechen.
Ich habe bei solchen Gesprächen, wenn meine Eltern oder andere Verwandte über Deutschland sprachen, schon als Kind immer mit großen Ohren zugehört, denn was ich zu Hause erfuhr, stand oft in großem Kontrast zu den Erzählungen türkischer Klassenkameraden in meiner Schule. Vieles war bei uns ganz anders als bei meinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ich kannte es nicht, dass man abfällig über »die Deutschen« sprach, weil sie Schweinefleisch aßen und ihre Frauen als zu freizügig galten. Ich wusste auch nicht, warum es eine »Schande« sein sollte, nicht Türkisch zu sprechen, das mir einige meiner türkischen Mitschüler aufoktroyieren wollten. Denen war ich »zu deutsch«. Von ihnen hielt ich mich fern.
Nicht alle waren so, aber türkisch nationale Einstellungen, oft religiös verbrämt, gingen mir auf den Geist. Dieses »Wir Türken gegen die anderen«, das war ein Ton, der mir schon früh missfiel. Ich kannte nur den Gegensatz zwischen Menschlichkeit und Dummheit. Und Letztere, so pflegte mein Vater zu sagen, ist unser größter Feind. Sie sucht immer nach einfachen Antworten und noch viel einfacheren Heilsversprechen. Die Dummheit kennt nur Schwarz oder Weiß, Gut oder Böse – keine Ambivalenzen, keine offenen Fragen, nur ein dumpfes Ich, dessen Selbstwert sich aus einer Hybris speist, dem Glauben, dass im Himmel ein bunter Jahrmarkt auf alle Gottgefälligen wartet.
Meinen Eltern waren demokratische Gesetze heilig, heilige Schriften hatten sich ihnen unterzuordnen. Sonst würde jeder glauben, seine Trommel müsse unbedingt den Ton angeben, meinte meine Mutter. Deutschland hat uns gerettet, sagte sie, vor Willkür und Unwissenheit, Deutschland hat Licht in unser Leben gebracht.
Meine Mutter hat die Lektion der Aufklärung auch ganz ohne Schulbildung verstanden.
Mal Sonne, mal Regen, so ist das Leben
Meine Mutter war noch ein Kind, das Ziegen und Schafe in den Bergen hütete, als sie sich in meinen Vater verliebte. Und ihn trotz der Warnungen meines Großvaters vor den »Taugenichtsen aus der Balci-Sippe« heiratete. Die Ehe hielt lange, aber nicht ewig. Als ich neun war, trennte meine Mutter sich von ihrem Mann. Die Scheidung war für die Traditionalisten unter unseren Verwandten eine Sünde.
In meiner Sammlung gibt es ein Männerfoto aus den 1960er-Jahren. Zusammen mit drei anderen jungen Männern sitzt mein Vater vor Stockbetten und einer mit Lametta geschmückten Tanne an einem kargen Tisch in einer der Arbeiterunterkünfte in Hof. Alle vier sind sorgfältig frisiert, trinken Bier und lachen in die Kamera. Auf die Rückseite des Fotos hat ihm sein Freund eine Widmung geschrieben: Lieber Mahmut, dieses leblose Abbild von mir soll dich immer an unsere gemeinsame Zeit erinnern, in dieser vergänglichen Welt, in der niemand weiß, wo es uns hintreiben wird.
Solche Schnappschüsse waren damals unter den Gastarbeitern vorzeigbare Beweisstücke, dass man auf dem Weg zu einem besseren Leben war. Es hatte sich gelohnt, sich aufzumachen. Man hatte solche Fotos immer bei sich, trug sie in der Brusttasche und zeigte sie stolz herum. Ein Foto zu besitzen, war an sich schon etwas Besonderes, Bier zu trinken und Spaß zu haben, auch. Dazu gehörten zuweilen auch deutsche Frauen, die sich ohne Angst vor Ehrverlust auf ein Abenteuer mit den »ausländischen« Männern einließen. Die Antibabypille machte manches möglich, auch wenn die Mehrheit der westdeutschen Frauen zu der Zeit noch von Küche und Kindern beansprucht wurde und finanziell am Tropf ihrer Ehemänner hing. Aber es gab schon das »Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts«. Und auch die »Pille« verlieh der Frauenemanzipation einen kräftigen Schub. Daran konnte selbst die »Pillen-Enzyklika« nichts ändern, mit der der Papst den Gläubigen das Verhütungsmittel verbieten wollte.
Plastikschuhe aus der Großstadt
In den Bergdörfern, in denen meine Eltern zu Hause waren, wusste man nichts von Pille, Papst und Frauenemanzipation. Auch Gleichberechtigung wäre dort ein unverständliches Fremdwort gewesen.
Die Welt meiner Mutter waren Ziegen, Kühe und Schafe, die sie frühmorgens hoch in die Berge trieb. Sie war ein wildes, aufgewecktes Mädchen, das andere Menschen gekonnt parodieren und alle zum Lachen bringen konnte. Und sie konnte wunderbar singen. Das half, um den harten Arbeitsalltag zu überstehen. Schon im Alter von sechs Jahren musste sie täglich viele Hundert Tiere allein auf die Bergweiden bringen. Kinderarbeit, egal wie schwer, war in Pülümür selbstverständlich. Der Arbeitstag begann für sie mit dem Sonnenaufgang, die Tiere mussten versorgt, die Ställe sauber gehalten werden.
Brot backen, Wasser holen, Joghurt und Käse herstellen, all das konnte sie schon in einem Alter, in dem man als Berliner Kind gerade mal gelernt hat, sich die Schuhe selbst zuzubinden. Doch vergleichbare Schuhe gab es in ihrem Dorf für die meisten Kinder gar nicht, höchstens Tsarik, grobe, selbst gemachte Lederriemenschuhe, oder Lastik, Plastikschuhe aus der Großstadt. Die waren ihrer leuchtend bunten Farben wegen schon etwas Besonderes und deswegen auch sehr begehrt.
Die kleine Fatma zerschliss viele Plastikschuhe, wenn sie, rennend und springend wie eine Ziege, mit ihren Herden durch die Berglandschaft zog. Einmal war sie so müde, dass sie neben den Tieren einfach einschlief. Als sie erwachte, lagen die leblosen Körper zweier gerissener Lämmer dicht neben ihr. Der Wolf war längst verschwunden, und die verängstigten Tiere waren ebenfalls auf und davon, in alle Richtungen geflüchtet. Meine Großmutter hat Fatma an diesem Tag ein großes Lokma-Brot gebacken und es als gesegnetes Mahl an alle im Dorf verteilt. Es ist eine Tradition, um Dankbarkeit auszudrücken, und meine Mutter pflegt sie bis heute.
Lokma-Brot ist sehr schmackhaft, es wird mit viel Butter, Joghurt und Milch zubereitet, ein Stück davon ersetzt eine ganze Mahlzeit. Früher, als meine Tanten noch lebten, gab es regelmäßig Lokma-Besuche. Immer gab es etwas, wofür man dankbar war: dass die Geburt der Tochter gut gegangen war, dass das Engelchen seine Milchzähne bekam, dass jemand sein Abitur geschafft hatte oder von einer langen Reise gesund zurückgekehrt war.
Vielleicht war es die Erinnerung an die leuchtenden Farben der Plastikschuhe, die die kleine Fatma einst getragen hatte und die etwas so Begehrenswertes für sie gewesen waren, dass meine Mutter sich in Deutschland von ihrem ersten selbst verdienten Geld zwei quietschbunte Kissenbezüge mit eingestickten Motiven kaufte. Einer ist mir bei meinen vielen Umzügen abhandengekommen. Den anderen hebe ich sorgsam auf.