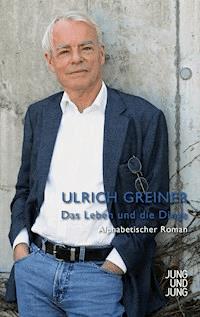9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Ich wüsste nicht, welcher Partei ich meine Stimme gäbe.» Links zu sein, ist in Deutschland kein Problem. Aber kann man auch konservativ sein? Oder ist man dann rechts? Ulrich Greiner nimmt für sich das Recht in Anspruch, konservativ geworden zu sein. Und er stellt fest, dass der konservative Gedanke in Deutschland politisch und intellektuell heimatlos geworden ist. Weil er vom Diskurs der Mehrheit abweicht, ist er in der rechten Ecke gelandet. Doch die alten Kategorien greifen nicht mehr, die ideologischen Fronten nehmen einen neuen Verlauf. Was also kann es in Zeiten von Ehe für alle, Flüchtlingskrise und Trump bedeuten, konservativ und dabei doch aufgeklärt zu sein? Wer vertritt die Kritik an einer immer stärkeren Verflechtung Europas? Woher kommt der deutsche Selbsthass? Wie elitär ist der Multikulturalismus? Was gilt es von der geistigen Tradition des christlichen Abendlandes in der globalisierten Welt zu bewahren? Solchen Fragen stellt sich der langjährige Feuilleton-Chef der «Zeit». Sein Buch ist der streitbare Versuch, im Jahr der Bundestagswahl den politischen und intellektuellen Raum für einen modernen Konservativismus auszuloten – jenseits von politischer Korrektheit und diesseits der AfD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ulrich Greiner
Heimatlos
Bekenntnisse eines Konservativen
Über dieses Buch
«Ich wüsste nicht, welcher Partei ich meine Stimme gäbe.»
Links zu sein, ist in Deutschland kein Problem. Aber kann man auch konservativ sein? Oder ist man dann rechts? Ulrich Greiner nimmt für sich das Recht in Anspruch, konservativ geworden zu sein. Und er stellt fest, dass der konservative Gedanke in Deutschland politisch und intellektuell heimatlos geworden ist. Weil er vom Diskurs der Mehrheit abweicht, ist er in der rechten Ecke gelandet.
Doch die alten Kategorien greifen nicht mehr, die ideologischen Fronten nehmen einen neuen Verlauf. Was also kann es in Zeiten von Ehe für alle, Flüchtlingskrise und Trump bedeuten, konservativ und dabei doch aufgeklärt zu sein? Wer vertritt die Kritik an einer immer stärkeren Verflechtung Europas? Woher kommt der deutsche Selbsthass? Wie elitär ist der Multikulturalismus? Was gilt es von der geistigen Tradition des christlichen Abendlandes in der globalisierten Welt zu bewahren?
Solchen Fragen stellt sich der langjährige Feuilleton-Chef der «Zeit». Sein Buch ist der streitbare Versuch, im Jahr der Bundestagswahl den politischen und intellektuellen Raum für einen modernen Konservativismus auszuloten – jenseits von politischer Korrektheit und diesseits der AfD.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Stephan Speicher
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-00110-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1Die Angst vor einer konservativen Wende – Die linksgrüne «kulturelle Hegemonie» – Die Selbstbezüglichkeit der Medien
Die Angst geht um. Wovor? Es sind nicht allein die Gespenster von Donald Trump, Marine Le Pen, Geert Wilders und den anderen, wie immer sie heißen mögen. Es ist die Angst vor einer konservativen Wende. Nicht so sehr das Traditionsbürgertum leidet an dieser Angst, schon gar nicht die vielfach entpolitisierte Unterschicht, sondern es leiden die Linken und die Grünen und die dominanten Akteure der Mehrheitsparteien, es leidet die kommentierende Klasse in den Medien. Sie alle fürchten, die Hoheit über den sogenannten Diskurs zu verlieren und die bislang unangefochtene Macht, die moralischen Standards des Öffentlichen zu bestimmen. Käme es dahin, ich würde es begrüßen.
Mit konservativer Wende ist natürlich nicht jene «geistig-moralische Wende» gemeint, die Helmut Kohl im Bundestagswahlkampf 1980 angekündigt hatte, von der aber, als er dann 1982 Kanzler wurde, nicht viel übrig blieb, zur Genugtuung nicht nur seiner Gegner. Nein, die Wende, die sich derzeit ereignet, geht viel tiefer, und sie betrifft nicht allein Deutschland, sondern viele Länder der westlichen Welt. Diese Wende nimmt Abschied vom Panorama-Blick auf die Erdkugel, sie biegt ab ins Nahe und Heimatliche. Das wäre die freundliche Beschreibung. Die unfreundliche lautet, dass der alte Nationalismus zurückgekehrt sei und mit ihm eine neue Feindseligkeit gegen alles Fremde und Kosmopolitische.
Wahr ist: Das einst verheißungsvolle Bild einer multikulturellen Gesellschaft mit offenen Grenzen hat seinen Glanz verloren. Die Idee einer Gemeinschaft aller Nationen, die auch religiöse und kulturelle Gräben überwinden könnte, ist nicht zuletzt am islamistischen Terror zuschanden geworden. Die Globalisierung erscheint nicht mehr als ein Zukunftsversprechen, das früher oder später allen Menschen zugutekäme, sondern als der Kampfplatz weltumspannender Konzerne, deren Produkte bis ins letzte Schaufenster der Provinz vorgedrungen sind. Und aus der Vision eines europäischen Bundesstaates, der aus den vormals sich bekriegenden Ländern eine Vereinigung machtvoller Mitspieler im weltpolitischen Maßstab machen sollte, ist ein bürokratisches Monstrum geworden, dessen Regulierungswahn in jedermanns Alltag lästige Folgen zeitigt. An die Stelle eines Europas, dessen Kultur vom Sternenkranz der geeinten Mitgliedsstaaten überwölbt wird, ist das schäbige Gezeter um den Schuldenerlass für insolvente Länder getreten. Aus «Europa!» ist «Brüssel!» geworden.
Natürlich kann man diese Entwicklung beklagen, und auch mir gefällt sie nicht. Was mir aber noch weniger gefällt, ist der Versuch der Internationalisten, wie ich sie summarisch nenne, das bunte Sammelsurium all jener, die eine Rückkehr ins historisch Gewordene und halbwegs Bewährte anstreben, als kleinkariert oder reaktionär zu beschreiben und kurzerhand in die rechte Ecke abzuschieben. Dass dieses Manöver auf Dauer nicht gelingen kann, scheint mir offenkundig. Es wirkt auch deshalb ein bisschen hilflos, weil alles, was dem herrschenden Diskurs missfällt, mit dem verächtlichen Begriff des «Populismus», meist verstärkt durch den des «Rechtspopulismus», diffamiert wird, gerade so, als ob es nicht auch einen Linkspopulismus gäbe. Populisten sind immer die anderen.
Die einst plausible Rede vom «Ende der Ideologie» (Daniel Bell) und vom «Ende der Geschichte» (Francis Fukuyama) ist von der Wiederkehr der Ideologie und vom Fortgang der Geschichte überrollt worden. Und als Folge davon sind die fast vergessenen Fronten zwischen rechts und links, zwischen konservativ und progressiv abermals aufgebrochen. Im Grunde ist das völlig normal. Demokratie lebt von Streit, von Opposition, und wo es Linke gibt, muss es auch Rechte geben. Doch nicht selten dringen die Extremisten beider Seiten in jenes finstere Gelände vor, das infolge der totalitären Exzesse des 20. Jahrhunderts bis heute vermint ist. Die Wunden, die damals geschlagen wurden, ob von Hitler oder von Stalin, sind nicht verheilt. Im deutschen Fall ist die nationalsozialistische Schreckensherrschaft eine stetige Warnung, und sie muss eine Warnung bleiben. Weshalb sich kokettriskante Annäherungen wie von Seiten der AfD verbieten.
Das heißt nun aber nicht, dass jede Abweichung von der Mitte nach rechts mit dem Nazi-Vorwurf mundtot gemacht werden dürfte. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass der unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen im Herbst 2015 ein Fehler war, der bei rechtzeitiger Vorsorge hätte vermieden werden können, und dass die Warnung vor einer Islamisierung nicht bloß das Hirngespinst verwirrter Pegida-Anhänger ist. Ich glaube weiterhin, dass der im Grundgesetz garantierte Schutz von Ehe und Familie die gleichgeschlechtlichen Lebensformen nicht mit einschließt. Die damit nicht selten verbundenen Praktiken biotechnischer Reproduktion erregen meinen Widerwillen. Auch finde ich die Beschlüsse der Brüsseler Kommission zur Rettung von Banken und insolventen Staaten nicht hinreichend demokratisch legitimiert – und die dabei maßgebliche Rolle von Angela Merkel erst recht nicht. Wer den Euro für einen kapitalen Fehler hält, ist noch kein Gegner der europäischen Idee.
Das sind nur ein paar Beispiele eines Konservatismus, den ich auf den folgenden Seiten näher beschreiben möchte. Ein solcher Konservatismus müsste in meinen Augen christlich begründet sein. Nach wie vor finde ich, dass die Idee des christlichen Abendlandes, ungeachtet ihres Missbrauchs durch Ausgrenzungsfanatiker, richtig und tragfähig ist. Ein solcher Konservatismus, dessen bin ich mir bewusst, könnte keinesfalls mehrheitsfähig werden, doch wäre schon viel gewonnen, wenn ihn der mediale Diskurs als seriös anerkennen würde.
Es kommt mir nicht darauf an, eine konservative Theorie zu entwickeln, das haben andere und Klügere schon getan. Wenn ich mich auf sie beziehe, so deshalb, um geistige Verwandtschaften zu entdecken und meinem eigenen Sinneswandel auf die Spur zu kommen. Er geschah sozusagen unbemerkt. Ich war eigentlich immer ein SPD-Wähler, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Einmal habe ich die längst vergessene Deutsche Friedens-Union (DFU) gewählt, ein paarmal die Grünen, nie CDU oder FDP. Mein allmählich entstandener Konservatismus hat sicherlich mit dem Älterwerden zu tun und mit der Beobachtung, dass das überall herrschende Prinzip ständiger Neuerung dazu verleitet, das Bewahrenswerte gering zu achten. So ist meine konservative Haltung kein politisches Programm, sondern eher ein Lebensgefühl. Ich betrachte, höre, lese die bedeutenden Kunstwerke unserer reichen Vergangenheit mit größerer Aufmerksamkeit als früher. Verglichen damit kommen mir allzu viele Manifestationen der Gegenwart unerheblich und bloß modisch vor. Dass etwas neu ist, scheint mir noch kein hinreichendes Argument, um es gut zu finden.
Es ist aber keineswegs so, dass der Konservatismus, den ich vertrete, keine Anhänger hätte. Konservative finde ich nicht allein unter meinen Freunden und Bekannten, nicht allein unter namhaften Intellektuellen wie Rüdiger Safranski und Sibylle Lewitscharoff, Martin Mosebach oder Peter Sloterdijk, sondern auch unter den erstaunlich vielen Lesern, die meine diesbezüglichen Beiträge in der «Zeit» zustimmend begleiten. Was sind das für Menschen? Mit Sicherheit keine, die völkische Ressentiments hegen und etwa die deutsche Schuld leugnen wollten. Welche Partei sie mehrheitlich wählen, weiß ich nicht, und ich vermute, dass sie in demselben Dilemma stecken wie ich.
Unter der Ägide Angela Merkels ist die CDU so weit nach links gerückt, dass der Konservative in ihr keine Heimat mehr findet. Da wäre er in den traditionsgeleiteten Parzellen der ruhmreichen SPD fast besser aufgehoben. Die Grünen hingegen, die Partei der Menschheitsretter und Weltverbesserer, wird der Konservative nur mit Vorbehalt wählen, und die FDP, die Partei des totalen Anpassertums, scheidet für ihn sowieso aus. Bliebe die AfD. Manchen ihrer grundsätzlichen Positionen wird der Konservative zuneigen, aber noch ist das ein bunt oder eher braun gemischter Haufen mit allzu oft degoutanten Erscheinungen.
Es ist übrigens von einigen Beobachtern schon festgestellt worden, dass die Entstehungsgeschichte der Grünen verblüffende Parallelen zur AfD aufweist: die Kritik an der Elite und am Establishment, die Idee einer Alternative zur herrschenden Politik, der Gedanke einer außerparlamentarischen Opposition. Auch ideologisch gesehen war bei den Grünen anfangs nahezu alles zu finden, von dem ehemaligen NSDAP-Mitglied Baldur Springmann, der das Völkische liebte, bis hin zu dem waschechten Kommunisten Thomas Ebermann. Beide sind sie längst vergessen, doch wird man daraus ersehen, wie lange es dauern kann, bis sich diffus gestaute Gedankenflüsse in einem halbwegs einheitlichen Strom zu sammeln beginnen.
Dieses Buch trägt den pathetisch klingenden Titel «Heimatlos». Es gibt eine gleichnamige Erzählung von Johanna Spyri, eine sehr schöne und sehr sentimentale, die mich als lesendes Kind zu Tränen gerührt hat. Aus diesem Alter bin ich glücklich heraus. Als Konservativer jedoch bin ich insofern heimatlos, als die Leitmedien, von den tonangebenden Zeitungen bis hin zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ganz überwiegend einen Anpassungsmoralismus pflegen, der gegensätzlichen Meinungen keinen Resonanzboden bietet. Das gilt für die politischen Parteien erst recht. Ich erwarte von ihnen durchaus nicht, dass sie mir eine Heimat im Sinne eines traulichen Beisammenseins bieten, doch zuweilen hätte ich es ganz gern, wenn ich denn schon wählen darf und soll, die eigenen Überzeugungen oder Befindlichkeiten irgendwo zu entdecken. Und da sehe ich keine Partei, von Einzelgängern darin abgesehen, in der ich meine Überlegungen und Bedenken wiederfinden könnte. Es kommt mir so vor, als wären sie mehr oder minder alle von einem Augenblicksopportunismus erfasst, der es ihnen gebietet, bestimmte Dinge lieber nicht auszusprechen, um keinen falschen Beifall zu erzielen.
Im Herbst 2015 hat keine der etablierten Parteien (mit Ausnahme der CSU, die ich nicht wählen kann) die Sorgen vieler Bürger vor einem ungehemmten Zustrom vornehmlich islamischer Einwanderer ernst zu nehmen und zu diskutieren gewagt. Erst als sich die Stimmung im Land drehte, wurden beispielsweise Forderungen laut, den Migrationshintergrund bestimmter Straftäter nicht länger zu verschweigen. Ebenso haben nahezu alle Parteien die von Angela Merkel «alternativlos» genannte Politik der Euro-Rettung gebilligt oder schweigend ertragen, während es doch mittlerweile auf der Hand liegt, dass die Rettung der EU durch ein hartnäckiges «Weiter so» nicht gelingen kann, erst recht nicht durch eine «vertiefte Integration».
Der oft gehörte Satz, man könne gewisse Dinge nicht mehr sagen, stimmt nicht. Man kann bei uns eigentlich alles sagen, und es wird ja auch gesagt, zumindest im Netz und an den Stammtischen. Woran liegt es aber, dass das, was man dort zu lesen und zu hören kriegt, so oft abgeschmackt und abstoßend klingt, erfüllt von Ressentiments? Es liegt nicht nur an jenem Quantum Dummheit, mit dem jede Gesellschaft leben muss. Es liegt auch daran, dass sich der Diskurs seit längerem schon vereinseitigt und simplifiziert hat, dass die Ängste vieler Menschen vor dem sozialen Abstieg, vor dem Verlust des Heimatlichen und Vertrauten und vor einer kulturellen Überfremdung, dass diese Ängste in den Rede- und Argumentationsweisen der Elite kaum oder gar nicht vorkommen. Was «unten» geredet wird, ist häufig ein Echo dessen, was man irgendwo gelesen und gehört hat. Und wenn «oben» ganze Themenfelder ausgespart bleiben, dann verzichtet die sprachmächtige, die tonangebende Klasse auf ihren mäßigenden, zivilisierenden Einfluss. Dann sinken ernste Fragen auf den sprachlosen Grund des Unverstandenen, und dieser Grund, darüber muss sich niemand wundern, ist schlammig und nicht selten braun.
In seinem vieldiskutierten Buch «Rückkehr nach Reims» stellt der französische Soziologe Didier Eribon konsterniert fest, dass die Arbeiterschaft, aus der er einst kam, früher selbstverständlich kommunistisch gesinnt war, sich heute hingegen ebenso selbstverständlich von der politischen Rechten vertreten fühlt. Er sieht die Ursache nicht allein im Wandel der Arbeitswelt, sondern vor allem darin, dass die Parteien es verlernt haben, für diejenigen, die keine Stimme und keine Sprachfähigkeit besitzen, als Fürsprecher aufzutreten. Eribon stellt die Frage, «wer auf welche Weise an welchen politischen Entscheidungsprozessen teilnimmt – und zwar nicht nur am Erarbeiten von Lösungen, sondern bereits an der kollektiven Diskussion darüber, welche Themen überhaupt legitim und wichtig sind und daher in Angriff genommen werden sollten». Und er gelangt zu einem Befund, der nicht allein für Frankreich Gültigkeit besitzt: «Wenn die Linke sich als unfähig erweist, einen Resonanzraum zu organisieren, wo solche Fragen diskutiert und wo Sehnsüchte und Energien investiert werden können, dann ziehen Rechte und Rechtsradikale diese Sehnsüchte und Energien auf sich.»[1]
Das nun ist inzwischen auch in Deutschland geschehen, und die linksgrüne «kulturelle Hegemonie» – ein Begriff, der auf den italienischen Kommunisten Antonio Gramsci zurückgeht – neigt sich dem Ende zu. Giovanni di Lorenzo hat den Zusammenhang zwischen der «Allmacht der Grünen» und dem Aufstieg rechter Parteien in der «Zeit»[2] näher beschrieben. Als der Faschismus in Italien siegte, habe sich Gramsci gefragt, «warum es in den bürgerlichen Gesellschaften des Westens zu keiner Revolution gekommen war – und ob es einen strategischen Ausweg gab, um doch die Herrschaft zu erlangen. Wenn eine Gruppe die Macht wolle, argumentierte Gramsci in seinen berühmten ‹Gefängnisheften›, müsse sie zuvorderst den Kampf um die Köpfe gewinnen, ihre Weltanschauung müsse sich zum Beispiel in der Presse, in den Schulen, in der Kirche, bei den Intellektuellen als die überzeugendste durchsetzen.»
Diesen Weg, so Giovanni di Lorenzo, hätten die Grünen erfolgreich beschritten. Nun aber stehe ihre kulturelle Hegemonie möglicherweise vor dem Ende: «Eine Gegenhegemonie […] breitet sich aus, die lange unvorstellbar schien: der Vormarsch populistischer und rechter Bewegungen überall in Europa, inzwischen auch in unserem Land. Dies ging einher mit den Exzessen der Grünwerdung Deutschlands: der Überhöhung der Political Correctness, dem Glauben an die Erziehbarkeit des Menschen bis zur Niederschlagung alles Bösen, der Neigung der tonangebenden Milieus, von sich auf den Rest der Bevölkerung zu schließen. Und während sich viele im Lande freuten, dass anscheinend alle dafür waren, in Kinderbüchern das Wort ‹Eskimo› durch ‹Inuit› zu ersetzen, damit sich in Grönland keiner beleidigt fühlt, oder ein beliebter FDP-Politiker wegen einiger plumper, anzüglicher Bemerkungen gegenüber einer jungen Journalistin verdammt wurde und in der Bedeutungslosigkeit verschwand, gab es immer auch Menschen, die das alles mit Unverständnis, mit Ratlosigkeit und schließlich mit wachsender Wut zur Kenntnis nahmen. Es fanden sich für sie zwar Ventile, etwa im Netz, aber kein nennenswertes politisches Sprachrohr.»
Dieses Sprachrohr hat sich mittlerweile gefunden, und zwar zuerst in den Manifestationen der Pegida-Leute. Die Medien haben die teilweise bösen Exzesse, die dort sicht- und hörbar wurden, in den Vordergrund gestellt, ohne gebührend darauf aufmerksam zu machen, dass keineswegs alle, die sich vornehmlich in Dresden versammelten, rechtsradikal waren. Von daher ist Sigmar Gabriels heftig kritisierter Versuch zu verstehen, «mit den Menschen zu reden». Das war immerhin besser als die Weigerung des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich, bei den Pegida-Demonstrationen mäßigend oder bloß zuhörend aufzutreten. Erst die AfD schaffte es, den diffusen Unmut zu kanalisieren und politisch nutzbar zu machen.
Der in Dresden aufgetauchte Vorwurf, der meinen Berufsstand am meisten irritiert und empört hat, war der der «Lügenpresse». Die Medien haben vielfältig darauf reagiert: mit blanker Abwehr zuerst sowie mit der Strategie, die Urheber der «Lügenpresse»-Kritik als Nazis zu enttarnen, schließlich mit dem im konkreten Fall sorgsam geführten Nachweis, dass die Nachrichten und Kommentare auf nachprüfbaren Fakten beruhten. Dies war aber nicht das Problem. Das Problem war die Asymmetrie zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung.
Wer versuchen wollte, die Rede von der «Lügenpresse» ernst zu nehmen, müsste zwischen Polemik und Sachverhalt unterscheiden. Er würde weiterhin unterscheiden müssen zwischen dem groben Vorwurf, jemand lüge absichtsvoll und im Auftrag (wie es die Presse der Nazis und dann der DDR getan hat und wie es die russische noch heute tut) und dem subtilen Vorwurf, jemand sage strukturell und gewissermaßen ungewollt die Unwahrheit. Wenn man diese Unterscheidungen trifft, dann gelangt man zu der beschriebenen «kulturellen Hegemonie», und man wird sich daran erinnern, dass nicht wenige Leitmedien nicht in erster Linie daran interessiert schienen, die Flüchtlingspolitik darzustellen und kritisch zu erörtern, was eigentlich ihre Aufgabe im Sinne der «vierten Gewalt» gewesen wäre, sondern Angela Merkels Öffnung der Grenzen dadurch zu unterstützen, dass man ihre humanitäre Unabwendbarkeit hervorhob und sich daranmachte, die vom Ansturm der Ereignisse überrollte Öffentlichkeit moralisch auf den richtigen Weg zu bringen. Wer das damalige Volkserziehungsprojekt mit dem später nachgereichten Eingeständnis vergleicht, es habe einen «Kontrollverlust» gegeben, nicht alle Flüchtlinge seien aufnahmeberechtigt gewesen und einige von ihnen seien mit terroristischen Absichten ins Land gekommen, der wird den Vorwurf der «Lügenpresse» etwas ernster nehmen.
Der Politikwissenschaftler Peter Graf Kielmansegg hat in der «FAZ» eine scharfsinnige Analyse des Populismus[3] veröffentlicht, wo er den gedankenlosen Vorwurf des Populismus kritisiert und die Frage stellt, was denn Demokratie anderes sei als ein institutionalisierter Populismus. Kielmansegg findet den neuen Populismus gefährlich, weil sein Verständnis von Demokratie insofern eindimensional sei, als er die Vermittlung durch Institutionen (Parteien, Parlamente) ablehne. Demokratie sei eben nicht bloße Volksherrschaft, sondern eine Ordnung, die Repräsentanten und Repräsentierte zu einem permanenten Austausch rationaler Argumente zwinge. Daran seien die neuen Populisten nicht interessiert, weil sie lediglich bestimmte Ängste der Bevölkerung mobilisieren wollten.
Kielmansegg nun nimmt diese Ängste ernst und sieht ihre Ursache im Problem der «Entgrenzung». Darunter versteht er erstens einen Freihandel, der Arbeitsplätze und Umweltstandards bedrohen könnte, zweitens den ungehemmten Zustrom von Flüchtlingen, der die vertraute Lebenswelt in Frage stelle: «Entgrenzung als Bedrohung, das ist die eine Erfahrung. Dass die Eliten […] den Betroffenen Entgrenzung, jedenfalls soweit es um Migrationsbewegungen geht, als zwingendes Gebot der Vernunft wie der Moral präsentieren, so zwingend, dass man über die, die es nicht begreifen, nur verächtlich sprechen kann, ist das andere.» Dadurch sei ein Gefühl der Ohnmacht entstanden sowie das Gefühl, dass man die Politik der offenen Grenzen nicht ernstlich in Frage stellen dürfe, ohne eine Stigmatisierung zu riskieren: «Eine ganz große Koalition – alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der CSU gehören dazu, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, viele Feuilletons, die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände – grenzt den Raum der als legitim akzeptierten Auseinandersetzung über die Flüchtlingspolitik dieses Landes eng ein.»
Natürlich findet diese Auseinandersetzung trotzdem statt, weil sie stattfinden muss und sich nicht unterdrücken lässt. Der Ort jedoch, wo dies ungehindert passieren kann, sind die rechten und eben auch reaktionären Gruppierungen. Wem an einer offenen demokratischen Debatte gelegen ist, der tut nicht gut daran, solche Argumente – oder auch bloße Gefühle und Stimmungen – mit der immer noch funktionierenden Abseitsregel «Das ist rechts!» zu disqualifizieren.
Die Differenz zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung aber hat nicht bloß eine inhaltliche Seite, nämlich die beschriebene moralistische, sondern auch eine strukturelle. In seiner großen Abhandlung «Die Gesellschaft der Gesellschaft» schreibt Niklas Luhmann: «Jeden Morgen und jeden Abend senkt sich unausweichlich das Netz der Nachrichten auf die Erde nieder und legt fest, was gewesen ist und was man zu gewärtigen hat. Einige Ereignisse ereignen sich von selbst, und die Gesellschaft ist turbulent genug, daß immer etwas geschieht. Andere werden für die Massenmedien produziert. Dabei kann vor allem die Äußerung einer Meinung als Ereignis behandelt werden, so daß die Medien ihr Material reflexiv in sich selbst eintreten lassen können.»[4]
Da nun die Medien das jeweils Neue berichten wollen, müssen sie ständig selbst neue Informationen herbeischaffen. «Allein schon die Täglichkeit des Erscheinens und das Produktionstempo der Massenmedien schließen es aus, daß die im Publikum vorhandenen Meinungen vorweg konsultiert werden. Die Organisationen der Massenmedien sind hier auf Vermutungen und, im Ergebnis, auf self-fulfilling prophecies angewiesen. Sie arbeiten weitgehend selbstinspirativ: durch Lektüre ihrer eigenen Erzeugnisse, durch Beobachtung ihrer eigenen Sendungen. Sie müssen dabei eine hinreichende moralische Uniformität unterstellen, um täglich über Normverstöße, Skandale und sonstige Abartigkeiten berichten zu können. Verschiebungen können einkalkuliert werden: Stichwort ‹Wertewandel›; aber der eigene Anteil daran kann nicht herausdividiert werden.» Und Luhmann resümiert: «Das, was als Resultat der Dauerwirkung von Massenmedien entsteht, die ‹öffentliche Meinung›, genügt sich selbst. Es hat deshalb wenig Sinn, zu fragen, ob und wie die Massenmedien eine vorhandene Realität verzerrtwiedergeben; sie erzeugen eine Beschreibung der Realität, eine Weltkonstruktion, und das