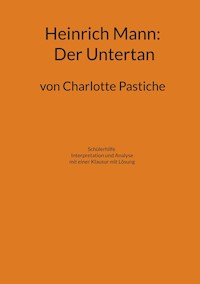
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Der Untertan" bleibt auch weiterhin eine vielgelesene Schullektüre. Die Behandlung des Romans im Unterricht und darüber hinaus ist lohnenswert, ermöglicht er doch die Auseinandersetzung mit Literatur und Sprache der Jahrhundertwende sowie mit der Satire und ihren Möglichkeiten, mit dem historischen Roman, nicht zuletzt auch mit den historischen Gegebenheiten des Kaiserreichs. Den heutigen Schülerinnen und Schülern mag jedoch der politische und soziale Hintergrund der Zeit fremd sein. Aus diesem Grund folgt der Interpretation und Analyse auch ein historischer Exkurs. Eine Klausur mit Lösung berücksichtigt die Operatoren, wie sie auch in der Abiturprüfung Anwendung finden. Diese Lektürehilfe bietet: -Ausführliche Inhaltsangabe- -Charakterisierung der Hauptfiguren- -Interpretation- -Analyse- -Historische Hintergründe- -Biographie Heinrich Manns- -Rezeption- -mit einer Klausur mit Lösung- - Sekundärliteratur-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schülerhilfe
Interpretation und Analyse Historische Hintergründe Biographie Heinrich Manns mit einer Klausur mit Lösung
Für Luis Paul
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsangabe
Die Personen
Interpretation
Die Kindheit Diederichs und die Sozialisationsinstanzen
Die Untertanenmentalität
Diederich und die Großstadt Berlin
Die Neuteutonia
Diederich beim Militär
Das Sozialpsychologische im Untertan
Diederich und die Macht
Agnes als Alternative
Eine harte Zeit
Der alte Buck – eine positive Gegenfigur
Wolfgang Buck – ein schwacher Demokrat
Der Bau des Denkmals und die Parteiintrigen
Der Konflikt zwischen Guste und Käthchen Zillich
Die Bedeutung des Theaters bei Heinrich Mann
Jadassohn
Die Sozialdemokratie
Diederich verwandelt sich in den Kaiser
Der Majestätsbeleidigungsprozess
Die Denkmalsenthüllung
Analyse
Die Erzählsituation
Erzählzeit
Satire
Komik
Montagetechnik
Ein romantischer Exkurs
Rhetorische Figuren
Anhang
Ist der Untertan eine Satire?
Der Untertan als Entwicklungsromanen
Das Kaiserreich
Biographie
Texte zum Thema
Klausurvorschlag
Zeittafel
Literaturverzeichnis
Bildverzeichnis
Vorwort
Der Untertan konnte erst 1918 erscheinen, obwohl ein Teilabdruck bereits seit 1911 in einer Zeitschrift erfolgte. Der Krieg hatte die Veröffentlichung verhindert.
Der Roman war als Satire auf die Wilhelminische Gesellschaft verfasst worden und in der Handlung begegnen uns zahlreiche Figuren, die für verschiedene Gesellschaftsschichten ihrer Zeit stehen.
Diese Lektüre eignet sich aus vielen Gründen gut für den Unterricht. So lassen sich zum Beispiel die typischen Arbeitstechniken des Deutschunterrichts anwenden, wie die Interpretation, aber auch die Analyse gibt vieles her, gerade im Bereich der Satire. Historisches Wissen ist gefragt und soll auf den Text angewendet werden. Dabei kann es auch um die Frage gehen, ob dies eine realistische Beschreibung der Gesellschaft oder eben Satire ist.
Problematisiert werden kann auch, warum der Text so umstritten ist. Viele haben ihn abgelehnt, viele haben ihn auch für ihre ganz eigenen Ideen vereinnahmt. Man bedenke, dass er Pflichtlektüre in der DDR war. Interessant auch, dass der Text in der historischen Forschung über die Zeit des Wilhelminismus eine Rolle spielt. Nicht zuletzt ist die Lektüre auch unterhaltsam.
Dieser Lektüreschlüssel möchte dem Schüler oder auch dem Lehrer zunächst grundlegende Informationen über den Inhalt des Werkes an die Hand geben.
Die Interpretation der wichtigsten Textstellen soll zur Intention hinführen. Die Textanalyse arbeitet die sprachlichen Besonderheiten des Werkes heraus und stellt sie in Zusammenhang mit der Intention. Die Biographie Heinrich Manns erlaubt einen verbesserten Zugang zur Lektüre.
Der historische Teil kommt nicht zu kurz, denn um die Zeit des Wilhelminismus und die politischen Besonderheiten des Deutschen Reiches zu verstehen, bedarf es des Hintergrundwissens. Die Rezeptionsgeschichte soll auch beleuchtet werden.
Der Lektüreschlüssel bezieht sich auf folgende Textausgabe:
Heinrich Mann: Der Untertan. Roman. Frankfurt am Main 2006. (Fischer Taschenbuch Verlag)
Inhaltsangabe
Kapitel I
Diederich Heßling ist ein weiches Kind. Er ist ängstlich und verlässt ungern den elterlichen Garten. Die Familie besitzt eine Papierfabrik. Er fürchtet sich vor dem Vater, trotzdem liebt er ihn. Den Arbeitern gegenüber verhält er sich wie ein Pascha. Die Mutter ist weich, aber Diederich achtet sie nicht, denn sie hat so viel Ähnlichkeit mit ihm. Die Mutter vermittelt ihm viele Märchen.
In der Schule zeigt er sich gegenüber den strengen Lehrern gehorsam. Den Gutmütigen spielt er Streiche. Diederich beglückt die Zugehörigkeit zu einer Macht, wie sie das Gymnasium darstellt. So umwindet er den Rohrstock sogar mit einem Kranz.
Eine prägende Gestalt seiner Kindheit ist der alte Buck, der ein angesehener Mann in der Stadt ist und einen Zylinder trägt.
In der Untertertia unterdrückt er einen jüdischen Mitschüler und fühlt sich, von der Menge angefeuert, stark. Die geteilte Verantwortung ermutigt ihn. Diederich wird zum Primus und zum geheimen Aufseher, der den Lehrern die Missetaten der anderen mitteilt.
Diederich genügt überall, aber der deutsche Aufsatz bleibt ihm fremd und wer darin gut ist, der flößt im Misstrauen ein. Sein Vater schickt ihn zum Studieren nach Berlin.
Diederich ist von Heimweh geplagt und er weint viel. In Berlin besucht er Herrn Göppel, der auch aus Netzig stammt und lernt dort dessen Tochter, Agnes, kennen. Herr Göppel bewundert den alten Buck, der 1848 zum Tode verurteilt worden sei und zeigt sich als Gegner der neuen Zeit, die durch den Kaiser geprägt ist. Er bekennt sich als freisinniger Gegner Bismarcks. Diederich stimmt ihm zu.
Da erscheint Agnes Göppel, die schön und elegant ist. Zugleich lernt er Mahlmann, einen kräftigen Studenten, kennen. Herr Göppel lädt Diederich für nächsten Sonntag zum Mittagessen ein und er geht hin.
Agnes zeigt Interesse an Diederich und Mahlmann versucht dies zu verhindern.
Diederich besorgt eine Konzertkarte für Agnes. Mahlmann taucht bei ihm auf und nötigt ihn zu einer Kneipentour, wobei er Diederichs Geld verprasst.
Diederich schenkt, nachdem seine Eltern ihm wieder Geld geschickt haben, Agnes einen Blumenstrauß.
Die Familie besucht mit Diederich und Mahlmann einen Tierpark und Diederich und Agnes kommen sich näher. Mahlmann droht ihm, weil Agnes für dieses Semester ihm gehöre und Diederich erschrickt. Er entflieht, aber zuhause weint er.
Er reist nach Netzig ab, wo er sich ganz seinen traurigen Gefühlen hingibt. Er versucht sogar zu dichten.
Zusammen mit Gottlieb Hornung, der auch aus Netzig stammt, besucht er eine Studentenverbindung, es ist die Neuteutonia. Diederich wird zum Konkneipant und er fühlt sich dazu berufen. Ihm gefällt es, dass alles kommandiert wird und er muss nur trinken. Auch das gemeinsame Singen erfreut ihn. Er geht auf in der Korporation, die für ihn denkt und will.
Diederich erkennt die Vorzüge des Biertrinkens.
Nun soll Diederich vollwertiges Mitglied werden und muss fechten. Sein enger Freund in der Neuteutonia wird Wiebel. Diederich wird sein Leibfuchs.
Nun ist sein Leben durch Ordnung und Pflicht der Verbindung geprägt. Zu bestimmten Zeiten erscheint er bei Wiebel oder im Fechtsaal. Nachmittags beginnt die Kneipe. Der Konkneipant Delitsch stirbt und Diedrich und die Neuteutonen fühlen sich wie Krieger, die den Kameraden zu Grabe tragen.
Diederich zeigt gegenüber den Füchsen Strenge und er erfreut sich an seiner Uniform.
Auf einer Tanzveranstaltung gerät er in Streit und verfolgt zusammen mit Hornung seinen Gegner, der sich aber als Offizier und Adliger herausstellt. Diederich wendet sich zum Rückzug.
Da er, bedingt durch das Verbindungsleben, kein Geld mehr hat, wendet er sich an Mahlmann. Aber als Einzelner, ohne die Korporation, fühlt er sich Mahlmann unterlegen, der ihn auslacht. Diederich hat einmal für ihn gebürgt, aber Mahlmann will dies umgekehrt keineswegs und als Diederich ihn als Schwindler bezeichnet, wird er handgreiflich gegen Diederich und befördert diesen zur Tür. Er ist gekränkt, hat aber doch Hochachtung vor soviel Infamie.
Dann stirbt der alte Heßling und Diederich weint. Er macht Kondolenzbesuche in Netzig und kommt zum Hause des alten Buck. Diederich begegnet ihm ehrfürchtig.
Er ist nun mit dem alten Buchhalter Sötbier Vormund seiner beiden Schwestern.
Zurück in Berlin beginnt er seine Zeit beim Militär abzudienen. Aber gleich zu Beginn versucht er, den Arzt Dr. Heuteufel dazu zu bewegen, ihm zu bescheinigen, dass er zu krank fürs Militär sei, was dieser jedoch ablehnt. Die Militärübungen sind anstrengend und Diederich merkt, dass es darum geht, die Würde des einzelnen herabzusetzen. Dies imponiert ihm und flößt ihm eine Begeisterung ein. Doch Diederichs Fuß schmerzt und er hofft heimlich, dass es schlimmer wird. Er besucht den alten Herrn eines Korpsbruders, der Geheimer Sanitätsrat ist. Er kennt den Oberstabsarzt und der wiederum verhilft Diederich zu seinem Abschied aus der Armee. Vor den Neuteutonen behauptet er, er wäre gerne dabei geblieben.
Ein Assessor von Barnim tritt auf und er versucht den Neuteutonen seinen Antisemitismus zu vermitteln.
Es ist der Februar 1892 und in Berlin kommt es zu Straßenkrawallen. Wiebel und Diederich sähen es gerne, wenn mit den Arbeitslosen auf der Straße kurzer Prozess gemacht werden würde. Diese rufen vor dem Berliner Stadtschloss nach Brot und Arbeit. Mitten im Tumult erscheint Kaiser Wilhelm II. unter seinen Untertanen. Als ein junger Mann mit Künstlerhut Kritik am Auftreten des Kaisers äußert, schlägt Diederich auf ihn ein. Ein alter Herr mit Eisernem Kreuz beglückwünscht ihn dazu. Diederich gelangt bis vor das Brandenburger Tor und jubelt dem Kaiser frenetisch zu. Mit anderen durchbricht er die Kette der Schutzmänner und im Tiergarten begegnet er alleine seinem Kaiser. Er fällt in einen Tümpel und der Kaiser muss laut lachen.
Wilhelm II. i
Kapitel II
Zufällig begegnet er Agnes Göppel, die auf einer Bank sitzt. Sie fragt ihn, warum er sich drei Jahre nicht gemeldet habe und er sucht Ausflüchte. Er macht ihr Komplimente und sie sagt, dass sie Mahlmanns Armband nie getragen hätte. Da kein Bus mehr fährt, geht sie mit in Diederichs Wohnung, wobei sie fragt, ob sie ihm vertrauen kann. Beide kommen sich näher und sie landen im Bett. Agnes sitzt auf dem Diwan und weint. Da Agnes versichert, ihn zu lieben, sinkt sie in Diederichs Wert. Agnes sagt, dass sie seine Frau werden wolle. Zuhause, allein, spürt Diederich sein Glück und er denkt auch plötzlich anders über seine Ressentiments. Er bereut, dass er den Künstler geschlagen hat.
Sonntags erscheint Diederich bei Familie Göppel zum Essen. Dort gerät er mit Herrn Göppel über politische Fragen in Konflikt. Agnes vermittelt. Sie verabredet sich wieder mit Diederich. An der Tür küsst sie ihn.
Sie kommt nun regelmäßig in seine Wohnung und sie sind sehr glücklich. Sie bummeln zusammen und sprechen von Reisen, die sie machen wollen. Diederich ist ein ganz anderer Mensch. Besorgt bemerkt er die zunehmende Krankheit von Agnes.
Aber bald ändert sich sein Verhalten. Er betont, dass seine Karriere vorgeht.
Dann erscheint Wolfgang Buck an seiner Wohnung. Er bittet ihn hinein, wobei Agnes sich verstecken muss. Buck zeigt sich als Freund der Arbeiter und ist Diederich sofort unsympathisch.
Buck ist der Auffassung, dass die Zeit für große Männer vorbei ist und meint damit den Kaiser. Diederich erinnert sich, dass ihm schon in der Schule die geistreichen Aufsätze von Buck Misstrauen eingeflößt haben.
Agnes erleidet in seiner Wohnung einen Anfall, aber Diederich erscheint dies später als Komödie. Er beendet seine Doktorarbeit und da Herr Göppel auf Reisen ist, unternimmt er mit Agnes einen Ausflug aufs Land, der sehr schön ist. Aber er lässt Agnes sitzen. Ihren Vater, der ihn aufsucht, weist er ab.
Kapitel III
Diederich kehrt nach seinem Studium nach Netzig zurück. Im Zug trifft er Guste Daimchen, die er noch aus seiner Jugend kennt. Sie imponiert ihm mit ihrer frechen Art. Sie ist mit Wolfgang Buck verlobt.
Zuhause im Betrieb hält er eine Rede an seine Arbeiter, die voller Drohungen und Kaiserzitate ist. Er hat auch große Pläne für die Fabrik. Diederich äußert große Vorbehalte gegen die Freisinnigen (Linksliberale) in der Stadt, zu denen auch die Familie Buck gehört, die sehr angesehen ist.
Gegenüber Sötbier, dem Verwalter der Fabrik, tritt Diederich als Macher auf. Kurz darauf gerät er mit dem Maschinenmeister, Napoleon Fischer, aneinander, der sich aber nicht einschüchtern lässt. Entlassen aber kann er ihn nicht.
Diederich besucht die Honoratioren der Stadt. Zunächst führt ihn sein Weg zum alten Buck. Dieser war bei der Revolution von 1848 dabei und kritisiert die Machtverhältnisse im jetzigen Kaiserreich. Dabei empfängt er Diederich freundlich. Später besucht er den Bürgermeister Scheffelweis, wobei auch Jadassohn, der Assessor, zugegen ist. Hier zeigt sich Diederich als äußerst kaisertreu. Sie beschließen, gegen die Liberalen in der Stadt vorzugehen.
Vor dem Amtsgebäude von Regierungspräsident von Wulckow wird ein Arbeiter erschossen, weil er angeblich einen Posten provoziert hat. Diederich und andere Nationale verteidigen die Tat, während die Freisinnigen empört sind. Im Ratskeller kommt es dabei zu einer angeblichen Majestätsbeleidigung durch den Unternehmer Lauer. Jadassohn plant darauf ein Gerichtsverfahren und Diederich soll aussagen. Diederich lässt ein gefälschtes Dankesschreiben des Kaisers an den Schützen in der Zeitung veröffentlichen.
Kapitel IV
Diederich sagt vor Gericht gegen Lauer aus, dessen Rechtsanwalt Wolfgang Buck ist. Eine neue Papiermaschine, die bereits bestellt ist, kann Diederich nicht bezahlen. Er verbandelt jedoch den Prokuristen der Firma, Kienast, mit seiner Schwester. Daraufhin nimmt dieser das Gerät zurück.
Diederich trifft Wolfgang Buck und die Gegensätze der beiden werden deutlich. Zunächst läuft der Prozess gut für Lauer. Aber Wolfgang Buck lässt sich von seiner eigenen Rede berauschen und die Wirkung verblasst. Lauer wird zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Seine Frau reist ins Ausland.
Kapitel V
Diederich zeigt Guste seine Fabrik, wobei er ihr auf den Lumpensäcken näher kommen will, was Guste ablehnt.
Emmi und Magda bekommen Rollen in dem Stück „Die heimliche Gräfin“, das von Frau von Wulckow geschrieben wurde. Es kommt zu politischen Tauschgeschäften zwischen Regierungspräsident von Wulckow und Diederich.
Diederich verbreitet das Gerücht, dass Guste die uneheliche Tochter des alten Buck und damit ihr Verlobter ihr Halbbruder sei. Aber Wolfgang Buck will ohnehin die Verlobung mit Guste lösen. Er überlässt seine Verlobte Diederich.
Mit dem Erbe des Papierfabrikanten Klüsing will Diederich nicht wie vorgesehen ein Kinderheim, sonder ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichten. Dazu trifft er Absprachen mit Napoleon Fischer. Von Wulckow will als Grundstücksspekulant auch heimlich profitieren.
Diederich erhält einen Orden von höchster Stelle.
Kapitel VI
Diederich und Guste befinden sich auf der Hochzeitsreise in Zürich. Da erfährt Diederich, dass der Kaiser auf dem Weg nach Rom sei. Er beschließt, ebenfalls dorthin zu reisen. Tatsächlich gelingt es ihm, den Kaiser in seinem Wagen in Rom zu treffen, wobei Diederich schreiend und mit dem Hut schwenkend neben dem Wagen läuft.
Am nächsten Tag steht er früh auf, um den Kaiser bei seiner Ausfahrt sehen zu können. Der Portier des Palastes hilft ihm und schon ist Diederich in einem Einspänner hinter dem Kaiser her. Er hält Wache vor dem Haus, wo nun der Kaiser verweilt und folgt ihm zurück zum Palast. Weiter geht es nun und Diederich erleidet Hunger und Durst. Sein Kutscher bringt ihm deshalb Wein und dieser feuert Diederich zusätzlich an. Immer dort, wo der Kaiser sich befindet, erscheint auch Diederich und dafür rast er durch enge Gassen und läuft über Treppen. Diederich ruft sein Hurra und der Kaiser scheint seinen Untertan zu erkennen. Diederich fühlt sich großartig und die Leute belächeln ihn wohlwollend.
Erst als der Kaiser frühstückt, erinnert er sich wieder an Guste, die bemerkt, dass er rot wie eine Tomate ist. Diederich betont, dass dies ein großer Tag für die nationale Sache sei.
Da Diederich weiß, dass der Kaiser nach dem Essen zu ruhen pflegt, hält er unter seinem Fenster Wache. Er stürzt sich auf eine Person, die sich verdächtig verhält und nimmt diese fest. Die Wachen laufen herbei. Der Mann scheint eine Bombe zu werfen, aber es ist nur Zahnpulver. Der scheinbare Attentäter ist Künstler und Diederich empfiehlt prompt seine Verhaftung, was auch erfolgt.
Nun heißt es wieder, dem Kaiser durch die Stadt zu folgen. Der Kaiser besucht die deutsche Botschaft und sein Untertan nimmt die Gelegenheit wahr, ein Wirtshaus zu besuchen. Vor dem Wirtshaus hält er eine Ansprache an das Volk, wobei er die Vorzüge eines Kaisers herausstellt, der kein Schattenkaiser sei. Die Einheimischen trinken mit dem Untertan fortwährend Wein und zeigen ihm eine Zeitung, die von dem Vorfall mit dem Künstler berichtet und Diederich und den Kaiser gemeinsam abbildet. Das ist zu viel. Der Wein und die Begeisterung lassen Diederich zunehmend die Kontrolle verlieren. Städtische Wächter finden ihn an eine Mauer gelehnt und in seinem eigenen Urin.
Am nächsten Abend reist der Kaiser ab, denn er hat den Reichstag aufgelöst und sein Untertan eilt ihm nach.
In Netzig trifft man auf Gottlieb Hornung, der sich zu fein fühlt, Zahnbürsten zu verkaufen, obwohl er in der Adlerapotheke arbeitet. Diederich erkennt in ihm einen wertvollen Bundesgenossen. Er plant einen nationalen Kandidaten für den Reichstag aufzustellen. Auch um Stimmen zu gewinnen, plant er den Bau des Kaiser-Wilhelm-Denkmals aus dem Erbe Kühlemanns, wobei das freisinnige Säuglingsheim nicht gebaut werden soll. Major Kunze, der als Kandidat aufgestellt werden soll, hat jedoch Bedenken, ob er im liberalen Netzig etwas erreichen kann. Diederich jedoch gelingt es, ihn zu überreden. Er verspricht ihm sogar einen Orden. Pastor Zillich lässt sich gegen das Versprechen von finanzieller Unterstützung seiner Kirche dazu verpflichten, dem nationalen Wahlkomitee vorzustehen. Diederich bedingt sich aber aus, Jadassohn fernzuhalten. Kühnchen will Rektor werden und Diederich bewilligt es ihm.
Diederich ist so begeistert im Wahlkampf, dass er sogar seine ehelichen Pflichten vernachlässigt.
Er schreibt für die „Netziger Zeitung“ einen Appell gegen das Säuglingsheim und begründet ihn damit, dass sich eine solche Einrichtung , nur an die unehelichen Kinder richte.
Bei Klapsch soll Major Kunze eine patriotische Rede halten, was gründlich misslingt und den Spott der Freisinnigen herausfordert. Hornung dagegen, der von Diederich bezahlt wird, hält eine scharfe Rede. Diederich benutzt beide nur als Hilfstruppe für Napoleon Fischer.
Heuteufel meldet sich zu Wort und wirbt für das Säuglingsheim.
Diederich tritt dem energisch entgegen und ist erst einmal drei Tage lang heißer. Unterdessen zeigt Emmi ein trauriges Verhalten. In der Familie wird spekuliert, dass sie mit dem Leutnant von Brietzen eine Beziehung anbahnt.
Napoleon Fischer warnt Diederich, dass die „Partei des Kaisers“ zu forsch auftrete. Diederich solle nun das versprochene Gewerkschaftshaus von den Stadtverordneten verlangen.
Laut Fischer hat der alte Buck erkannt, dass Diederich nur solchen nationalen Rummel veranstaltet, weil er so billiger an Gausenfeld kommen will. Das erzürnt Diederich sehr. Überhaupt sieht er nun den alten Buck als Erzfeind, zumal er in seiner Partei an Rückhalt verliert. Der Gedanke an den alten Buck lässt ihn nicht los und er hält ihn für heuchlerisch. Dessen Güte hält er für Hohn.
Emmi leidet, weil der Leutnant von Brietzen sich versetzen ließ und Guste triumphiert. Diederich bangt um seine Schwester und klopft in Panik an ihre Zimmertür. Er findet einen kleinen Schwamm mit Chloroform. Ihre Verzweiflung beeindruckt Diederich und er möchte Emmi helfen. Er weiß darum, dass sie eine voreheliche Beziehung hatte. Emmi lässt sich versichern, dass ihr Bruder den Leutnant nicht fordern wird. Er erinnert sich an Göppel.
Am nächsten Morgen sucht er von Brietzen auf. Der sagt, dass man ein Mädchen, das seine Ehre nicht mehr habe, nicht zur Mutter seiner Kinder mache und Diederich antwortet wie damals Herr Göppel. Von Brietzen will Diederich von seinem Burschen verprügeln lassen und Diederich zieht ab.
Er wendet sich tröstend zu Emmi und sie legt den Kopf an seine Schulter. Emmi steht nun unter seinem Schutz. Der Leutnant und die Macht verlieren dagegen für ihn an Bedeutung. Er denkt an Agnes, die die Weichheit in ihm geweckt hatte. Er erkundigt sich nach ihr und erfährt, dass sie verheiratet ist.
Der Wahltag naht. Napoleon Fischer ist erzürnt, weil Diederich mit dem Freisinn paktiert und das Denkmal schon bewilligt ist. Er droht mit Streik, falls er nicht in den Reichstag kommt.
Diederich bemerkt, dass sich die „Partei des Kaisers“ dem Freisinn angeglichen hat. Kunze will nun für das Säuglingsheim eintreten, falls er vom Freisinn mitgewählt wird. Es kommt aber zur Stichwahl zwischen Heuteufel vom Freisinn und Fischer.
Klüsing will Gausenfeld an Diederich verkaufen.
Am nächsten Abend ruft das freisinnige Wahlkomitee zu einer öffentlichen Volksversammlung ein und Major Kunze wird hart angegangen. Diederich erwähnt betrügerische Manipulationen des Freisinns. Er gerät mit seinem alten Prokuristen Sötbier aneinander.
Der alte Buck appelliert in einer Rede an den Zusammenhalt des Volkes gegen die Herren. Auch die Arbeiter sollten ihr Recht bekommen.
Diederich hält darauf eine wütende Rede und spricht sich für die Heeresvorlage aus, um für einen Krieg gerüstet zu sein. Plötzlich gehen die Genossen von Napoleon Fischer auf ihn los und packen ihn, doch er wird von Buck gerettet. Doch als Diederich Buck mit demokratischer Korruption in Verbindung bringt, da fordert Buck ihn voller Zorn auf zu sprechen. Er bezeichnet ihn als Verräter an der Nation. Er solle sagen, an wen und zu welchem Zwecke er sein Haus verkauft habe. Der Saal ruft den Namen Wulckow.
Diederich behauptet, dass er sein Haus für das freisinnige Säuglingsheim verkaufen hätte sollen, damit ein gewissenloser Magistratsrat sich bereichern kann. Bei ihm sei dies nicht geglückt, aber bei Gausenfeld. Anschließend fallen die Gegner im Saal übereinander her. Der alte Buck weint. Diederich schwingt zum Beweis ein Papier, das aber keiner lesen kann, weil er immer wieder mit dem Handrücken darauf schlägt. Angeblich stecke Buck hinter dem Ganzen. Da stirbt der alte Kühlemann und die Versammlung geht auseinander.
Am Abend vor der Wahl hält die „Partei des Kaisers“ eine Versammlung ab und Diederich ruft die Anwesenden auf, nicht den Freisinn zu wählen. Man solle das kleinere Übel wählen.
Der Kriegerverein schreitet am Wahltag in Uniform zum Wahllokal und Diederich schreitet mit. Auch Bürgermeister Scheffelweis stellt sich auf Diederichs Seite.
Fischer bekommt über 5000 Stimmen und zieht in den Reichstag. Die Hochburg des Freisinns ist gefallen.
Kühlemann hat der Stadt 600 000 Mark für gemeinnützige Zwecke vermacht. Dass die Sozialdemokraten sich nun für das Kaiser-Wilhelm-Denkmal einsetzen, wird so hingenommen. Ehrenvorsitzender des Denkmal-Komitees wird Wulckow, während Diederich den eigentlichen Vorsitz übernimmt. Buck nimmt an den Abstimmungen im Magistrat gar nicht mehr teil.
Der Alte muss sich sogar von Diederich Geld leihen, denn es steht schlecht um seine Finanzen.
Diederich trifft auf Jadassohn. Sie unterhalten sich ein wenig abschätzig über Käthchen Zillich, die nun in Berlin zu finden sei. Jadassohn will sich in Paris die Ohren anlegen lassen.
Am Bahnhof sieht er Lauer, der nun entlassen ist.
Diederich aber geht als geachteter Bürger durch die Stadt. Er erntet nun die Früchte seiner Bemühungen.
Die Aktien von Gausenfeld fallen und der alte Buck ist dort beteiligt.
Ebenso auch Diederich.
Buck muss vor Gericht, da behauptet wurde, er hätte sich für das Grundstück von Klüsing interessiert, um es teurer für das Säuglingsheim zu verkaufen.
Diederich will ihn nun entlasten, aber der Alte lehnt dies ab.
Diederich wird Generaldirektor von Gausenfeld.
Der alte Buck hat stark bei der Bevölkerung verloren und man wirft ihm seine Gegnerschaft zur Regierung vor, die auch die Geschäfte geschädigt hätte. Der Alte legt nach einigem Druck sein Amt als Stadtrat nieder. Auch den Vorstand seiner Partei muss er verlassen. Die Bürger bringen ihm keine Achtung mehr entgegen. Aber es gibt eine neue, junge Generation, die ihn grüßt und der Alte hat wieder Hoffnung.
Unterdessen floriert Gausenfeld, woran der Untertan die Mehrheit der Aktien an sich gebracht hat und wird mit der Fabrik Heßling vereinigt. Er verspricht seinen Arbeitern Wohnungen und Krankenversicherung, verbietet ihnen aber die Sozialdemokratie zu wählen. Diederich lässt Toilettenpapier mit staatserhaltenden Maximen drucken.
Überall wittert Diederich den Umsturz.
Kienast verlangt eine höhere Beteiligung von Diederich und es kommt zum Prozess, der drei Jahre dauert und mit Verbitterung geführt wird. Sötbier unterstützt Kienast. Kienast versucht auch mit Napoleon Fischer Diederichs Vergangenheit aufzuhellen und dieser behilft sich mit großzügigen Spenden an die sozialdemokratische Parteikasse.
Überall in Netzig tauchen nun Briefe mit obszönen Abbildungen auf. Diederich und Guste und die anderen Familien sind in Panik. Gottlieb Hornung wird von Diederich angezeigt und in ein Sanatorium eingewiesen. Aber er war es wohl nicht allein.
Diederich und Guste bekommen drei Kinder.
Er imitiert immer stärker die Reden des Kaisers. Mit Guste lebt er seine masochistische Ader aus. Während Guste ihn malträtiert, versteckt er sich hinter dem bronzenen Kaiser.
Doch schon am nächsten Morgen gibt er sich wieder streng und lässt sich das Haushaltsbuch von Guste vorlegen. Damit setzt Diederich ihrem eventuellen Machtdünkel ein Ende.
Jeden zweiten oder auch dritten Tag besucht Diederich den Stammtisch.
Diederich ist der Auffassung, dass das Deutschland der Dichter und Denker seine Vorzüge gehabt habe, aber nun sei die Zeit der Technik.
Der Stammtisch begeistert sich für den Aufbau einer deutschen Flotte. Man verhandelt die Beschießung von London und Paris. Nur Major Kunze zeigt sich als Nörgler, seit er gegen Fischer verloren hat.
Diederich geht einmal in der Woche heimlich in die Brietzener Villa, wo Käthchen nun als Prostituierte residiert. Pastor Zillich leidet unter der Situation und soll Käthchen sogar gezüchtigt haben. Auch Jadassohn besucht die Villa.
Beide bemühen sich zusammen, Majestätsbeleidigungen zu verfolgen.
Trotz aller Gegensätze sucht Diederich immer wieder die Nähe von Wolfgang Buck, der wieder als Rechtsanwalt arbeitet und die Schauspielerei aufgegeben hat. Dem alten Buck geht es immer schlechter. Wolfgang freundet sich mit Emmi an, was Diederich stolz macht.





























