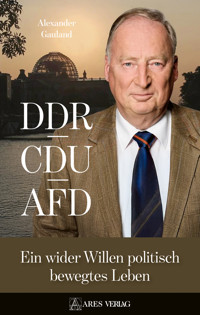Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Manuscriptum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als sich vor Jahren einmal linke Demonstranten vor einer als konservativ gebrandmarkten Bibliothek einfanden, ertönte durch das Megaphon der folgende Kampfspruch: "Das sind Faschos! Die haben da drin Bücher von Gauland! Von Hitler! Von … von Helmut Kohl!" Markanter kann sich die Geschichtsignoranz vieler heutiger Linker wohl kaum desavouieren. Doch stoßen inzwischen die politischen Eliten in ähnliche Hörner, etwa die der CDU, wenn sie allenthalben undifferenziert Nazi-Alarm schlagen und ferner unterstreichen, daß sie mit den traditionellen Prägungen der Christdemokratie rein gar nichts mehr verbindet. Umso augenöffnender ist dieses klug abwägende Buch. Wie in einer Zeitreise führt es den Leser zurück in eine Epoche der BRD-Geschichte, die politisch von einer ebenso farblosen wie wirkmächtigen Gestalt dominiert wurde. Helmut Kohl, die Verkörperung des Parteisoldaten, realisierte einerseits die Wiedervereinigung – seine größte Leistung – und verschuldete andererseits die Aufgabe der D-Mark und befähigte die Kanzlerschaft Merkels. Wer war dieser geheimnisvolle und doch uninteressante Mann, an den sich die eigene Partei heute kaum mehr erinnern will? Alexander Gauland schrieb sein vielschichtiges Portrait vor einem Vierteljahrhundert, als er selbst der CDU noch aktiv verbunden und Kohl "sein" Kanzler war. Es steckt darin eine Zuversicht und Tatkraft, die der Autor bekanntermaßen später in einer alternativen, der CDU abgewandten Partei zu echter Entfaltung bringen sollte. Das Buch beschreibt so gesehen den Lebensweg Kohls und dokumentiert, was wir erst heute erkennen, einen Ausschnitt aus Gaulands politischer Individuation. Es entsteht ein schillerndes, im Spiegel der Zeit gebrochenes Doppelportrait.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Gauland
HELMUT KOHL
EIN PRINZIP
INHALT
Vorwort
Vorbemerkung: Über historische Größe
Die Karriere
Die alte Ordnung
Der Politiker
Der Ideologe
Der Staatsmann
Die Kritiker
Die Fehler
Die neue Welt
Quo vadis, Germania?
Nachbetrachtung:Der »weltläufig gewordene Provinzler«
Anmerkungen
Nachwort: Ein Vierteljahrhundert später
Vorwort
Warum über Helmut Kohl schreiben? Seine Persönlichkeit fasziniert nicht. Er hat nichts von der aristokratischen Nonchalance eines Fox, dem romantischen Dandyismus eines Disraeli oder der herrischen Genialität eines Bismarck. In Helmut Kohl ist nichts Hintergründiges, wie es uns in Walther Rathenau entgegentritt, und er ist kein Ästhet der Macht, wie Richelieu einer war. Friedrichs Abgründe sind ihm so fremd wie die glanzvolle Intellektualität eines Winston Churchill. Niemand käme auf den Gedanken, Helmut Kohl an jenem Begriff von historischer Größe zu messen, den Jacob Burckhardt vorgegeben hat: Größe ist, was wir nicht sind. Helmut Kohl, so konnte man kürzlich lesen, ist ein Serienheld. »Nie ist der Auftritt spektakulär, nie zeigt sich ein Faszinosum, das unwiederholbar in den Bann schlägt, er erleidet kleine Niederlagen und feiert keine ganz großen Siege.«1
Warum also über Helmut Kohl schreiben? Weil es dennoch etwas Unerklärliches und damit auch wieder Faszinierendes in seiner politischen Karriere gibt, den Mangel an gerechter, oder sagen wir besser distanzierter Beurteilung. Helmut Kohl ist der Bundeskanzler der Wiedervereinigung, doch anders als Bismarck hat man ihm dafür keine Denkmäler errichtet. Der »eiserne Kanzler« wurde von seinem dankbaren Souverän gefürstet und von den Deutschen als Bilderbuchheld verehrt; Helmut Kohl hingegen muß fürchten, von den Wählern in Ungnaden entlassen zu werden. Zu diesem Befund gesellt sich eine weitere Beobachtung: Es gibt – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – keine vorurteilsfreie Betrachtung seines Wirkens. Helmut Kohl ist über zwanzig Jahre CDU-Vorsitzender und seit mehr als elf Jahren Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Gewiß hat es im Laufe dieser Jahre kluge Einzelbeobachtungen sowie manch interessanten Essay über Aspekte seiner Arbeit gegeben, doch eine distanzierte Zusammenschau fehlt. Seine Biographen haben Helmut Kohl entweder als linkischen Dummkopf oder als Staatsmann ohne Fehl und Tadel porträtiert. So schwankt sein Charakterbild in der Publizistik zwischen einem zweiten Bismarck und jenem unseligen Lord Goderich, der nach Cannings plötzlichem Tod für ein halbes Jahr die Geschicke Englands bestimmte und der als einzigartig unfähiger Premierminister in die Geschichte seines Landes eingegangen ist. Disraelis Urteil, daß ihm alle Führungseigenschaften fehlten, ist wieder und wieder auch über Helmut Kohl gefällt und mehr als einmal von eigenen Parteifreunden behauptet worden. Für diese Unausgeglichenheit des Urteils muß es Gründe geben, objektive wie subjektive. Ihnen nachzuspüren ist Aufgabe dieses Buches. Daß dabei der Arbeitsplatz des Politikers Helmut Kohl, die alte wie die neue Bundesrepublik, in die Betrachtung einbezogen werden muß, versteht sich von selbst. Der Ausgang, was Karriere, Schicksal und Erfolg Helmut Kohls angeht, muß notwendigerweise offenbleiben, weshalb die Schlußkapitel sich den objektiven Faktoren widmen, mit denen dieser Bundeskanzler oder ein anderer rechnen muß. Daß dabei vieles Meinen, Glauben, Fürchten oder Hoffen ist, kann wohl nicht anders sein in einer Zeitenwende, in der nichts mehr sicher ist und alles neu bedacht werden muß.
Berlin, im Mai 1994
Vorbemerkung:Über historische Größe
Historische Größe ist ein schillernder Begriff. Sie fügt sich zusammen aus subjektiven und objektiven Faktoren. Daß Helmut Kohl subjektiv nichts Faszinierendes besitzt, wird niemand bestreiten wollen. Auch mangelt es ihm an einer Lebensgeschichte voller Brüche, die Figuren wie Willy Brandt und Herbert Wehner interessant macht. Doch wie steht es mit dem objektiven Kriterium der Unersetzlichkeit, das für Jacob Burckhardt das entscheidende ist?
Johannes Gross hat in seiner Betrachtung über die Größe des Staatsmannes im Nachgang zu Joachim Fests Hitler2 die These vertreten, daß in einer bipolaren Welt, über der das Damoklesschwert der atomaren Vernichtung schwebt, die Handlungsspielräume so klein geworden seien, daß kein Raum mehr für die historische Größe des handelnden Staatsmannes bleibe. Er stellt die letzten großen Täter Lenin, Hitler, Stalin, Roosevelt und Churchill den Truman, Eisenhower, Johnson und Breschnew gegenüber und erklärt deren Mediokrität zum strukturellen Problem. Hieße das im Umkehrschluß, daß nach dem Untergang dieser Ordnung wieder Platz für den großen Staatsmann ist, daß Gorbatschow, Bush und auch Kohl die Chance zu historischer Größe haben? Für Johannes Gross wohl nicht, denn er definiert Unersetzlichkeit in einer Weise, die schon Churchill scheitern läßt. Wenn die Geschichte Englands 1940 auch ohne Churchill nicht anders verlaufen wäre als mit ihm, dann in der Tat bleibt Größe für niemanden, nachdem Lenins Werk untergegangen ist und Hitler wie Stalin zu den »bloß kräftigen Ruinierern« zu zählen sind.
Auch für Stalin gilt nun, was Jacob Burckhardt Timur ins Stammbuch geschrieben hat: »Timur hat die Mongolen nicht gefördert, nach ihm war es schlimmer als vorher; er ist so klein, als Dschingis Khan groß ist.«3
Doch zurück zur Unersetzlichkeit: Wäre der Gang der Geschichte ohne Churchill nicht doch ein anderer gewesen? Wissen wir nicht, daß es viele in seiner Partei wie in England gab, die mit Hitler teilen wollten? Hing die Entscheidung, wer Premierminister werden sollte, nicht am seidenen Faden und hätte Halifax die Kraft und die Bedenkenlosigkeit aufgebracht, die Churchills aristokratisches Erbe war? Nur ein Mann wie er war der flackernden Genialität des wurzellosen Kleinbürgers gewachsen. Für Churchill war alles einfach. Hier war das protestantische England der ersten Elisabeth, das England seines Vorfahren John Churchill, des großen Herzogs von Marlborough, das England der Whig-Aristokraten mit seinen freiheitlichen Institutionen, und dort war das Deutschland Hitlers, die Tyrannei des Bösen, die Wiederholung Philipps von Spanien und Ludwigs XIV. in fürchterlicher amoralischer Gestalt. Da gab es nichts zu bedenken, da gab es nichts zu wägen, da gab es nur Kampf bis zum Sieg, auch wenn dieser Sieg das britische Reich zu Tode erschöpfen und seinen Abschied von der Geschichte bedeuten sollte. Für Churchill konnte es zwischen dem Licht der Freiheit und dem Dunkel der Tyrannei keinen Kompromiß geben. Wenn England die Fackel der Freiheit nicht mehr halten konnte, dann mußte es sie weitergeben an Amerika, die neue Vormacht der angelsächsischen Weltzivilisation. »Schicksale von Völkern und Staaten, Richtungen von ganzen Zivilisationen können daran hängen, daß ein außerordentlicher Mensch gewisse Seelenspannungen und Anstrengungen ersten Ranges in gewissen Zeiten aushalten könne.«4 Dieses Urteil Jacob Burckhardts über Friedrichs Rolle im Siebenjährigen Krieg trifft auch auf Churchill zu. Denn alle seitherige europäische und Weltgeschichte ist davon bedingt, daß Churchill dies vom 10. Mai 1940 bis zum Kriegseintritt Amerikas im Dezember 1941 in supremem Grade konnte.
Und wie steht es mit Helmut Kohls Unersetzlichkeit in den letzten vier Jahren? Niemand kann sagen, ob ein anderer, ob Helmut Schmidt oder Willy Brandt die historische Stunde ebenso effektvoll und klug genutzt, das gleiche Ausmaß an Willenskraft und Durchsetzungsvermögen aufgebracht hätten. Doch erscheint es ungerecht, das Ganze als »zufällig, bei allem politischen Verdienst doch ohne innovatorische Leistung»5 abzutun. Größe, die auf Unersetzlichkeit gründet, hat mit der Ästhetik der Persönlichkeit nichts zu tun. Es mag manchen schmerzen, daß Größe hier in kleinbürgerlichem Gewande auftritt, daß Helmut Kohl nicht groß auch in der Welt des Geistes und der Ideen ist, daß er so gar nichts die Menschen Verzauberndes hat und wir Gedanken und Erinnerungen von ihm nicht lesen werden – den Maßstab, an dem wir zu messen haben, ändert das nicht.
Wenn es uns dennoch nur schwer gelingt, unsere Vorstellung von Größe mit den heute Handelnden zu verknüpfen, so steckt dahinter noch ein anderes Problem – das der politischen Symbolik. Nach der Einigung im Jahre 1870 entstanden überall in Deutschland Nationaldenkmäler, Bismarcktürme, Kaiser-Wilhelm-Gedächtnissteine und ähnliche Scheußlichkeiten, deren ästhetische Anspruchslosigkeit ein Problem ausstellte: die mangelnde Symbolkraft des neuen Reiches. Das Reich gründete auf den Kanonen Krupps und dem preußischen Zündnadelgewehr, doch seine Symbole atmeten barockes Pathos und spätrömische Vulgarität. Ausländische Beobachter wie der kluge und gebildete Henry Adams, sahen in dieser Mischung zu Recht eine ästhetische Katastrophe durch geistiges Versagen: »Vierzig Jahre haben eine neue Schicht von schlechtem Geschmack zu allem vorigen gefügt. Es macht mich krank, wenn ich bedenke, daß dies das ganze Ergebnis meiner Lebenszeit ist. In Italien sah ich dasselbe, aber doch nicht in so riesigen Dimensionen… Alles in allem macht Deutschland mir den Eindruck eines hoffnungslosen Versagens.«6 Dieser Rückgriff auf eine vorindustrielle Formensprache begleitete die offizielle Kunst des Kaiserreiches und fand ihren stärksten Ausdruck in den Historienbildern Anton von Werners. Später griffen die autoritären Systeme des Nationalsozialismus, des Faschismus und des Kommunismus noch einmal in diese Trickkiste veralteter Symbole und bauten aus Fahnen, Lichtdomen und Massenaufmärschen eine Kulisse für den Auftritt falscher Größe.
Die deutsche Einigung vollzog sich am 3. 10. 1990 ohne jeden Rückgriff aufs Symbolische, sie schuf keine bleibenden Bilder und damit auch keine Aura, in der sich die handelnden Figuren für die historische Zeitenwende in Szene setzen konnten. Sie blieben, was sie waren – die Spitzen der politischen Daseinsvorsorge eines Industrielandes. Nachdem von Max Webers drei Typen der legitimen Herrschaft nur noch die legale übriggeblieben ist, ist die symbolische Darstellung der industriellen parlamentarischen Demokratie ein ungelöstes Problem, das nur deshalb nicht zum allgemeinen Problem der westlichen Demokratien geworden ist, weil England, Frankreich und die USA aus dem reichen Fundus ihrer vorindustriellen Traditionen und Symbole schöpfen können. Pageantry und Revolutionsmystik können immer erneut heraufgerufen werden, und es genügt, an die ruhmreichen Fahnen von Waterloo einen neuen Wimpel zu fügen, um den Falklandkrieg zu symbolisieren. Ob die Mall in Washington oder Mitterrands neuer Triumphbogen La Défense, sie knüpfen an die Ästhetik der Vergangenheit an, verlängern sie in die Gegenwart und entgehen so der Bilderlosigkeit des 3. 10. 1990. Andererseits zeigt der Streit um die Neue Wache, daß es in Deutschland aus historischen Gründen keine selbstverständliche Übereinkunft zu Symbolen mehr gibt und folglich jede erzwungene Neuschöpfung Streit auslöst. Nachdem Tessenows Gestaltung der Schinkelschen Wache für das sinnlose Morden nicht mehr ausreichend schien, fehlte die Bildkraft, dieses darzustellen. Auch hier gilt, daß die Industriegesellschaft auf Fundamenten ruht, die sie nicht selbst schaffen kann, wenn sie einmal zerstört sind.
Wir haben heute in unserer Gesellschaft einen Grad von Abstraktion erreicht, der es immer schwieriger macht, prägende Bilder zu finden. Über einen bekannten deutschen Theaterregisseur kursiert die Geschichte, daß er in seinem Büro, über einer Inszenierung brütend, auf die Glaswand einer Bank starrte und schließlich wissen wollte, was hinter dieser Wand vorgehe. Doch der von ihm angesprochene Direktor des Instituts zuckte nur die Achseln und meinte, daß es ihm unmöglich sei, die Abstraktion dieser Vorgänge zu erklären. Wie soll ich sie dann in Bilder fassen und auf die Bühne stellen, war der verzweifelte Ausruf des deprimierten Künstlers. Man vergleiche damit nur die sich jedem oberflächlichen Kenner der deutschen Geschichte sofort entschlüsselnde Symbolik von Jüngers Marmorklippen. Von den Mauretaniern und den Purpurreitern über das fürchterliche Köppelsbleek bis hin zu Braquemart und dem Fürsten von Sunmyra können wir die Figuren leicht enträtseln und die Symbole deuten. Denn die Welt des Adels und des Kampfes bedarf keiner Erklärung, wie die Welt der Leitzinsen und des Bruttosozialproduktes. Odo Marquard hat diesen Prozeß die moderne »Entwirklichung der Wirklichkeit« genannt und davon gesprochen, daß unsere Welt sachlich, trivial, einförmig, überraschungsarm und unfaszinierend geworden ist.7 So unfaszinierend wie die Handelnden und ihre Handlungen. Größe bedarf der Anschaulichkeit, der Symbole und der »Ästhetisierung des Politischen». Daran hat es in der alten Bundesrepublik gefehlt und fehlt es in der neuen. Nur in den alten Demokratien speist sich die politische Repräsentation aus ehrwürdigen Traditionen, doch auch diese haben längst nur noch einen dekorativen, musealen Charakter. Es muß deshalb nicht erstaunen, daß die Menschen nur in einer zeitgenössischen Figur, die sich beim näheren Hinsehen als Gestalt verflüchtigt, Größe erkennen wollten, in J. F. Kennedy. Denn dieser Mann, der Größe wohl nicht hatte, lebte aus dem Fundus der britischen Aristokratie, die noch immer das beste Beispiel ist für ein Zusammenspiel von Formen zu einem Stil, der die Gesellschaft prägt. Helmut Kohl daran zu messen wäre nicht nur verfehlt, sondern ungerecht. Selbst wenn er für die deutsche Wiedervereinigung unersetzlich im Burckhardtschen Sinne gewesen ist, fehlen ihm die subjektiven Merkmale der historischen Größe. Er hat sein Werk in einer Zeit vollbracht, die dem großen Individuum abhold ist, weil sie sein Wirken nicht mehr in Bilder und Symbole zu fassen vermag.
Die Karriere
Das Leben Helmut Kohls beginnt am 3. April 1930 in Ludwigshafen. Das umgebende Milieu ist kleinbürgerlich, bäuerlich. Kohls Vater war Finanzbeamter, katholisch und nationalliberal. Das Elternhaus blieb gegenüber den Ideen des Nationalsozialismus resistent. Der Vater hatte schon den Beginn des Krieges als einen Einschnitt erlebt und als provisorischer Stadtkommandant einer eroberten polnischen Stadt Dinge gesehen, die ihn den Tag fürchten ließen, an dem das deutsche Volk dafür würde bezahlen müssen. Kohls Bruder fiel Ende 1944 in einer der letzten großen Abwehrschlachten im Westen – er selbst barg Bombentote in Ludwigshafens Straßen und erlebte das Kriegsende in einem Wehrertüchtigungslager in Berchtesgaden.
Da das Elternhaus eher unpolitisch war, bleibt Kohls frühes politisches Engagement verblüffend, denn bereits mit 18 Jahren galt der Abiturient in Ludwigshafen als eine politische Lokalgröße. Eine einleuchtende idealistische Erklärung für den politischen Aufstiegswillen Helmut Kohls findet sich nicht, Schule und Studium prägten ihn nicht über das normale Maß hinaus. Bereits das Studium war mehr Mittel zum Zweck des Aufstiegs als Drang nach Welterkenntnis. Bedenkt man die Zeit, den Neuanfang und die Namen in Frankfurt und Heidelberg, wo Kohl Öffentliches Recht, Politische Wissenschaften und Geschichte studierte, so hätte er viel einschneidendere Eindrücke davontragen können. Franz Böhm, Carlo Schmid, die Frankfurter Schule, Karl Jaspers, Alfred Weber, Alexander Rüstow, Dolf Sternberger und Gustav Radbruch repräsentierten das Beste deutscher Geistigkeit. Daß Helmut Kohl trotz dieser Möglichkeiten am Ende das Dissertationsthema »Die politische Entwicklung in der Pfalz und das Wiedererstehen der Parteien nach 1945« wählte, ist ihm vorgehalten worden. Doch der Vorwurf verkennt Kohls Ziel. Er brauchte die Promotion für den Aufstieg, und dafür war das Thema ideal und der Erfolg sicher. Auch heute ist diese Arbeit noch immer eine interessante Studie zu einem Stück politischer Heimatgeschichte, nichts Aufregendes, aber auch nichts, wofür sich ein amtierender Bundeskanzler zu schämen hätte. Helmut Kohls Doktorarbeit ist aber noch aus einem anderen Grunde von höchstem biographischen Interesse. Sie enthält ein Selbstporträt, verpackt in eine Charakteristik der Pfälzer. Dieses Selbstporträt ist klug und voller Einsichten und demonstriert, was ihm manche absprechen wollen – Selbsterkenntnis. Es sei deshalb hier ausführlich wiedergegeben: »Die Pfalz beheimatet – soweit sich solche allgemeinen Feststellungen treffen lassen – einen fröhlichen und weltoffenen Menschenschlag, der viel Sinn für gesellschaftliches Zusammenleben und die Freuden der Zeit hat und dem dogmatischen Denken abgeneigt ist. Das rheinfränkische Erbe und die sich aus der Grenzlage ergebenden französischen Einflüsse mögen hierbei Zusammenwirken. Neben einem ausgeprägten Sinn für Toleranz besteht jedoch häufig ein allzu starkes und unangenehmes Selbstgefühl. In diesem »lautstarken« Auftreten hat auch der »Pfälzer Krischer« seinen Ursprung. Bei aller Aufgeschlossenheit und praktischen Intelligenz haben die Pfälzer keine ausgeprägte musische Veranlagung. Der Historiker Karl Hampe faßt seine Meinung über die Bewohner dieser Landschaft in dem Satz zusammen: »Der Pfälzer ist zu allen Zeiten, soweit wir seinen Charakter zurückverfolgen können, diesseitsfreudig und zugreifend, auf das Praktische gerichtet; die bedeutenden Männer, die die Pfalz hervorgebracht hat, sind zu allen Zeiten nahezu ausschließlich dem praktischen Leben zugewandt gewesene Auch Wilhelm Heinrich Riehl, der Verfasser des ersten volkskundlichen Buches über die Pfalz, beklagt das geringe Interesse des pfälzischen Volkes am geistigen Streben vor allem auf dem Gebiet der Kunst.«8 Nach dieser Selbsteinschätzung bleibt unerfindlich, weshalb die »offizielle« Biographie von Werner Maser den Bundeskanzler als Leser und Kenner von James Joyce, Charles Péguy, Georges Bernanos, Werner Bergengruen und Franz Kafka in Anspruch nimmt. Helmut Kohls an Heinrich Böll gerichtete Frage, warum er nicht wie Zuckmayer schreiben könne, dementiert diese Behauptung. Daß er sich vor einem Besuch bei Ernst Jünger über Léon Bloy ins Bild setzen läßt, weist ihn nur als höflichen Menschen aus.
Die ersten Stufen der Karriereleiter nimmt Helmut Kohl schnell: 1946 Eintritt in die CDU in Ludwigshafen, 1947 Mitbegründer der Jungen Union daselbst, 1953 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der CDU der Pfalz, 1954 bis 1961 stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz, 1955 bis 1966 Mitglied des Landesvorstandes der CDU Rheinland-Pfalz, 1959 Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes Ludwigshafen. Am 19. 4. 1959 Einzug in den Mainzer Landtag, 1960 bis 1969 Vorsitzender der CDUStadtratfraktion in Ludwigshafen, am 25. 10. 1961 Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz.
Helmut Kohl pflegt einen robusten Stil der politischen Auseinandersetzung. Die Prügelei mit einer sozialdemokratischen Klebekolonne im ersten Bundestagswahlkampf ist dabei eine eher komische Begebenheit am Rande. Anders die allein machtpolitisch zu verstehenden Auseinandersetzungen mit dem sozialdemokratischen Oberbürgermeister Dr. Hans Klüber von Ludwigshafen. Hier bleiben tiefe Verletzungen zurück, allerdings wächst auch die Einsicht des jungen Politikers, daß Aggressivität von den Bürgern in der Wahlkabine nicht honoriert wird.
Da Helmut Kohl von Anfang an zu politischem wie beruflichem Aufstieg in der CDU entschlossen war, spielt ein bürgerlicher Beruf in seinen Überlegungen kaum eine Rolle. Nachdem er sich sein Studium zum Teil als Steinschleifer bei BASF verdient hat, tritt er 1958 als Direktionsassistent in die Eisengießerei Mock ein, wechselt aber schon zum 1. 4. 1959 in den Landesverband Chemische Industrie Rheinland-Pfalz. Hier ist er als Referent für Wirtschafts- und Steuerpolitik tätig, doch vertauscht er die Rolle des Lobbyisten schon bald mit der des politischen Funktionärs. Die Partei ist praktisch von Anfang an Berufung, Beruf und Heimat. Helmut Kohl ist der erste klassische Berufspolitiker ohne Wurzeln in einem anderen gesellschaftlichen Milieu. Vieles, was ihm Erfolg gebracht hat, aber auch seine Begrenzungen haben hier ihren Urgrund. Niemand, der Helmut Kohls emotionale Bindung an seine Partei nicht zu teilen vermag, wird ihn jemals ganz verstehen – auch der Autor nicht.
Vor dem weiteren Aufstieg Helmut Kohls lag jetzt eine Barriere aus den Anfangsjahren der zweiten deutschen Republik. Peter Altmeier, der erste Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, hatte sich um die Identitätsfindung des Landes große Verdienste erworben. Aber er war zugleich ein typischer Vertreter jener Generation, deren Mangel an Einsicht schließlich den Ausbruch von 1968 auslöste, ein Mann, der die Zeit nicht mehr verstand und dem deshalb die Macht entglitt, was sich auch in den Wahlergebnissen ausdrückte. Helmut Kohl schaffte sich zielgerichtet personelle Stützpunkte in Landesverband und Fraktion, drängte in beiden die katholisch-konservativen Altmeier-Freunde zurück, wurde 1963 Fraktionsvorsitzender, 1964 Vorsitzender des Bezirksverbandes Pfalz und 1966 Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz. Als die CDU 1967 in den Landtagswahlen mit 46,7 Prozent ein achtbares Ergebnis erzielte, wurde Altmeier noch einmal Regierungschef, allerdings auf Zeit. Die Politik bestimmte bereits sein präsumtiver Nachfolger, der ihm mit Bernhard Vogel und Heiner Geißler auch zwei neue Minister verordnete. Als Altmeier 1969 die Staatskanzlei verließ, verabschiedete er sich öffentlich von allen, die ihn begleitet hatten, einschließlich seines Fahrers – allein Helmut Kohl blieb unbedankt.
Die rheinland-pfälzischen Jahre Helmut Kohls waren gute Jahre für ihn wie für das Land. Eine zweite Landesuniversität, 13 000 neue Arbeitsplätze in der Eifel, die Abschaffung der Konfessionsschule, eine Verwaltungsreform und das erste Kindergartengesetz zeigen eine effiziente und erfolgreiche Regierung. Neue Namen wie Hanna-Renate Laurien, Wilhelm Gaddum, Franz Klein, Richard von Weizsäcker und Norbert Blüm tauchen in der Umgebung Helmut Kohls auf. Die Wähler honorieren diesen »Modernitätsschub« bei den Landtagswahlen mit einer absoluten Mehrheit 1971 und 53,9 Prozent im Jahre 1975. Angesichts solcher Erfolge ist es akademisch zu fragen, ob Helmut Kohl die Macht erstrebte, um ein Programm durchzusetzen, oder ob er sich ein Programm erfand, mit dem er die Macht behalten konnte. Zwar deutet manches auf das letztere – in einem moralischen Sinne problematisch wäre dies jedoch nur dann, wenn das Programm zum Machterhalt gesellschaftlich schädlich ausgefallen wäre. Doch das haben nicht einmal seine politischen Gegner behauptet. Helmut Kohls Ehrgeiz blieb nicht auf das Land der Rüben und Reben beschränkt. Als Landesvorsitzender war er kraft Amtes Mitglied des Bundesvorstandes, 1967 wurde er auch in dieses Gremium gewählt, 1969 zum stellvertretenden Bundesvorsitzenden bestellt.
Dies geschah genau zu jener Zeit, da das erste christlich-demokratische Zeitalter in der Republik zu Ende ging und mit Kurt Georg Kiesinger der letzte große Staatsschauspieler der Gründergeneration die Bühne verließ. Doch da die Niederlage bei den Bundestagswahlen 1969 knapp ausgefallen war und die CDU deshalb die neue sozialliberale Koalition als etwas Unnatürliches, der Republik Wesensfremdes betrachtete, vermochte sie die Oppositionsrolle innerlich nicht anzunehmen. Die Macht, die Kiesinger in einem Moment der Unaufmerksamkeit entglitten war, sollte Rainer Barzel, der geschmeidige Fraktionsvorsitzende, in den Jahren der Großen Koalition zurückgewinnen. Die Ansprüche des Provinzpolitikers aus Mainz auf die Führung der Partei wurden deshalb zu Beginn eher belächelt denn als ernsthafte Bewerbung akzeptiert. Außerdem unterlief Helmut Kohl ein schwerer Fehler, der selbst seine Anhänger im linken Spektrum der CDU verunsicherte. Auf dem Mitbestimmungsparteitag der CDU in Düsseldorf 1971 stimmte er gegen eine von ihm mitformulierte, den Sozialausschüssen entgegenkommende Mitbestimmungsvorlage und verhalf so dem von Alfred Dregger vorgelegten Gegenentwurf des hessischen Landesverbandes zum Sieg. War es Rücksichtnahme auf die CSU, wie Kohl damals in das entsetzte Schweigen seiner Anhänger hinein verkündete, oder ein schlichter »Blackout», wie er später behauptet hat? Beides war keine Empfehlung für einen zukünftigen Bundesvorsitzenden, und so hatte Barzel leichtes Spiel. Doch Barzels Fundament war brüchig. Er war zu glatt, um den knorrigen Fundamentalisten der »Hallstein-Doktrin« Halt zu geben, und zu weich, um eine neue Politik zu formulieren. Als das konstruktive Mißtrauensvotum gegen Brandt mißlang, war Barzel schon ein geschlagener Mann. Die Bundestagswahlen von 1972, in denen die SPD 45,8 Prozent der Stimmen errang, bestätigten nur, was alle im Lande fühlten: Eine neue Zeit war angebrochen. Jetzt galt auch für die CDU der Satz Tancredis aus Lampedusas Leopard: »Wenn wir wollen, daß alles so bleibt, wie es ist, dann ist es notwendig, daß alles sich ändert.« Am 12. 6. 1973 wurde Helmut Kohl auf dem 21. Bundesparteitag der CDU in Bonn mit 520 von 600 gültigen Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt.
Der Neuanfang war schwierig. Die Partei war das Gewand des jeweiligen Dogen, doch nun gab es keinen Dogen mehr, und zurück blieb ein Häufchen Samt. Der neue Generalsekretär Kurt Biedenkopf, wie auch sein Nachfolger Heiner Geißler, machten aus dem Kanzlerwahlverein eine Partei. Neue Themen, eine neue soziale Sensibilität und die Hinwendung zu Frauen und jungen Menschen sollten die Partei wieder in die Mitte der Gesellschaft stellen, doch diese Mitte definierte sich in Niedersachsen anders als in Bayern. Auch die »Verlierer« von 68 wollten von Veränderungen nichts hören und versuchten mit kräftigen Schlägen gegen den Zeitgeist zu rudern. Helmut Kohl rückte aus dem linken Spektrum in die Mitte der Partei. Er sollte führen und mußte doch auch integrieren.
Mit der »Mannheimer Erklärung« von 1975 war der Erneuerungsprozeß abgeschlossen. Doch obwohl die Brandtschen Visionen einer Versöhnung von Geist und Macht, von Demokratie und Sozialismus, von aufrührerischer Jugend und parlamentarischen Institutionen sehr bald zu Bruch gingen und dem nüchternen Pragmatismus Helmut Schmidts Platz machen mußten, tat sich die Union schwer. Sie hatte das Kreuz von Franz Josef Strauß zu tragen. Wie Helmut Kohl immer unterschätzt wurde, so ist Franz Josef Strauß überschätzt worden. Denn außer in den Regierungsjahren der Großen Koalition hat Franz Josef Strauß in der deutschen Politik nur eine destruktive Rolle gespielt. Nie konnte er es den Liberalen verzeihen, daß sie ihn über die »Spiegel-Affäre« gestürzt hatten, und nie hat er es verwunden, daß er nördlich der Main-Linie nicht mehrheitsfähig war. Da er nicht Kanzler werden konnte, wünschte er auch keinen anderen CDU-Kanzler, am wenigsten aber Helmut Kohl. »Es gibt Strauß-Vertraute, die meinen, er habe Kohl gehaßt», hat Peter Boenisch geschrieben9