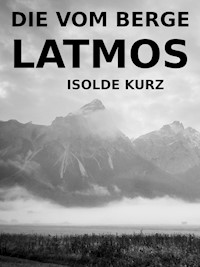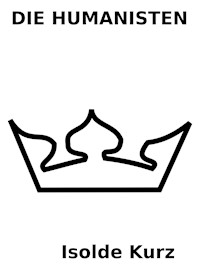Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Isolde Kurz ist auch heute noch eine ambivalente Schriftstellerin. Schon in jungen Jahren selbstständig als Autorin und Übersetzerin, war sie eine Seltenheit im wilhelminischen Deutschland. Später jedoch geriet sie wegen ihres Schweigens im Dritten Reich und ihrer altmodischen Sprache in Kritik. Hervorzuheben sind ihre Werke "Vanadis" und "Florentiner Novellen". Isolde Kurz wuchs in einem liberalen und an Kunst und Literatur interessierten Haushalt auf. Anfang der 1890er Jahre errang sie erste literarische Erfolge mit Gedicht- und Erzählbänden. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Isolde Kurz
Hermann Kurz
Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte
Isolde Kurz
Hermann Kurz
Ein Beitrag zu seiner Lebensgeschichte
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962812-27-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Vorwort
Einleitung
Des Dichters Jugendjahre
Nachlese aus den Gedichten der Maulbronner Zeit
Das blaue Genie
Erste Schaffensperiode
Beziehungen zu Mörike
Der Dichterkreis um Alexander von Württemberg
Schwarz-rot-gold
Das Brunnowsche Haus
Heirat
In der Frone der Freiheit
Neue Schaffensperiode
Unsere Kinderstube
Oberesslingen
Der Fremdling
Treue
Letzte Lebensjahre.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Widmung
Paul Heyse zugeeignet
Vorwort
Zwischen dem Anfang dieses Buches und seiner Vollendung liegen schwere persönliche Erlebnisse, die die Ausführung über Gebühr verzögert haben. Zwei Brüder, auf deren Mitwirkung und Teilnahme an der Wiedererweckung der gemeinsamen Vergangenheit ich vor allem gerechnet hatte, wurden rasch nacheinander gänzlich unerwartet vom Gipfel des Lebens weggerissen. Die dadurch veranlassten äusseren Veränderungen, mehrmaliger Ortswechsel und endliche Aufgabe eines langjährigen Wohnsitzes haben die Arbeit wiederholt aufs einschneidendste unterbrochen. Bei diesen jähen Umwälzungen ging von den seit lange gesammelten Notizen manches Wertvolle verloren, während zugleich die Durchsicht alter Truhen und vergessener Schubfächer unvermutet neues Material zu Tage brachte, das die Umarbeitung der schon geschriebenen Kapitel gebieterisch forderte. So wanderten diese Aufzeichnungen mit mir von Ort zu Ort, immer verfolgt von den unerwartetsten äusseren Hindernissen, dass es fast schien, als ob der Unstern, der über meines Vaters Leben waltete, noch einmal aufgegangen sei um auch das Zustandekommen dieser Erinnerungen an ihn zu hintertreiben. Erst auf einem einsamen Strandgebiet des tyrrhenischen Meeres, abgeschnitten von den literarischen Hilfsmitteln und fast ganz auf mein Gedächtnis angewiesen, gelang es mir schliesslich, sie zu Ende zu führen mit einer Eile, die nur noch darauf bedacht war, neuen Störungen zuvorzukommen. Dies möge die von mir selber am stärksten empfundene Unvollständigkeit des Buches erklären. Auch auf eine letzte Ausrundung musste ich verzichten, da die erste Hälfte sich schon im Druck befand, während die zweite geschrieben wurde.
Man suche auf diesen Blättern keine erschöpfende literarische Biografie; eine solche lag von vornherein nicht in meiner Absicht, sie ist Aufgabe des Literarhistorikers. Mir lag es vor allem ob, die menschliche Erscheinung des Dichters festzuhalten, wie sie durch Erinnerung und Überlieferung in meiner Seele haftet, und ich bin auch den kleinsten Zügen nachgegangen, eingedenk der Worte des alten Plutarch, dass oft eine Anekdote, ein Wort, eine überlieferte Geste für das Bild einer Persönlichkeit bezeichnender ist, als eine Staatsaktion.
Auffallen dürfte es dem Leser, dass von dem Punkte an, wo meine eigene Erinnerung einsetzt, die Gestalt meines Vaters nicht lebendiger hervortritt, vielmehr sich hinter der Familiengruppe teilweise fast verbirgt. Dies ist zum geringsten Teile Schuld der Schreiberin. Gerade für die Zeit, die ich mit erlebt habe, geht mir der greifbare Stoff der Darstellung aus. Es war die Zeit nach seinem Rücktritt aus der Öffentlichkeit, wo sein Wesen sich auf den innersten Brennpunkt zusammenzog. Ein langer Monolog, das war sein Leben, so lange ich ihn kannte, er unterbrach ihn auch nicht um zu uns zu reden. Die schweigende Macht seiner fast unpersönlichen Gegenwart aber konnte ich nicht anders zeichnen, als in der Umgebung, auf die sie, wenn auch nur leise, wirkte, vor allem in uns selbst, seinen Kindern. Aus diesem stark vortretenden Rahmen, in dem ich sein Bild einzig gekannt habe, konnte und wollte ich es nicht ablösen. Ein emporragender Mensch steht ja nicht allein im Universum, auch seine Angehörigen sind ein Teil von ihm. Und wie man aufwärts in der Ahnenreihe gerne die Züge verfolgt, die sein Wesen gebildet haben, ist es vielleicht nicht ohne Interesse, ihnen auch einmal in der absteigenden Linie noch weiter nachzugehen. An Hermann Kurz ist das landläufige Axiom, wonach ein bedeutender Vater unbedeutende Söhne haben muss, zu Schanden geworden: den glänzendsten Gegenbeweis hat mein Bruder Edgar geliefert. Ihn vor allem, der soviel begeisterte Liebe hinterlassen hat, wird man, hoffe ich, nicht ungern in seiner Knabengestalt hier wiederfinden; ich habe mich darum auch nicht gescheut zu erzählen, wie sich der Most zuweilen absurd gebärdet hat, der hernach einen so edlen Wein ergeben sollte. Es war des Zusammenhangs wegen unvermeidlich, dass manches von mir anderswo erzählte hier wiederholt und erweitert wurde.
Den grössten Dank für geleistete Hilfe schulde ich der Güte des Herrn Prof. Hermann Fischer in Tübingen, der mir ein reiches von ihm gesammeltes Material an Briefen für meine Zwecke zur Verfügung stellte. Ohne diese Papiere wäre meine Kenntnis vom Leben meines Vaters unzusammenhängend geblieben. Einzelne charakteristische Züge haben mir Jugendbekannte von ihm geliefert, denen ich nicht mehr danken kann. Für die späteren Jahre dienten mir dann und wann Aufzeichnungen, die meine Mutter noch zu seinen Lebzeiten gemacht hat. Von ihr, die in ungetrübter Geistesfrische bei mir lebt, konnte ich kein höheres Zeugnis ablegen, als, indem ich überall die reine historische Wahrheit erzählte, auch wo ich in der Auffassung der Dinge von ihr abweiche.
Das Leben eines Dichters zu schreiben ist keine lohnende Aufgabe. Denn den Stoff, aus dem der handelnde Mensch äusseres Leben aufbaut, verwendet der Schaffende zu seinen geistigen Gebilden. Was für den Biografen übrigbleibt, ist dann meist nur ein für die Darstellung wenig dankbarer Rest, der zudem weniger den Dichter selbst, als die Zeit, in der er gelebt hat, charakterisiert. Dies gilt in besonders hohem Grad von meinem Vater. Wen also der hier geschilderte Lebensgang nicht befriedigt, der greife zu des Dichters Werken. In ihnen findet er seine wahre Welt, die Welt, für die er geboren war, mit allem Glanz und aller Fülle, um die das Leben ihn betrogen hat.
Forte dei Marmi, im Dezember 1905.
Einleitung
Am 10. Oktober 1873 hat der Dichter Hermann Kurz die Augen geschlossen. Seine Lebensgeschichte ist bis zur Stunde noch nicht geschrieben. Die knapp umrissene, aber meisterliche Porträtskizze die Paul Heyse in seinem Vorwort zu der ersten Gesamtausgabe der Werke von Hermann Kurz entworfen hat, ist noch immer das einzig zuverlässige Bild, das von dem Dichter existiert. Was von anderer Seite hinzukam, war häufig eher dazu angetan, die Züge zu verwirren, als sie deutlicher herauszuformen. Es gibt vielleicht kein Dichterlos, das einen grösseren Gegensatz zwischen innerer Anlage und äusserem Lebensgang aufweist als das seinige. Da er ein Freund astrologischer Studien, versteht sich zu poetischen Zwecken, war, so verstösst es nicht gegen seinen Geist, wenn ich von ihm sage, dass er nach der Konstellation seiner Geburtsstunde zu den sonnigen Jupiterskindern gehörte, dass aber böse saturnische Einflüsse frühe in sein äusseres Geschick eingriffen und sein Dasein mit Kampf und Not erfüllten. Daher steht sein persönliches Leben in tiefem Schatten, während über seinen Werken der Sonnenschein des siegreichen Humors, der unzerstörbaren Weltfreudigkeit lacht. Dieses Gegensatzes zwischen Naturell und Schicksal sich immer bewusst zu bleiben, ist für den nachgeborenen Biografen nicht leicht, der für des Dichters Persönlichkeit ganz auf die schriftlichen Zeugnisse, vor allem auf seine eigenen Briefe, angewiesen ist. Hier findet er nur den oft herzbrechenden Bericht über seine Kämpfe mit der Aussenwelt, aber die Ergänzung fehlt, die die Briefempfänger in Händen hatten: das Bild der gemeinsam durchschwelgten hohen Stunden und des elastischen Siegesmuts, mit dem der Dichter nach jeder Enttäuschung sich wieder aufrichtete; denn was sich von selbst versteht, das pflegt man in Briefen nicht auszusprechen. Wer nun seine Laufbahn Schritt für Schritt an der Hand dieser Zeugnisse verfolgt, um sie in den schroffen Aussenlinien wiederzugeben, wie sie sich etwa in dem Briefwechsel mit seinem Jugendfreunde Rudolf Kausler darstellt, der ist in Gefahr, sein Bild viel zu sehr grau in grau zu malen, wie es den meisten begegnet ist, die über ihn schrieben.
Da kann es auch beim wärmsten Bemühen nicht an Verzeichnungen fehlen: derselbe Mann, von dem Heyse aus seinen trübsten Lebensjahren berichtet, dass, wer sein Schicksal nicht kannte, ihn nach dem Glanze seiner Augen, seiner freien Haltung, der Milde und freudigen Kühnheit seines Wesens für einen der Lieblinge des Glückes halten musste, erscheint in den Darstellungen der Späteren nicht selten als ein düsterer, früh verbitterter, knorriger, menschenfeindlicher Sonderling. Es ist ihnen daraus kein Vorwurf zu machen, sie kannten ja nur die Nöte, die ihn bedrängten, und die wachsende Vereinsamung seiner Mannesjahre, aber nicht die frischen Hilfsquellen, die fort und fort in seinem Innern sprudelten. Heyse allein, der aus dem unmittelbaren Austausch schöpfte, besass noch die Mittel, dieser Erscheinung die volle Lebenswahrheit zu geben. Aber seine unübertrefflich schöne Schilderung ist nur ein Umriss und beschränkt sich auf des Dichters letzte Lebensjahre. Den späteren Darstellern liegt es ob, die von Heyse angelegte Skizze zum Gesamtbild zu erweitern. Das ist keine leichte Aufgabe. Es braucht dazu ausser dem nahen Vertrautsein mit dem Boden Alt-Württembergs die eingehendste Kenntnis der literarischen und politischen Verhältnisse seiner Zeit. Beides steht mir nicht zu Gebote. Und leider bin ich nicht einmal imstand, diese Mängel durch eine Fülle lebendiger Erinnerungen aufzuwiegen. Fiel doch meines Vaters bestes Leben lange vor die Zeit meiner Geburt, und der Mann, dem als Jüngling von seiner dionysischen Tafelrunde (S. »Das Wirtshaus gegenüber«) das beneidenswerteste Mundstück zuerkannt worden war, redete als Familienvater fast gar nicht mehr, am wenigsten in den späteren Jahren, wo ich erst zu einem Austausch fähig wurde. Ich kann also auch meinerseits nicht den Anspruch erheben, die Lücke befriedigend auszufüllen. Doch gibt mir der Besitz von intimen Familienbriefen und manche erhaltene Überlieferung wenigstens einen Einblick in die Zeit seines Werdens, und der Vorteil des gemeinsamen Blutes lässt mich hoffen, manche Züge seines Wesens richtiger, als dem Fremden möglich ist, zu deuten und so dem künftigen, besser ausgerüsteten Biografen die Gesichtspunkte für die Auffassung des Menschen und des Dichters Hermann Kurz zu liefern.
Als ich mein geistiges Auge zu öffnen begann, lebte mein Vater schon wie ein lebendig Verschollener. Ein Bannkreis umgab den schweigenden Mann, der ihn gleichsam von der Mitwelt absonderte. Es war, als wären alle übereingekommen, von dem, was er der Welt gegeben hatte, zu schweigen. Die mit ihm jung gewesen, seine Freunde und Mitstrebenden, hatte das Schicksal frühe stumm gemacht. Das nachwachsende Geschlecht besass in jener literarisch matten Zeit nicht so viel selbstständigen künstlerischen Instinkt, um sich ohne Hinweis von aussen für eine echte Kunstschöpfung zu begeistern. Die politische Partei, der er seine besten Mannesjahre geopfert hat, stand seiner reinen tendenzlosen Kunst kühl gegenüber. In der Literatur wurde er gar mit Heinrich Kurz, dem Literarhistoriker, verwechselt. Die Jugend sang seine Lieder nach den Silcherschen Melodien und wusste nicht mehr, wer der Verfasser war. Wir fühlten uns wie Königskinder im Exil, deren Vater seine rechtmässige Krone nicht tragen darf.
»Ich bin zwischen die Zeiten gefallen«, sagte der Dichter selbst, wenn er in späteren Jahren sich je einmal über seine literarische Laufbahn äusserte. Ja, er war zu spät gekommen für die Zeit, wo rein poetische Interessen im Vordergrund des deutschen Geisteslebens standen. In den bald danach ausbrechenden politischen Stürmen verstummte seine parteilose Muse, während der Dichter selbst zum Kämpfer wurde und seine ganze persönliche Existenz für seine Überzeugung einsetzte. Nachdem der Sturm sich gelegt hatte, gab es kein literarisches Württemberg mehr, und ein Deutschland, das dem Dichter hätte vergüten und vergelten können, gab es überhaupt noch nicht. Unter dieser bösen Konjunktur verfloss sein Leben. Als er dann nach seinem Tode in den Gesammelten Werken zum ersten Mal in geschlossener Gestalt vor das Publikum trat, da wiederholte sich das »Zwischen die Zeiten fallen«. Nun gab es zwar ein Deutschland, aber dieses Deutschland, das eben erst im grossen und groben von dem gewaltigsten Werkmeister zurechtgezimmert war, hatte zunächst anderes zu tun, als ästhetischen Interessen nachzugehen, und als es sich endlich auf diese wieder besann, da wollte man in dem neuen Reiche alles neu haben, am neuesten die Kunst; man lebte von der Erwartung der Dinge die da kommen sollten und liess sich nur sehr ungerne daran erinnern, dass es schon vordem eine deutsche Dichtkunst gegeben hatte. Überdies wurde jetzt das mit der politischen Führerschaft verbundene Überwiegen des norddeutschen Geistes auch in der Literatur der Verbreitung eines so spezifisch süddeutschen Dichters, wie Hermann Kurz, hinderlich. Und als schlimmster Gegner kam noch der rohe Naturalismus dazu, der wieder für eine lange Zeit die Wege der wahren Kunst verschüttete. Wenn zuvor Hermann Kurz mit seinem kühnen und trotzigen Wahrheitssinn für eine matte, durch flaue Schönfärberei verzärtelte Periode zu männlich und stark gewesen war, so wusste diese, die die Fahne eines falschen Realismus schwang, wiederum nichts mit ihm anzufangen, weil seine Wahrheitsliebe auf die typische, immer wiederkehrende Wahrheit, nicht auf die zufällige, einmalige gerichtet ist. Aber auch die schlimmste Konjunktur nimmt einmal ein Ende. Zwar nur langsam, wie Gletscher schieben, aber unaufhaltsam verschiebt sich ein Kulturbild. So scheint nun endlich der Tag für Hermann Kurz anzubrechen. Schon in den letzten Jahren stellten sich Zeichen ein, dass die Erinnerung an ihn zu erwachen beginne, die Reclamsche Universalbibliothek verbreitete seine kleinen feinen Erzählungen, dann mit Ablauf der literarischen Schutzfrist erschienen als die ersten Schwalben die Neuauflagen der grossen Romane, denen jetzt fort und fort weitere Ausgaben folgen, und endlich brachte als dankenswertestes Unternehmen der Verlag von Max Hesse die neue, von Hermann Fischer, dem Sohne des Dichters J. G. Fischer, besorgte Ausgabe der Sämtlichen Werke, die durch einige wertvolle, in der früheren Gesamtausgabe fehlende Stücke ergänzt und mit gediegenen, von liebevollem Verständnis durchdrungenen Einleitungen zu jedem Bande versehen ist. Wie ein Verschütteter aus tiefem Schachte steigt der Dichter heute herauf, in voller Frische, unberührt vom Fittich der Zeit, die so viele seiner gefeierteren Zeitgenossen unterdessen in Staub und Asche gewandelt hat. Kein Rünzelchen auf der blühenden Wange seiner Muse. Seine Gestalten sind noch lebendig und menschlich wahr bis in die kleinste Nebenfigur herab, Sprache und Gedanken sind unveraltet, jede Zeile neu und blank, als wäre sie heute geschrieben. So tritt der Dichter einem neuen Geschlecht gegenüber, auf das der alte Unstern nicht mehr wirkt: es gibt heute keine literarischen Moden mehr, da in unsern Tagen alles und nichts Mode ist; der Zeitgeist wendet sich wieder den ästhetischen Interessen, wenn auch noch mit ungenügenden Mitteln zu, die geistigen Zollschranken innerhalb Deutschlands sind gefallen, und wenn der Süden sich des Vorrechts seiner älteren Kultur begeben hat, um auf das bewegtere Geistesleben seiner norddeutschen Brüder einzugehen, wenn er sogar zu diesem Zweck das Fremdartige der niederdeutschen Sprechweise überwindet, so darf er jetzt vom Norden das gleiche Entgegenkommen für seine führenden Geister erwarten. Damit ist dem Dichter, der die Heimatkunst pflegte, lange bevor dieses neue Wort für eine alte Sache geprägt war, endlich der Weg aus der engeren Heimat, die für seine Maasse zu klein war, in das grosse Gesamtvaterland eröffnet.
Um aber zu begreifen, wie es zuging, dass ein Dichter von der Stärke und Bedeutung eines Hermann Kurz von seiner Zeit so unter Schutt begraben werden konnte, muss man sich den Boden Alt-Württembergs, dem er entsprossen ist, und die Zeit seines Wachstums vor Augen halten.
Die Schwaben gelten gewiss mit Recht für einen reich begabten Volksstamm. Aber auf engen Raum zusammengedrängt und von Natur mit harten Köpfen begabt, haben sie sich von jeher schlecht miteinander vertragen. Das Bestreben, einander zu verkleinern, ja lieber einen ganz Fremden, wäre er auch minder verdienstvoll, anzuerkennen, als einen der Eigenen, ist ein unverwischbares Stammesmerkmal. Diese Sucht, sich gegenseitig am Zeuge zu flicken, die durch das angeborene kaustische Element verschärft wird, ist so allgemein, dass der Schwabe sich derselben kaum bewusst ist und häufig gar keinen bösen Willen damit verbindet. Selbst in die Klangfarbe des Dialekts hat sich diese Streitsucht eingeschlichen; denn wenn zwei Schwaben auf der Strasse zusammen reden, scheint es dem uneingeweihten Ohre, als zankten sie sich. Erst im Ausland kommt es ihnen zum Bewusstsein, wie viel schonender andere Stämme unter sich verkehren.
In diesem Lande gedeiht das Talent nicht durch Förderung, sondern durch Gegensatz und Widerstand: das dickköpfige Philisterium ist dort der Nährboden des Genius, der mit ihm zu kämpfen hat. Das ist ein Krieg auf Tod und Leben, wobei meistens der Genius auf die Dauer seiner Erdentage unterliegt, um dann später in verklärter Gestalt aufzuerstehen und den Kampf mit besseren Aussichten fortzusetzen. Aller Ruhm Alt-Württembergs geht von seinen Dissidenten aus. Diese sind sämtlich Geschwister von Schiller ab, zwar ungleich an Talent und Temperament, aber gleich an wetterfestem, not- und todverachtendem Idealismus. Ein Familienzug, der sie von weitem kenntlich macht, ist ihre trotzige Gebärde; sie wollen stets mit dem Kopf durch die Wand. Sie sind eben keine Olympier, sie sind Titanenkinder. Eine Ausnahme bildet Mörike, der die umgebende Welt sich anpasst, indem er sie mit seiner spielenden Fantasie, fast ohne es zu bemerken, vollkommen umgestaltet. Dieser lebte denn auch unangefochten dahin, die Philister taten ihm nichts zuleide, er verkehrte mit ihnen auf du und du, und sie bemerkten gar nicht, dass er ein Genie war, sondern hielten ihn für ihresgleichen.
Allein nicht nur der Philister war in Württemberg dem aufstrebenden Genius hinderlich, auch seine Geistesverwandten verlegten ihm den Weg. Das kleine Land war ja viel zu reich an Talenten, um ihnen allen Raum zur Entfaltung zu geben; an den Grenzen aber war die Welt mit Brettern vernagelt. Wer darüber hinausstürmte, der konnte im Elend zugrunde gehen wie Waiblinger, oder wie Hölderlin als ein Schiffbrüchiger zurückkehren. Darum ging es, wie es oft in begabten aber armen Familien zu gehen pflegt, wo ein jeder sein Talent und seine Individualität zur Geltung zu bringen sucht und keiner den andern recht aufkommen lässt. Anderwärts ereignet sich gerade das Umgekehrte: man bildet Cliquen zur gegenseitigen Anpreisung und Förderung, dass der Fremde glauben könnte, in eine ganze Pflanzschule von Genies geraten zu sein. In Württemberg aber fehlte es dem Genius von vornherein an Verkündigern. Sollte ein einheimisches Erzeugnis dort Anerkennung finden, so musste es zuvor exportiert und mit einer auswärtigen Marke wieder eingeführt werden. Ein preussischer Hauptmann war es, der die erste Ausgabe von Hölderlins Gedichten veranlasst hat. In unsern Tagen hat der Norden begonnen, den Ruhm des halbverschollenen Mörike zu machen, wie er zuvor den Uhlands gemacht hatte. Von Schiller ganz zu schweigen. Nicht umsonst singt Mörike von diesem:
der an Herz und Sitte Ein Sohn der Heimat war, Stellt sich in unsrer Mitte Ein hoher Fremdling dar.
Das war es, was ihm schliesslich seine Geltung gab, dass er als Fremdling wiederkam. In echt schwäbischem Sinn hat einmal Theobald Ziegler den Ursprung der Redensart »er ist nicht weit her« untersucht. Dass er nicht weit her war, liess auch Hermann Kurz nicht in seiner vollen Bedeutung erscheinen, gerade sein starkes Heimatgefühl, das ihn hinderte, den Boden Württembergs zu verlassen, ist ihm in der Heimat schädlich geworden. Nicht als ob es den Schwaben an Sinn für ihre heimischen Produkte gebräche, sie tun sich vielmehr auf die grosse Menge ihrer schöpferischen Geister recht viel zugute; aber sie haben nun einmal die Neigung, diesen bei Lebzeiten den Brotkorb so hoch wie möglich zu hängen. Das wunderliche Stammesselbstbewusstsein, das sie so oft getrieben hat, ihre Grossen als quantité négligeable zu behandeln, findet seinen klassischen Ausdruck in dem köstlichen Vers von Eduard Paulus:
Der Schelling und der Hegel, Der Schiller und der Hauff, Das ist bei uns die Regel, Das fällt uns gar nicht auf.
Auf einem so sonderbaren Boden war die berühmte alte »Schwabenkultur« aufgebaut. Freilich, es war ihr auch anzusehen. Sie umfasste die ganze Welt des Gedankens und besass doch nicht das kleinste Fleckchen, auf dem sie sich sichtbar niederlassen konnte. Das macht: sie war ausschliesslich Männersache; die Schwäbinnen, wenigstens die des Mittelstandes, taten nicht mit, sie beharrten mit Überzeugung in der Unkultur. Es gab keine gesellschaftliche und ästhetische Erziehung durch die Frau; bei der Heirat brach entweder die Entwicklung des Mannes ab, oder es trat bei ihm eine völlige Teilung des inneren und des äusseren Menschen ein. Daher blieb diese Kultur eine rein literarische, die aus dem Studierzimmer der Poeten und Gelehrten nicht einmal bis in die nächste Umgebung den Weg fand, sodass, während das Familienhaupt zu den Sternen am geistigen Himmel zählte, häufig die nächsten Angehörigen in einer fast bäurischen Unwissenheit und Formlosigkeit dahin lebten. Es hat etwas Schauerliches, sich die Weltweite dieser Geister und dazu die erdrückende Enge ihres leiblichen Daseins vorzustellen. Dazu kommt, dass fast alle talentvollen jungen Leute durch die Armut zum unentgeltlichen Studium der Theologie getrieben wurden und dass eine Landpfarrei das gewöhnliche irdische Ziel der Titanensöhne war. Der Weg dahin führte durch die Pforte des »Landexamens« in die klösterliche Zucht der niederen Seminarien und von da in das bekannte »Tübinger Stift«. In diesem Stift, der wahren Stiefmutter unserer grossen Geister, wurden sie in den Entwicklungsjahren von allem äusseren Leben ferngehalten und systematisch zu jener vielberufenen stiftlerischen Unweltläufigkeit erzogen, die ihnen später das Weiterkommen auf jedem anderen als dem von der Anstalt vorgeschriebenen Wege so sehr erschweren musste.
Wenn es ohnehin die Art der schöpferischen Naturen ist, sich unter dem Eindruck ihrer inneren Gesichte schwerer in der Welt zurechtzufinden als der gewöhnliche Menschenschlag, so hat Alt-Württemberg seinen genialen Männern noch geflissentlich Ketten um Ketten an die Füsse gelegt.
Des Dichters Jugendjahre
Hermann Kurz ist am 30. November 1813 zu Reutlingen geboren, der ehemaligen freien Reichsstadt, die ein Dezennium zuvor württembergisch geworden war. Die Eindrücke, die er dort empfing, haben all seinem späteren Dichten und Schaffen die Grundfarbe gegeben. Ich selber kenne die altertümliche, von den Geistern der Döffinger Schlacht umschwebte Jugendstadt meines Vaters nur aus seinen Dichtungen; das Reutlingen, das ich später mit Augen sah, ist davon so völlig verschieden, dass es mir niemals möglich war, beide in ein Bild zusammenzufassen. Seine Eltern waren, als ich zur Welt kam, lange tot. Überhaupt kannte ich keinen von seinen früheren Angehörigen, als seinen einzigen Bruder, der ihn um wenige Jahre überlebte. In meiner Kinderfantasie spielte die mütterliche Familie, das alte Freiherrngeschlecht von Brunnow, unter dessen Reliquien wir heranwuchsen, eine grosse Rolle, während der väterlichen Vorfahren nie von uns gedacht wurde. Das war sehr begreiflich: mein Vater sprach uns nicht von ihnen, und meine Mutter hatte sie nicht gekannt. Sein Schweigen rührte jedenfalls zum Teil davon her, dass er diese Gestalten schon in Poesie verwandelt hatte und dass es ihm gegen die Natur ging, das dichterische Gewebe in seinem Geiste wieder aufzulösen und den nackten historischen Inhalt herauszuholen. Für ihn waren sie nunmehr völlig das, was seine Fantasie aus ihnen gemacht hatte. Ich hielt also, bevor ich seine »Familiengeschichten« kannte, nicht viel auf diese ehrsamen Reutlinger Glockengiesser und Spritzenmeister, und mit der Offenherzigkeit, die Kindern eigen ist, sagte ich eines Tages zu meinem Vater: »Es ist eigentlich doch recht schade, dass unsere Mama nicht lieber einen Standesgenossen geheiratet hat, dann wäre ich jetzt auch eine Geborene.« Er antwortete lächelnd, aber doch mit einem gewissen Nachdruck: »Du bist schief gewickelt, liebes Kind, wenn du dir viel auf deine mütterlichen Ahnen einbildest, die als Raubritter auf ihren festen Burgen sassen und harmlose Wanderer plünderten. Da waren deine Ahnen väterlicherseits ganz andere Leute: regierende Bürgermeister und Senatoren einer kleinen Republik, die über Leben und Tod, über Krieg und Frieden zu entscheiden hatten.« Diese Worte imponierten mir sehr, und von da an betrachtete ich die Reutlinger Vorfahren mit ganz anderen Augen, obgleich ich mich in ihre harte und enge Welt doch nicht hineinzudenken vermochte.
Sie reichen urkundlich bis ins fünfzehnte Jahrhundert zurück, wo sie als freie Bauern auf ihrem eigenen Erb und Lehen sassen. Um 1483 war ein Hanns Kurtz von Österreich mit einem Grundstück bei Kirchentellinsfurt belehnt worden. Von da an verschwindet der Name Kurtz nicht mehr aus den Annalen der freien Reichsstadt. Es wird seinen Trägern nachgerühmt, sie hätten frühe das Streben gezeigt, zur geistigen Aristokratie des Landes aufzurücken. Jedenfalls erscheinen sie schon in den ältesten Urkunden als ein freimütiges, unternehmendes, wohl auch etwas hochfahrendes, dabei aber kernhaftes und tüchtiges Geschlecht, das alsbald mit persönlichen Zügen hervortritt. Auch die Wander- und Abenteurerlust, die viele Glieder späterhin weit über die Erde verstreut hat, zeigt sich zeitig: im 16. Jahrhundert begleitet ein Sebastian Kurtz Kaiser Karl V. als Fuggerscher Agent nach Italien und wird durch seine Aufzeichnungen zur wichtigen Geschichtsquelle für den Schmalkaldischen Krieg. Die Familie schrieb sich abwechselnd Kurtz, Kurz und Curtius; unser Zweig hielt an dem älteren »tz« fest, bis im Jahre Achtundvierzig mein Vater, seinem sonst so ausgeprägten historischen Sinn entgegen, das »t« aus dem Namen strich, weil jetzt jeder Zopf fallen müsse. Die Nachkommen haben aus Pietät die von ihm bestimmte Schreibart beibehalten, obwohl sie stets das Aufgeben der älteren Form bedauerten. Unser Familienwappen, ein goldener Löwe, der, auf grünem Dreiberg stehend, eine schwarze Hausmarke in den Pranken hält, wurde im Anfang des siebzehnten Jahrhunderts verliehen. Ein anderer Zweig, der bald ausstarb, erhielt für die in Kriegszeiten dem Kaiser geleisteten Dienste ein Wappen, worauf der römische Ritter Curtius dargestellt ist, wie er auf weissem Ross in goldener Rüstung in den von Flammen umzüngelten Abgrund sprengt. Unsern Ast begründete ein Michael Kurtz, der zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts an der Spitze einer grossen Werkstatt für Glocken und Feuerspritzen stand und seine Erzeugnisse durch die Schweiz und einen grossen Teil Deutschlands versandte. Von ihm wird berichtet, er sei einmal auf vierzehn Tage in den Turm gesetzt worden, weil er gegen die vielen Steuern opponierte, und bei seiner Freilassung habe er einen Schein ausstellen müssen, dass er nicht, wie er gedroht, den einen oder andern Ratsherrn, wenn sie bei seinem Haus vorüber in die Kirche gingen, niederschiessen würde. Man traute ihm zu, dass er der Mann wäre, seine Drohung wahr zu machen, denn man hatte ein mit zwei Kugeln geladenes Feuerrohr bei ihm gefunden. Auf diesen Feuerkopf folgte sein ebenso energischer Sohn Johannes, jener vielgewanderte Ururahn mit dem spanischen Leibfluch und dem »bordierten Hütlein«, bei dem meines Vaters Familiengeschichten beginnen. Das »bordierte Hütlein«, das der wackere Zunftmeister und Ratsherr als Zeichen seiner Würde trug, wurde in der Verwandtschaft sprichwörtlich bis auf unsere Generation; denn so oft einer aus der Familie den Kopf etwas hoch trug, hiess es von ihm: »er hat das bordierte Hütlein auf«. Dieser Johannes, der sich im Ausland in seiner Kunst sehr vervollkommnet hatte, brachte das väterliche Gewerbe erst recht in Flor. Nach seiner Rückkehr heiratete der stattliche junge Meister jene liebliche, durch einen Vormund um ihr Vermögen geprellte Schafhirtin, deren Geschichte in der »Reutlinger Glockengiesserfamilie« erzählt ist.
In Wirklichkeit hiess sie Magarete; der Dichter hat ihr diesen Namen genommen, schwerlich aus Irrtum, sondern weil er ihn für die im »Witwenstüblein« erzählte Geschichte seiner eigenen Vatersschwester, der bekannten »Frau Dote«, brauchte, und hat ihn durch den gleichfalls poetischen Namen einer andern Vatersschwester Dorothea ersetzt. Herr Johannes war ein heftiger und ehrsüchtiger Mann, der nicht die geringste ihm zugefügte Unbill ertragen konnte; aber als bei dem grossen Brande seiner Vaterstadt, dem er als Spritzenmeister zu wehren hatte, ein langjähriger Freund sein ganzes ihm anvertrautes Hab und Gut veruntreute, nahm er diesen Schlag geduldig als göttliche Schickung hin und begann getrosten Muts sein Handwerk von neuem. Was von ihm in der »Reichsstädtischen Glockengiesserfamilie« erzählt wird, scheint durchweg auf Tatsachen zu beruhen, wogegen bei der romantischen Liebesgeschichte seines Sohnes Franz ebenso wie in der seines Enkels »Wie der Grossvater die Grossmutter nahm« der historische Zettel stark mit dichterischem Einschlag verwebt ist. Dagegen sind die Persönlichkeiten hier wie in den nachfolgenden Geschichten getreu nach den Überlieferungen und zum Teil nach der Erinnerung gezeichnet, besonders jener letztgenannte Grossvater, der alte patriarchalische Senator Johannes, der »Herr Ehni« des Dichters, der als Siebenundachtzigjähriger wenige Tage vor seinem Tod in Gegenwart seines Enkels Hermann beim Scheibenschiessen den Meisterschuss tat. Diesem liebenswürdigen Greis wird eine an den Jünger Johannes erinnernde Sanftmut nachgerühmt, welche Eigenschaft bis dahin nicht zu den vorwiegenden Stammesmerkmalen gehörte. Züge von ihm finden wir später in der heimeligen Gestalt des alten glockengiessenden »Amtsbürgermeisters« der »Heimatjahre« wieder, dem sogar ein verstecktes Kennzeichen beigegeben ist: die Zinnbecher, aus denen der Wackere seine Gäste labt, tragen das Kurtzsche Familienwappen, den Löwen, der auf dem Dreiberg steht. Es liegt ein unwiderstehlicher, aus dem Gemüte fliessender Zauber über der Schilderung seines Heimwesens – »eine Heimstätte, wo wir ewig verweilen möchten«, nennt es der geistvolle Kürnberger in seinen »Literarischen Herzenssachen«.
Vom Ururgrossvater bis zur unvergesslichen »Frau Dote« hat der Dichter vier Generationen seiner Familie in ihren Eigenheiten und ihrer Umgebung geschildert; ihnen schliesst sich noch das Bild vom alten Vaterhause seiner Mutter in Tübingen an, das im ersten Buch der »Denk- und Glaubwürdigkeiten« so lebendig gezeichnet ist. Über die eigenen, früh verlorenen Eltern aber geht der Dichter mit wenigen eingestreuten Worten rasch hinweg; wohl nicht, weil ihn sein Gedächtnis auf diesem Punkt im Stiche liess, sondern aus einer Scheu des Gefühlslebens, die ihm gerade über die Nächsten und Teuersten den Mund verschloss. Es waren auch keine Erinnerungen so heller und freudiger Art, die ihn mit dem eigenen Vaterhaus verknüpften.
Sein Vater Gottlieb David Kurtz, der schon im dreiundvierzigsten Jahre an der Schwindsucht starb, war ein Mann von vorwiegend geistigen Interessen, ein heller Kopf, dabei glühender Verehrer Schillers, der glücklich war, wenn sein begabter Ältester schon als kleiner Junge Schillerische Balladen und andere Gedichte rezitierte. Aber er hatte den kaufmännischen Beruf ohne innere Neigung erwählt, und dieser brachte ihm kein Glück; da er nun obendrein selbst eine Fortschritts- und Dissidentennatur war, sich auch durch einen Aufenthalt in der Schweiz grössere Gesichtspunkte angeeignet hatte, konnte es ihm in der stockenden Enge seiner heimischen Verhältnisse nicht allzuwohl sein. Er wurde ein Parteigänger seines unglücklichen Landsmanns, des »Weltverbesserers« List, und spann dabei nach dem Zeugnis seiner Gattin »keine Seide«. Wie der grosse Nationalökonom um jene Zeit in seiner Heimatstadt angeschrieben war, beweist des Dichters Bericht, dass, wenn er in der Knabenzeit sich irgendwie nicht in den hergebrachten Schlendrian fügen wollte, erschreckte Basen ihm zu drohen pflegten: »Wart, dir wird es gehen wie dem List!« – Durch unglückliche Unternehmungen kam mein Grossvater um den grössten Teil seines Vermögens. Der Kummer über dieses Missgeschick, zu dem sich das körperliche Leiden gesellte, verdüsterte seinen frühen Lebensabend und trübte den Humor, der als Familienzug auch ihm nachgerühmt wird. Darunter hatte die Jugend des Sohnes zu leiden. Die beiden waren ganz geschaffen, sich zu verstehen, aber wie es häufig zwischen einem reizbaren Vater und einem lebhaften Sohne zu gehen pflegt, sie fanden den Weg nicht zu einander. Zwischen dem kränklichen, verstimmten Mann und dem begabten, temperamentvollen Knaben kam es häufig zu Missverständnissen, die noch in der Seele des Sohnes schmerzlich nachzitterten, als er selber ein gereifter Mann war. Als düsterster Schatten aus seiner Jugendzeit begleitete ihn die Erinnerung an des Vaters Sterbestunde. Es war am 13. April 1826, dass den Leidenden in Gegenwart der Seinen der Tod ereilte. Man glaubte ihn schon verschieden, und der zwölfjährige Sohn Hermann hielt ihm ein Licht an den Mund, um zu sehen, ob er noch atme. Da öffnete der Sterbende noch einmal die Augen und liess einen grossen Blick über ihn hinrollen, in dem das erschrockene Kind einen Vorwurf über diese letzte Störung zu lesen glaubte. – Des Vaters unbefriedigendes Schicksal muss dem jungen Hermann Kurz vor allem vorgeschwebt haben, als er im Jahr 1841 einem neugeborenen Neffen die Verse schrieb:1
Du bist, o Kind, von einem Stamme, Dem es noch selten hier gelang, Ein schöner Stern war seine Amme, Doch leider stets im Untergang. Die einen sind im Sand versunken, Von dumpfem Missgeschick bedrängt, Die andern sind im Schlund ertrunken, Vom jähen Mut dahingesprengt. Stets unvollendete Geschicke, Der Anfang gross, das Ende klein! Wird das so bleiben mit dem Glücke? Das Halbe nie ein Ganzes sein? Sei du es denn, in dessen Leben Vollendet ist der Väter Haus, Dein, dein sei unser ernstes Streben, Und führ es du ans Ziel hinaus. Dir sei’s, mein Liebling, zum Gewinne, Was edel war an uns und echt, Du unser Erbe und beginne Ein neues glückliches Geschlecht.
Dieselben Gedanken und Empfindungen hatte er schon drei Jahre früher in einem Brief an Eduard Mörike ausgesprochen:
»Dieses Misslingen nämlich, von dem ich sagte, scheint den Meinigen – von der gegenwärtigen Generation lässt sich noch nichts sagen – angeboren : mein Vater hatte die grössten Ansprüche auf ein gelungenes Leben und ist bitter getäuscht worden; und ebenso ist es mit Onkeln und Vettern gegangen: die einen taugten gar nicht in die Welt, die andern haben mit dem besten Willen und Verstand nichts Gescheites herausgebracht (ich kann sagen just die, die den Familiencharakter entschieden an sich trugen; an Indifferenten hat’s nicht gefehlt, die vorwärts gekommen sind), sodass sich einer, der das in seinem Blute fühlt, oft fragen mag: wird dieser Typus so fortdauern oder kommt zuletzt einer, dem Fortuna das gibt, was sie seinen Vorfahren so oft hinhielt und wieder zurückzog?« – Jener Neffe, dem er die im selben Brief erwähnte, sauer zu verdienende »Vollendung« zugedacht hatte, sollte ihrer freilich nicht teilhaft werden, denn er starb im frühen Kindesalter.
Ich gestehe, dass ich den auch sonst in der Familie verbreiteten Aberglauben, als ob ihre Glieder zum Unheil prädestiniert seien, meinerseits nie begriffen habe. Ich weiss freilich nicht, wer die »im Schlund Versunkenen« sind. Die von dem Dichter geschilderte Ahnengalerie zeigt lauter Charakterköpfe, die sich mit ihren Eigenheiten und ihrem Willen durchzusetzen wussten. Um Hermann Kurz’ dornenvolles Dichterlos zu erklären, bedarf es keines besonderen Familienunsterns, die politischen und sozialen Konstellationen seiner Zeit und seines kleinen Vaterlandes genügen dazu vollauf. Und wenn Goethe recht hat, dass das höchste Glück der Erdenkinder die Persönlichkeit ist, so darf sich dieses Geschlecht sogar ein begünstigtes nennen, denn es hat zu allen Zeiten starke Persönlichkeiten hervorgebracht. Ich will von der späteren Generation, neben dem Dichter selbst, nur seinen Lieblingsvetter, den eidgenössischen Obersten und Präsidenten des Berner Grossrats, Albert Kurtz nennen, von dem er uns Kindern gern das kühne Stück erzählte, dass dieser, als einst in Bern ein Engländer sich in angetrunkenem Zustand in den städtischen Bärenzwinger hinabgelassen hatte, den Unseligen mit eigener höchster Lebensgefahr der fürchterlichen Gesellschaft entriss, freilich schon zerfleischt und als Leiche.
War die Stellung zum Vater eine schwierige, so stand der Knabe seiner Mutter um so inniger nahe. Sie war eine Tochter des aus westfälischer Familie stammenden akademischen Buchdruckerherrn Schramm aus Tübingen, eine zarte, stille, sinnige Natur, von der nach den Aufzeichnungen des jüngeren Sohnes der Dichter die feine Auffassung menschlichen Wesens und Treibens und die Milde des Charakters geerbt hat, während der poetische Sinn vom Vater stammen soll. Ob sich das letztere so ohne weiteres behaupten lässt, möchte ich jedoch bezweifeln. Dass mein Grossvater dem fantasievollen Knaben die Romane, die dieser wirr durcheinander las, aus den Händen nahm oder vielmehr riss und ihm dafür Reisebeschreibungen und dergleichen unterschob, zeugt zwar von pädagogischer Weisheit und von gutem Geschmack, und dass er den Aberglauben in jeder Gestalt verfolgte, macht seinem Verstand Ehre; dass er aber den Rationalismus so weit trieb, auch mit den alten »Volksbüchern« in Fehde zu liegen, spricht gerade nicht für poetischen Sinn. Dass das eigentlich Poetische dennoch von Seiten der Schwertmagen stammt, glaube ich aber gerne, denn die Pfarrerin Kenngott, bekannt unter dem Namen der »Frau Dote«, des Kaufmanns David Kurtz älteste Schwester, die die zweite Erzieherin des Dichters wurde, war selbst ein lebendiges Historienbuch und besass daneben eine so grosse Fantasie, dass dieser ihr im »Witwenstübchen« sagen konnte: »Ich weiss, wie schnell du ein Märchen zusammenbringst, wenn man eins von dir haben will.« Von dieser köstlich frischen, temperamentvollen Frau mit der unversiegbaren Laune und dem drastischen Mutterwitz, deren Wesen, freilich in viel engerem Rahmen und unter viel bescheideneren Formen, mannigfach an die berühmte »Frau Rat« erinnert, ist augenscheinlich die Lust am Fabulieren in die Familie gekommen und der Humor, der die Welt überwindet. Dagegen ist der sichere psychologische Instinkt, der sich oft in den Briefen der Mutter Kurtz ausspricht, dem Romandichter als schätzbares Kunkellehen zugefallen. Hinter der kraftvollen Silhouette der Frau Dote tritt freilich die Mutter des Dichters mit ihren zarten, fast hingehauchten Linien etwas zurück, aber eine unbedeutende Frau ist sie darum keineswegs gewesen. Bei aller Zartheit zeigen ihre Briefe eine grosse Selbstständigkeit des Denkens, so besonders, wenn sie ihren Hermann wiederholt ermahnt, sich auch der neueren Sprachen zu befleissigen, da er sie einmal nötig haben könne, und vor allem den Widerwillen gegen das Französische zu überwinden, das nun einmal Weltsprache sei. So weit dachte niemand in ihrer Umgebung. Auch ein empfindliches ästhetisches Gefühl ist ihr eigen: einmal prasselt sie in helle Entrüstung auf, als der ebenso fein geartete Sohn sich vorübergehend in einer roheren Ausdrucksweise gefällt, womit die Kameraden ihn angesteckt haben, und vom Klarinettblasen rät sie ihm ab aus demselben Grunde, weshalb einst Alkibiades die Flöte verwarf.
Beide Söhne haben die Frühverstorbene als ein stilles, rührendes Heiligenbild verehrt; von ihr wurde in der Familie auch der aristokratische Zug in der Natur des Dichters abgeleitet. Sie hatte eine für ihre Zeit und ihren Stand durchaus nicht gewöhnliche Bildung und schrieb mit fliessender gleichmässiger Hand – im Gegensatz zu den seltsamen Kratzfüssen und dem fossilen »Gotisch« der Frau Dote – ein modernes, fast reines Deutsch. Auch ihre jüngere Schwester, die im Jahre 1863 verstorbene Pfarrerin Mohr, von der noch eine Erinnerung wie ein blasser Schein in meine eigenen Kinderjahre fällt, hob sich durch ein feineres und vornehmeres Wesen von ihrer Umgebung ab, soll jedoch der Schwester nicht gleichgekommen sein. Von diesen Jugendeindrücken schreibt sich jedenfalls des Dichters Vorliebe für zarte weibliche Naturen her, die in gedrückten Verhältnissen ihren angeborenen Adel bewahren. Solche spürte er im Leben gerne auf und hat ihren Typus auch im »Weihnachtsfund« in der sanften und fast seherisch tief blickenden Gestalt der Schusterin gezeichnet, die zwischen den derben Figuren der Umgebung hervorschimmert wie eine in grobes Gestein eingesprengte Goldader. Trotz der geringen Sorgfalt, die damals auf die Mädchenerziehung verwendet wurde, hatte der civis academicus Schramm erklärt, dass jede seiner sechs Töchter etwas lernen dürfe, entweder Malen oder Musik; meine Grossmutter mit zwei andern Schwestern hatte das Malen gewählt, was ihr denn als Witwe, freilich in bescheidenster Form, zugute kommen sollte, da sie durch Anmalen von Bilderbogen (zu zwei Kreuzern pro Stück!) einen kleinen Zuschuss erwarb, wobei ihr der jüngere Sohn Ernst, wenn er die Schulaufgaben fertig hatte, des Abends noch ein paar Stunden behilflich war. Es gibt ein rührendes, altväterisches Familienbild, sich die beiden, Mutter und Sohn, bei der Öllampe oder dem Talglicht über ihren Bilderbogen zu denken, wie sie mühsam ein paar Kreuzer zusammenverdienen, das Taschengeld für den begabten Ältesten, der damals schon als Zögling in der Maulbronner Klosterschule sich auf das theologische Studium vorbereitete.
Der Dichter charakterisiert das Wesen seiner Mutter in wenig Worten, indem er sagt, dass sie alle Eigenschaften zur Führerin des heranwachsenden Jünglings gehabt hätte, dass es ihr aber bei ihrer Milde und Sanftmut gänzlich an der Schneide gebrach, die einem Knaben gegenüber erforderlich ist. Deshalb rief die Witwe in schwierigen Fällen, wo die mütterliche Autorität nicht ausreichte, die im Nachbarhause wohnende Schwägerin Kenngott zuhilfe, die das Regieren von Grund aus verstand. Mit welch anmutiger Überlegenheit die alte Frau dabei zuwege ging, ist im »Witwenstüblein« zierlich dargestellt. Des Autors ausführliche Schilderung seiner Schulnöte und wie schalkhaft klug die Frau Dote als strickende Muse seinen lateinischen Pegasus zum Wettlauf anfeuerte, hatte Heyse in seiner Ausgabe der Gesammelten Werke aus künstlerischen Gründen geopfert, und es hätte vielleicht dabei sein Bewenden haben dürfen, weil die Hauptgeschichte, von diesem Gestrüppe befreit, sich wirksamer abhebt. Fischer hat die gestrichenen Stellen und damit die etwas beschnittene Gestalt der Frau Dote wieder ergänzt; was die Kunst dabei verliert, hat die Autobiografie gewonnen. Vielleicht ist dieses Kapitel auch kulturgeschichtlich nicht ganz unwichtig; es zeigt, wie sauer unsern Vätern der Weg zur Schule gemacht wurde und was die gute alte Zeit, aus der Nähe gesehen, für ein knochenhartes Gesicht hat. Mit Grausen erinnere ich mich gewisser Massenexekutionen in der Schule, von denen mein Vater in der Erinnerung selbst noch grausend erzählte.
In dem halb klösterlich, halb militärisch eingerichteten Seminar dauerte die strenge Zucht, wenn auch natürlich ohne körperliche Strafen, fort; wie ihr der Jugendübermut an allen Ecken und Enden Schnippchen schlug, ist in den »Jugenderinnerungen« ergötzlich zu lesen. Noch ausführlicher hat der Dichter das Maulbronner Treiben in dem früheren Schluss der »beiden Tubus« dargestellt. Manche der dort eingeflochtenen Anekdoten habe ich ihn als selbsterlebte erzählen hören, wie überhaupt in allen seinen Schriften, den einzigen »Sonnenwirt« vielleicht ausgenommen, ein gut Stück Autobiografie verwoben ist.
Ein frischer, geistig angeregter Zug ging durch die ganze Promotion,2 der Hermann Kurz angehörte, und die weltabgeschiedene Lage des alten schönen Klosters inmitten tiefdunkler Wälder, seine herrlichen, damals etwas verfallenen Bauformen, regten den Hang zur Poesie und Romantik mächtig auf. Nicht nur zu solchen nächtlichen Abenteuern wie den Kletterpartien über die Dächer und der Entdeckung des berüchtigten Blutflecks an der Mauer in Dr. Fausti Gemach (zu welchem Fund jedoch Mutter Kurtz ketzerisch bemerkte: »Ich glaub’s gewiss nicht, dass den Faust der Teufel geholt hat«) taten sich die Kameraden heimlich zusammen; man pflegte auch ganz in der Stille ideale Interessen, die im Seminar als Allotria verpönt waren, und mancher, der später ein zahmer Philister werden sollte, hat damals munter seinen Pegasus mitgetummelt. Da wurde ein »Maulbronner Musenalmanach« geführt, zu dem die mehr oder minder begabten Mitarbeiter ihr Bestes an Poesie oder Witz beigesteuert haben. Von den darin verewigten Namen ist nur der des »Primus« Eduard Zeller, des nachmaligen Berliner Philosophieprofessors, der Öffentlichkeit bekannt geworden. An denselben Zeller ist ein launiges Gedicht meines Vaters gerichtet, worin sich die Strophe findet:
»Zeller, lieber Zeller, sage, Was ich in dem Herzen trage, Denn die Philosophen können Alles was es gibt benennen.«
Beweis, dass jeder von den beiden Siebzehnjährigen seinen künftigen Beruf vorausgenommen hatte. Der Almanach ist zwar von meines Vaters Hand geschrieben, aber die Kinder seiner eigenen Muse enthält er nicht; diese, die neben den dilettantischen Versuchen der andern schon die Löwenkralle zeigen, stehen in einem besonderen Heft; darunter sogar einige seiner besten lyrischen Sachen neben andrem ganz unreifem, wie es dem Alter des Verfassers entsprach. Aus seinem späteren rückblickenden Gedichte »Maulbronn« sieht man, welcher Vorfrühling diese zeitigen Blüten herausgelockt hat.
»Aber nachts, wenn alle schliefen, wacht’ ich bei der Lampe Licht Forschend in des Lebens Tiefen, denn die Ruhe kannt’ ich nicht. Doch es kam ein Frühgewitter über meinen Lebenstraum, Und ein Doppelregenbogen stand an meines Himmels Saum. Lieb und Freundschaft, wie erhellten sie mein dunkles Herz zugleich! Wie mit Leid und Freude machten sie mein armes Leben reich! Und in manchem leisen Liede löst’ ich dunklen Herzensdrang, Das in scheuen Tönen zwischen fernem Waldgebüsch verklang. –«
(Hier fanden sich in der ersten Ausgabe der Gedichte von 1836 die Zeilen: Wenn ich denke, wie als Gast ich weilt’ in ihrem lichten Haus, Sprech’ ich beide seufzend immer noch mit Einem Namen aus. Das lichte Haus der Liebe und Freundschaft war – die hellgelb angestrichene Apotheke von Vaihingen.)