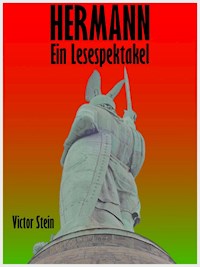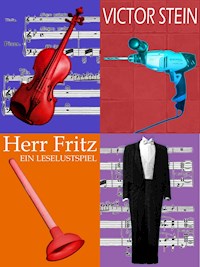
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Klaus Fritz ist Geiger. Doch muss das städtische Orchester, zu dessen Konzertmeister er es gebracht hat, windigen Ausstellungsprojekten weichen. Der Konzertmeister mutiert zum Schulhausmeister. Trotz der widrigen Umstände beweist Klaus Fritz Lebensart. Seine Autorität in Sachen Espresso ist unanfechtbar. Zwar reizen die nach gegenwärtigen Begriffen nicht hinnehmbaren Einlassungen des alternden weißen, zudem offenkundig heterosexuellen Künstler-Haustechnikers zum Widerspruch. Kaum geringer aber wiegt seine Humanität vor dem Hintergrund kulturpolitischer Rankünen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VICTOR STEIN
HERR FRITZ
ODER
DER GEIGER ALS HAUSMEISTER
LESELUSTSPIEL
ÜBER
EINEN ALTERNDEN WEISSEN UND HETEROSEXUELLEN MANN
Victor Stein
hat Germanistik, Kunstgeschichte und Klassische Archäologie studiert. Seine zahlreichen Veröffentlichungen finden sich in renommierten Print- und Onlinemedien
Mehr von und über Victor Stein: https://musik-theater-buch.de
Herr Fritz oder Der Geiger als Hausmeister. Leselustspiel über einen alternden weißen und heterosexuellen Mann.
ISBN 978-3-754103-32-6
© 2021 Victor Stein
c/o Christine Naumann-Kraak
Lange Straße 4
33790 Halle (Westfalen)
Alle Rechte vorbehalten.
Jede öffentliche Vervielfältigung und Verbreitung dieses Werks oder seiner Teile bedürfen unabhängig von technischem Verfahren und Medium der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Autors. Ebenso Aufführung, Vortrag oder Verfilmung.
Für entsprechende Anfragen steht folgender E-Mail-Kontakt zur Verfügung:
HERR FRITZ
ODER
DER GEIGER ALS HAUSMEISTER
LESELUSTSPIEL
ÜBER
EINEN ALTERNDEN WEISSEN UND HETEROSEXUELLEN MANN
Gewidmet ist das Stück
Klaus Fritz,
dem die Titelfigur in
vielem ähnlich ist,
in manchem kaum.
Dank Dir, Klaus!
PERSONEN
KLAUS FRITZ
INTENDANT
MUSIKDIREKTOR
OBERBÜRGERMEISTER
KULTURDEZERNENTINHANS
DER KLARINETTIST/GRETE
Eine mittlere Großstadt im tiefen Westdeutschland zu Beginn der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts und im ersten Jahrzehnt des einundzwanzigsten
I
1
(Hausmeisterloge. Das Fenster ist zum Verkaufsschalter umgebaut, ein Teil des Raumes ist als Kiosk ausgestattet.)
KLAUS FRITZ: Ich war Konzertmeister des städtischen Symphonieorchesters. Jetzt bin ich Hausmeister. An einer Schule. Schulhausmeister. Haustechniker, wie die amtliche Bezeichnung für diese Tätigkeit heißt, die nach keinerlei zertifizierter Ausbildung verlangt, ein Anlernberuf mithin, dessen Anforderungsprofil weder Meister- noch Gesellenbrief fordert, sondern lediglich handwerkliches Geschick. Wo immer man es auch erworben hat. – In wenigen Wochen gehe ich in den Ruhestand. Dreizehn Jahre werde ich dann Hausmeister gewesen sein. Mit gutem Erfolg und etlicher Freude. Ich werde hier geschätzt und anerkannt. Weil ich im Hausmeisterberuf Beachtliches leiste. Mich vorausschauend, findig und hilfsbereit zeige. Aber auch, weil man hier meine Lebensgeschichte kennt; das eine oder andere Mitglied des Kollegiums mich sogar noch im Orchester erlebt hat. Ich war Konzertmeister. Jetzt bin ich Hausmeister. Schulhausmeister. Wenigstens hat das Wort einigen Klang, einen besseren jedenfalls als >Schulhaustechniker<. (Das Mobiltelefon klingelt. Klaus Fritz spricht in den Apparat.) Ich komme herüber. (Wieder zum Publikum.) Einen Moment bitte, ich bin gleich zurück. (Ab.)
2
(Büro des Oberbürgermeisters.)
OBERBÜRGERMEISTER: (Zum Musikdirektor.) Du meine Güte, Sie sind ein Glücksfall für diese Stadt. Sie holen aus dem städtischen Orchester heraus, was nur möglich ist. Aber nicht nur ich frage mich schon seit einiger Zeit, ob Sie sich auf Dauer mit allenfalls mittelmäßigen Musikern zufriedengeben dürfen. Mein Bester, Sie sind doch heillos unterfordert. Es wundert mich ohnehin, wie lange Sie schon bei uns aushalten. Renommierte Klangkörper warten auf Sie. Nur müssen Sie sich einmal von hier lösen.
MUSIKDIREKTOR: Ich bin gern Chefdirigent in dieser Stadt. Die Musiker geben ihr Bestes. Das Publikum ist begeisterungsfähig. Sicher ist das Orchester klein. Es zählt so wenige Planstellen, dass in den Konzerten und Opernproduktionen jeder einzelne Musiker den Offenbarungseid leistet. Alle müssen völlig auf der Höhe sein. Bei größeren Orchestern ist das anders. Dort bewirkt bereits die schiere Zahl den fülligen Klang. Wenn bei denen einmal jemand nicht ganz in Form ist, schließt das ein akzeptables Resultat nicht aus. Doch gleicht, so wie sich meine Musiker allabendlich ins Zeug legen, das Symphonieorchester unserer Stadt in seinem Ethos und Gemüt einem Kammermusikensemble. Obschon die Bezahlung deutlich unter der größerer Klangkörper rangiert. Die Stadt beschäftigt hochqualifizierte Musiker zu bescheidenem Tarif. Unsere Besucherzahlen beweisen, wie sehr die Kommune davon profitiert.
KULTURDEZERNENTIN: Die Verve, mit der Sie sich für Ihre Leute einsetzen, ist eines. Wo aber, so müssen Politik und Verwaltung fragen, liegt der Mehrwert, den das Orchester für die Stadt erwirtschaftet? Wir sind unseren Nachbarkommunen an Einwohnern und finanzieller Ausstattung unterlegen. Der Ruf der Philharmoniker und Symphoniker, die dem Kulturleben der Städte, mit denen wir zu konkurrieren gezwungen sind, Glanzlichter aufstecken, geht über die Region hinaus; er wurzelt traditionell im städtischen Leben und der medialen Aufmerksamkeit. Seit einem Jahrhundert werden nur knappe drei Dutzend Kilometer von hier Meisterwerke von Reger und Mahler, Opern von Henze und Glass uraufgeführt. Wiederholt wurden die nachbarlichen Philharmoniker von Kritikern auf vorderste Ränge gewählt. Wir können da nicht mithalten. Nicht finanziell, nicht qualitativ. Wir benötigen die Geldmittel, die wir bislang für das städtische Orchester und das Theater aufwandten, um uns in anderer Weise kulturell zu profilieren. Das Schlüsselwort heißt Alleinstellungsmerkmal. Ihre Leute leisten dazu keinen Beitrag.
3
(Hausmeisterloge.)
KLAUS FRITZ: Für die kurze Unterbrechung bitte ich um Nachsicht. Zumal es sich um eine Bagatelle handelte. Die Sache war im Handumdrehen erledigt. Der Abfluss eines Waschbeckens in den Schülertoiletten war undicht. Ich verfüge über einen schier unerschöpflichen Vorrat an Dichtungsringen und anderen Ersatzteilen. Klempnerarbeiten wie diese sind also eine Kleinigkeit für mich. Etwas, das mich richtig hätte tüfteln lassen, wäre mir lieber gewesen. Ich bin erfinderisch. Dabei gänzlich lösungsorientiert. Ich gestehe aufrichtig, meiner Art technische Probleme zu beheben eignet unter dem Gesichtspunkt des zunftmäßigen Handwerkers oft etwas Zweifelhaftes, ja Bedenkliches, Unkonventionelles eben. Das nicht selten leicht improvisiert wirkt. Aber zu meiner eigenen Überraschung sind die Reparaturen, die ich ausführe, oft dauerhafter als die von Hand der Fachleute. Jedenfalls erspare ich dem kommunalen Arbeitgeber stattliche Beträge, während die meisten anderen Hausmeister, sobald nur das geringste Problem auftaucht, Fachbetriebe rufen. Auf Kosten des Steuerzahlers. Ich aber bin froh, wenn ich Gelegenheit erhalte, mich handwerklich und technisch zu bewähren. Die Tüftelei hat für mich etwas von Musik. Wenn ich nach einer überraschenden Lösung für ein Problem handwerklicher oder technischer Ursache fahnde, ist das, als ob ich ein vorgegebenes musikalisches Thema variiere. Soeben spielte ich das Thema "defekter Dichtungsring" durch. Wie gesagt, in diesem Fall keine sonderlich anspruchsvolle Aufgabe, aber es gibt glücklicherweise für mich eine Menge Anlässe, die reizvoller sind, um meine Geschicklichkeit zu beweisen.
4
(Büro des Oberbürgermeisters.)
INTENDANT: Sie reden von der Liquidation des Orchesters und meinen Oper, Sprechtheater und Ballett gleich mit. Sie stoßen Schauspieler, Sänger, Musiker, Choristen und Tänzer zur Tür hinaus. Auf die Straße. Zu schweigen von mir und den anderen künstlerischen Vorständen. Für die ich keine Sorge habe. Denn wir sind allesamt umworben. Aber bei den Kollektiven und - wenn sie sich in fortgeschrittenen Jahren befinden - auch den Solisten sieht es völlig anders aus.
OBERBÜRGERMEISTER: Die Abwicklung von Orchester und Stadttheater ist ohne Alternative. Die Leute sind durch die elektronischen Medien verwöhnt. Sie verlangen Höchstleistungen, dargeboten von Spitzenorchestern und Sängern mit internationalem Ruf; Schauspielern, die das Publikum aus Kino und Fernsehen kennt. Vor Ort sollten mindestens Annäherungswerte erreicht werden. Was den Instituten der Nachbarstädte gelingt. Doch solche Ambitionen kosten. Wir können den dazu erforderlichen Aufwand nicht leisten. Und sind deshalb einfach nicht konkurrenzfähig. Meine Güte, wenn ich in der Oper bin, möchte ich nichts als die schönen Melodien hören. Im Schauspiel die Sentenzen aus dem Faust, die ich seit Schülertagen auswendig weiß. Ich selbst habe keine großen Ansprüche. Aber das verwöhnte Publikum. Genauso wenig, wie dem ein einfach nur solider Politiker genügt, gibt es sich mit einem bloß achtbaren Konzert oder einer passablen Opern- oder Schauspielproduktion zufrieden. Man kann diese bei weitem überzogene Erwartungshaltung bedauern, ändern kann man sie nicht.
MUSIKDIREKTOR: Unser Orchester, unser Musiktheater- und Schauspielensemble sind profiliert und qualitativ auf einer Höhe, die man bei den finanziellen Einschränkungen, denen wir unterworfen sind, nicht erwarten dürfte. Unsere Konzertprogramme und Theaterspielpläne kombinieren attraktiv die Dauerbrenner – Beethovens Fünfte, Bizets Carmen, Die Räuber – mit reizvoll Unbekanntem. Die Nationaloper unseres Nachbarlandes – hinreißende Musik -, wer in der Region kannte sie? Wir haben sie ins Programm genommen. Die Vorstellungen waren ausverkauft, die Leute hingerissen.
INTENDANT: Wir produzieren das, wozu den Großbühnen der Nachbarstädte der Mut fehlt. Deshalb strömen zahlreiche Besucher von auswärts ins Haus. Denken Sie daran, wie konsequent wir neue Stücke herausbringen.
MUSIKDIREKTOR: Ich bin fest davon überzeugt, unser Publikum erwartet weder ein metropolitanes Orchester noch entsprechende Sänger, noch Schauspieler, die regelmäßig in Film und Fernsehen auftauchen. Die Leute, die in unsere Vorstellungen kommen, wünschen sich einen ergreifenden Opernabend oder eine packende Produktion im Sprechtheater. Die wir ihnen bei allen Unzulänglichkeiten – kleines Orchester, kleiner Chor, kleine Solistenensembles, geringer Ausstattungsetat – auch bieten. Ich erinnere noch einmal an unsere hervorragende Platzauslastung.
OBERBÜRGERMEISTER: Zuschauerumfragen belegen das hohe Durchschnittsalter des Publikums. Wir drehen uns ein wenig im Kreis, wenn ich betone, dass die jüngeren Leute in die Nachbarstädte fahren. Oder gleich in die Landeshauptstadt. Die jungen Leute sind mobil und flexibel. Das hiesige Stammpublikum, überaltert wie es ist, stirbt aus. Dass Sie mit Raritäten und Exotischem die verschwindende Minderheit irgendwelcher Enthusiasten und Intellektuellen von auswärts ansprechen, bestreite ich nicht. Aber die Resonanz des großen Publikums bricht weg.
KULTURDEZERNENTIN: Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Orchester und Stadttheater, beide sind Billiganbieter. Sie operieren im bescheidensten Marktsegment. Die Eintrittspreise unterbieten die potenteren Mitbewerber hemmungslos. Wer von auswärts kommt, der nimmt die Aufführung samt unserer Subventionen – das sind die Steuergelder der Bürger unserer Stadt – unverbindlich einmal mit. Ohne Gegenleistung. Soll heißen, ohne für die örtliche Wirtschaft nennenswerten Ertrag. Die viel gepriesene Umwegrendite von kulturellen Einrichtungen, also das, was diese etwa dem Gastgewerbe und dem örtlichen Handel an Einnahmen zuspielen, tendiert im konkreten Fall gegen null.
OBERBÜRGERMEISTER: Um die Qualität der Produktionen zu steigern, braucht es höhere Eintrittspreise. Aber für deren Anhebung steht unsere Bürgerschaft wirtschaftlich auf zu schwachen Füßen. Und das externe Publikum ist ein zu unsicherer Faktor. Ich gehe davon aus, es wird, wenn das Reizvolle, das jeder Exotismus zunächst mit sich bringt, abklingt, fragen, ob der künstlerische Rang der Produktionen die Anfahrt rechtfertigt.
MUSIKDIREKTOR: Ist Ihnen klar, welches Urteil Sie über unsere Arbeit fällen?
OBERBÜRGERMEISTER: Meine Herren, begreifen Sie doch, ich attackiere nicht Sie persönlich. Wenngleich Sie das in der emotionalen Anspannung des Augenblicks jetzt anders empfinden werden. Ich rede von drückendsten Sachzwängen, die unsere Stadt knechten. Denen auch ich frone.
INTENDANT: Sie schätzen unsere Arbeit sträflich gering. Leicht lässt sich zerstören, wieder aufbauen desto schwerer.
KULTURDEZERNENTIN: Wir bauen auf. An anderer Stelle. Das ist einmal sicher.
5
(Hausmeisterloge.)
KLAUS FRITZ: Mein Vater war akademischer Maler und Gymnasiallehrer. Seine Bilder hängen in nicht wenigen Museen des deutschen Nordens. Mein Bruder ist Arzt, Internist. Regelmäßig erteilt er im Fernsehen einem Millionenpublikum medizinische Ratschläge. Ich war Konzertmeister. Jetzt bin ich Hausmeister. Berufung? Die hatte ich. Überleben? Musste ich. Der Ruhestand? Ist ersehnt. – Schwamm über meine eigene Schullaufbahn. Lernen interessierte mich allein, wenn die Geige im Spiel war. Ich war spät dran. Begann erst mit vierzehn. Um auf dem Instrument Professionalität zu erreichen, nahezu im Greisenalter. Tag und Nacht übte ich, um die Aufnahmeprüfung an der Staatsmusikschule zu bestehen. Gezielt studierte ich nur ein, wovon ich wusste, es würde die Aufnahmekommission beeindrucken. Ich blendete. Ich wurde immatrikuliert. Begabung und Können schienen mir in ungewöhnlichem Maß zu eigen. Als dann bald nachdem ich mein Studium aufgenommen hatte, ruchbar wurde, wie es tatsächlich um meine Kenntnisse und Fertigkeiten bestellt war, rief das – gelinde gesagt – Entsetzen hervor. Aber ich war fleißig, zeigte Beharrungsvermögen, arbeitete zielführend, bewies dann doch, wozu ich taugte, so dass meine Lehrer das, was ihnen anfänglich als peinliche und möglichst zu vertuschende Fehlentscheidung gegolten hatte, letztlich nicht zu bereuen hatten. Ich schloss das Studium mit einem mehr als achtbaren Examen ab. (Blickt ins Publikum, als erwarte er Anerkennung.)