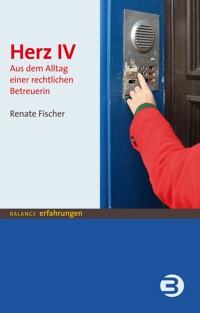
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BALANCE Buch + Medien Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: BALANCE erfahrungen
- Sprache: Deutsch
»Was arbeiten Sie denn?« »Ich hab keine Arbeit, ich krieg Herz Vier.« »Wie, Herz Vier?« »Arbeitslosenherz Vier - kennen’se dat nich?« Dass die Gesellschaft ein »Herz für Arbeitslose« hat oder dass Sozialleistungen von Herzen kommen, ist eine schöne Vorstellung - die Realität sieht oft anders aus. Renate Fischer wird als rechtliche Betreuerin täglich neu mit einer »Parallelwelt« konfrontiert, in der sie sich um geistig Behinderte, alt gewordene, psychisch kranke oder andere Menschen kümmert, die allein im Alltag nicht zurechtkommen. Sie hat es dabei mit teils sturen und teils kooperativen Behörden, aber auch genauso eigenwilligen Klientinnen und Klienten zu tun. Gerade die zuweilen unkonventionellen Problemlösungen auf allen Seiten machen den Charme dieser Geschichten aus, erzählt mit klarem Blick, Herz und Humor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Renate Fischer
Herz IV
Aus dem Alltag einerrechtlichen Betreuerin
Renate Fischer: Herz IV.
Aus dem Alltag einer rechtlichen Betreuerin
2. Auflage 2012
© BALANCE buch + medien verlag, Köln 2011
Der BALANCE buch + medien verlag ist ein Imprint der Psychiatrie Verlag GmbH, Köln.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlages vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
ISBN-ePub: 978-3-86739-844-2
ISBN-Print: 978-3-86739-061-3
ISBN-PDF: 978-3-86739-744-5
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Lektorat: Cornelia Schäfer, Köln
Umschlagkonzeption: GRAFIKSCHMITZ Kommunikation-Design, Köln, unter Verwendung eines Fotos von Kelly
Typografiekonzept: Iga Bielejec, Nierstein
Satz: BALANCE buch + medien verlag, Köln
www.balance-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Impressum
Und das ist es schließlich, was mich berührt: dass wir immer einfache Leute waren. Immer so viel Scheitern, immer diese rührende Unbeholfenheit, immer aber dieses unbeirrte Bemühen, das ich so häufig bei anderen nicht fand.
kid37, Das hermetische Cafe
Wie dieses Buch entstand
»Was arbeiten Sie denn?«
»Ich hab keine Arbeit, ich krieg Herz Vier.«
»Wie, Herz Vier?«
»Arbeitslosenherz Vier – kennen Se dat nich?«
Die Frau, die mir diesen kleinen Dialog lieferte, meinte das nicht als Witz. Sie ist der Auffassung, dass ihre Sozialleistungen wirklich so heißen. In der Begrifflichkeit schwingt etwas von der Vorstellung mit, dass die Gesellschaft ein »Herz für Arbeitslose« hat oder dass Sozialleistungen von Herzen kommen. Tatsächlich ist die sogenannte Hartz-IV-Reform nach Peter Hartz benannt, einem Manager, der wegen Untreue und Begünstigung in Millionenhöhe rechtskräftig verurteilt wurde. So absurd wie diese kleine Randnotiz ist mein Arbeitsalltag als rechtliche Betreuerin häufig.
Täglich habe ich mit Menschen zu tun, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Psychisch Kranke, geistig Behinderte, altersverwirrte Menschen. »Das ist sicher eine schwere Arbeit, das könnte ich nicht«, bekomme ich oft zu hören. »All das Elend in den Heimen, die Hoffnungslosigkeit, die Armut ... Wie halten Sie das aus?«, werde ich gefragt.
Schaue ich mir meinen Arbeitsalltag an, finde ich gar nicht so viel Schreckliches. Vieles ist kompliziert, mühsam und wie gesagt absurd, aber es sind weniger die Kranken und Behinderten, die an meinen Nerven zerren, als vielmehr ignorante Behördenmitarbeiter, geldgierige Angehörige, herzenskalte Ärzte, schamlose Kredithaie oder die unfassbar irrsinnige Bürokratie im sozialen Bereich. Die Begegnungen mit den betreuten Menschen sind zwar nicht immer einfach, aber oft geprägt von einer entwaffnenden Ehrlichkeit und einer guten Portion Humor. Interessanterweise ist auch der lautstärkste Psychiatriepatient, der mich gerade noch mit »So ’ne Scheiße lass ich mir von Ihnen nich bieten!« beschimpft hat, um Ausgleich bemüht: »Musse jetzt nich so angefressen gucken, Frau Fischer, isch mein dat ja nich so.«
Diplomatische Versuche dieser Art hat mir noch kein Mitarbeiter des Sozialamtes hinterhergeschickt, der mich wegen fehlender Unterlagen zusammengestaucht hat.
Bei meinen Hausbesuchen in den sozialen Randbezirken, in den Langzeitstationen der psychiatrischen Kliniken, bei den Verwirrten, den Analphabeten, den Trinkern, den Tagedieben, den verwahrlosten Teenagermüttern, den Leergutsammlern, den Pflegebedürftigen und den Einsamen begegnen mir Welten, die einem sonst weitgehend unbekannt bleiben. Diese Leute bleiben unter sich. Man muss nicht befürchten, mal privat in einen Haushalt eingeladen zu werden, in dem der Schimmel zentimeterdick an der Wand steht. Wo die Lebensmittel auf der Fensterbank gekühlt werden, weil kein Geld für einen Kühlschrank da ist. Wo es keinen Toilettensitz gibt und keine Kinderbetten, aber einen 32-Zoll-Flachbildschirm. Wo die Zigaretten das tägliche Brot sind. Wo die Idee einer regelmäßigen Erwerbsarbeit so exotisch ist wie ein Urlaub auf Hawaii.
Als Gast in diesen vier Wänden bekommt man eine Ahnung davon, dass das alles einen Grund, eine Geschichte hat. Und zwar nicht diese platte Kausalität »schwere Kindheit – keine Chancen – Krankheit – für immer draußen«. Oft habe ich erfahren müssen, dass für die Betroffenen die Anforderungen und besonders die Sprache und die Formulare der »fürsorglichen Gesellschaft« zu hoch, unentschlüsselbar, unüberwindlich sind. Da hat ein junger Albaner 250 Euro Schulden bei der GEZ, eine Kontopfändung steht ins Haus, weil er seit Jahren keine Rundfunk- und Fernsehgebühren bezahlt hat. Hätte er als Hartz-IV-Empfänger auch nicht gemusst. Einen Antrag auf Gebührenbefreiung hat er aber nie abgeschickt, weil er nicht wusste, was »beglaubigt« heißt (»Fügen Sie dem Antrag bitte eine beglaubigte Kopie des Bewilligungsbescheides SGB II bei«).
»Warum wehren die sich denn nicht?!«, fragen mich Freunde und Bekannte, denen ich von Behördenwillkür und Armut erzähle. Viele wehren sich, auch erfolgreich, aber ich möchte von denen berichten, die das nicht können. Weil diese ganz kleinen Leute damit rechnen, noch ein bisschen kleiner gemacht zu werden, als sie sich sowieso schon fühlen. Sie finden ihre eigene Unbeholfenheit, dieses Nicht-Verstehen, was man von ihnen erwartet, schlimmer als das Verhalten der Sachbearbeiter, die ihre Anträge ablehnen. Sie haben es nie gelernt, Erklärungen oder Hilfe offensiv einzufordern. Oder ihre Rechte wahrzunehmen. Stattdessen entwickeln sie merkwürdige, verschlungene Bewältigungsstrategien, um den Kopf über Wasser halten zu können.
Die alleinerziehende, psychisch kranke Mutter, die für ihre siebenjährige Tochter das Mittagessen in der offenen Ganztagsschule nicht bezahlen kann (2,70 Euro pro Tag), holt die Kleine jeden Tag zur Essenszeit ab, macht ihr zu Hause ein paar Schnitten Toastbrot mit Marmelade und bringt sie wieder zurück. Würde sie hartnäckig fragen, bekäme sie einen Zuschuss über den Förderverein oder die Stadt. Sie fragt aber nicht. Stattdessen erzählt sie ihrer Tochter, wie sehr sie sich freut, sie mittags bei sich zu haben. Erst als ich der Mutter erkläre, dass in ihrem Fall sogar die kompletten Kosten übernommen werden können und sie dankend einwilligt, wird auch dem Kind klar, welches Spiel hier gespielt wurde. Sie hatte ihre Tränen darüber, dass sie jeden Mittag den Tisch mit ihren fröhlichen Mitschülern verlassen musste, hinuntergeschluckt. Der Mama zuliebe.
Meine Arbeit als rechtliche Betreuerin führt mir aber nicht nur vor Augen, wie schwer es für viele ist, ihre sozialen Rechte durchzusetzen oder dann von 359 Euro im Monat zu leben. Es sind erstaunlich oft auch sehr lustige Geschichten, die ich tagtäglich mit Leuten erlebe, die in der öffentlichen Diskussion als Prekariat oder einfach als optische Zumutung beschrieben werden. Leute, die so gerne etwas von der Sicherheit und der sozialen Anerkennung hätten, die uns so selbstverständlich erscheinen. Deren Wunsch nach Normalität, nach Zugehörigkeit manchmal bizarre Formen annimmt: Eine Einbauküche ist eine große Stufe auf der sozialen Leiter nach oben. Notfalls baut man sich mit Holzresten etwas um die abgenutzten Elektrogeräte herum, das man dann stolz seine Einbauküche nennt. Und eine Tiefkühltruhe ist wichtig, um Vorräte anlegen zu können, auch wenn das Monstrum aus den 70er-Jahren monatlich für 40 Euro Strom frisst. Und ein Flachbildschirm, den man in 36 Monatsraten abstottern muss. Und ein neues Kommunionkleid für die Tochter, bloß kein gebrauchtes. Teures Markenfutter für die Katze, während die Kinder die billigste Wurst vom Discounter bekommen. Feuerwerk an Silvester, Frühstück in der Fußgängerzone, Dekorationsoverkill in der ärmlichen Wohnung.
Auch die Bedeutung von Statussymbolen ist in jeder sozialen Schicht gleich. Der eine kauft sich einen Mini Cooper mit Sonderlackierung als Zweitwagen, Herr Müller will mit einem riesigen Plastik-Adler auf dem Balkon nichts anderes demonstrieren: Ich bin wer. Wir können das Plastikvieh, dessen Augen im Dunkeln leuchten, ruhig geschmacklos finden, wir sind nicht gemeint mit dieser Botschaft. Zielgruppe sind alle anderen Nachbarn in der Siedlung und die Schmidts gegenüber. »Geiles Teil, wat, Frau Fischer!«, sagt Herr Müller stolz und fühlt dieses satte, gute Gefühl, das wir alle gut kennen: sich etwas Besonderes geleistet zu haben, das zu einem passt.
Mit den Geschichten und Begegnungen in diesem Buch versuche ich, meinen Klienten das entgegenzubringen, was sie fast nötiger brauchen als Geld. Sie alle hungern nach Anerkennung und Respekt. Sie sind sprachlos vor Erstaunen und Dankbarkeit, wenn man sie mal nicht kritisiert und herumschubst. Wenn man ihnen zuhört, ihren Kaffee nicht verschmäht, auch wenn die Tasse schmierig ist, ihre Katze streichelt, auch wenn sie Flöhe hat, und ihre Weihnachtsdekoration bewundert. Wenn man ihre Prioritäten akzeptiert und die große Angst hinter der lautstarken Attitüde ernst nimmt. Die Angst, der letzte Dreck zu sein und von der Welt verlassen zu werden.
Die Geschichten in diesem Buch basieren auf wahren Begebenheiten, sind aber nicht so passiert, wie sie hier zu lesen sind. Beschriebene Personen und Vorgänge sind nicht identisch mit lebenden oder toten Personen oder tatsächlichen Ereignissen. Ich habe die Situationen abgewandelt, Erfahrungen von verschiedenen Personen zusammengefasst sowie die Namen aller Personen geändert, um die Privatsphäre und Anonymität der Betroffenen zu schützen.
Renate Fischer
Tür zu
Sonja, die Tochter einer Freundin, studiert Sozialpädagogik und interessiert sich für die Arbeit als rechtliche Betreuerin. Da ich in meinem kleinen Arbeitszimmer keine Praktikantin unterbringen kann, biete ich ihr an, mich einfach mal einen Tag zu begleiten. Frohen Mutes steigt Sonja morgens zu mir ins Auto. Sie erzählt begeistert, wie viel Spaß ihr das Seminar »Klientenzentrierte Gesprächsführung« mache, wie interessant sie die Vorlesung über psychische Erkrankungen finde und dass es ihrer Meinung nach eine Frage von Geduld und Einfühlung sei, wenn man Zugang zu einem Menschen finden wolle.
Wir fahren zu Frau Siemes. Sie lebt allein in einem Mehrfamilienhaus, sie wird wegen einer bipolaren affektiven Störung betreut, hat immer Geldprobleme und ist häufig etwas unorganisiert. Ich hatte sie in der vergangenen Woche gefragt, ob ich jemanden mitbringen kann. Sie hatte nichts dagegen.
Wir klingeln, keiner macht auf. Ich klingele noch mal, keine Reaktion.
»Vielleicht hat sie den Termin vergessen«, schlägt Sonja vor. »Frau Siemes verlässt das Haus so gut wie nie. Sie müsste eigentlich da sein.«
»Warum macht sie dann nicht auf?«
»Vielleicht geht es ihr nicht gut. Ich will mal nicht hoffen, dass etwas Schlimmeres passiert ist.«
Blankes Entsetzen steht Sonja im Gesicht geschrieben. Ich ahne, dass eine ganze Bandbreite von Ohnmacht bis Suizid vor ihrem geistigen Auge erscheint. Sie hat an der Hochschule gelernt, wie man möglichst professionell ein zielorientiertes Gespräch mit einem psychisch kranken Menschen führt. Dass man allerdings schon an der Haustür scheitern kann, kam im Lehrplan nicht vor.
»Wir versuchen es erst mal bei den Nachbarn«, sage ich und drücke mit der Hand vier andere Klingelknöpfe gleichzeitig. Die Haustür springt sofort auf und ein Nachbar erkennt mich von früheren Besuchen.
»Die Schlampe von oben putzt nie die Treppe, wenn sie dran ist«, motzt er los.
»Guten Tag, Herr Neumann. Frau Siemes macht nicht auf. Wissen Sie, ob irgendwas mit ihr ist?«
»Keine Ahnung, aber wenn die am Samstag nicht die Treppe putzt, kipp ich der den ganzen Dreck vor die Tür.«
Wir gehen die Treppen hoch und klopfen laut an Frau Siemes’ Tür. Von drinnen hört man nichts, die Tür bleibt zu.
»Okay, was könnte passiert sein, was können wir tun?«, frage ich Sonja.
»Hat man als Betreuerin nicht einen Zweitschlüssel, mit dem man im Notfall reinkommt?«
»Nein, ich will und darf die Wohnung der Klienten nicht ohne deren Zustimmung betreten. Ich habe keinen Schlüssel.«
»Sollen wir die Polizei rufen?«
»Und dann? Was ist, wenn Frau Siemes nur mal kurz zu Aldi ist?«
»Aber sie könnte auch alle ihre Tabletten gleichzeitig genommen haben und jetzt halb tot auf dem Boden liegen.«
»So etwas kommt vor. Meistens hat man dann aber eine Ahnung. Wenn die Leute schon Tage vorher am Rad drehen, ständig anrufen, die Nachbarn tyrannisieren.«
»Und was macht man dann?«
»Dann ruft man tatsächlich die Polizei an und schildert seine Befürchtungen. Die Beamten entscheiden dann, ob sie die Tür öffnen lassen oder nicht.«
In dem Moment kommt der Nachbar Herr Neumann die Treppe hoch.
»Ich muss Ihnen noch was sagen: Die Siemes fliegt hier sowieso bald raus.«
»Herr Neumann, ich komm gleich noch mal zu Ihnen.«
»Gleich kann ich nicht. Ich will, dass Sie sich um den Lärm kümmern, den die Alte hier immer veranstaltet. Und wenn die Treppe bis Samstag nicht ...«
»Bitte«, unterbreche ich ihn, »das klären wir gleich.«
Sonja hat es vorgezogen, ihre klientenzentrierte Gesprächsführung nicht an Herrn Neumann zu testen. Sie klopft nochmals an die Tür und ruft zaghaft Frau Siemes’ Namen. Ich wähle unterdessen Frau Siemes’ Telefonnummer und nach langem Klingeln höre ich ihre verschlafene Stimme.
»Hallo, Frau Siemes, ich stehe vor Ihrer Tür!«
»Wer ist da?«
»Frau Fischer. Wir waren verabredet.«
»Nee, morgen.«
»Nee, heute.«
»Was ist heute?«
»Donnerstag.«
»Wann kommen Sie?«
»Ich muss nicht mehr kommen, ich bin schon da. Machen Sie mal die Tür auf!«
»Welche Tür?«
Ich betätige noch mal die Klingel.
»Moment, bleiben Sie dran«, sagt Frau Siemes, »ich muss mal aufmachen, es hat geklingelt.«
Die Überraschung ist groß, als sie uns sieht. Sie hatte offensichtlich verschlafen und muss jetzt erst mal Kaffee kochen. Sonja und ich bekommen auch eine Tasse. Gemeinsam schauen wir uns die Nebenkostenabrechnung des Vermieters an, in der Frau Siemes Fehler vermutet. Auf meine Bitte hin verspricht sie auch, in den kommenden Tagen mal über die Treppe zu putzen. Wir verabschieden uns und klingeln auf dem Weg noch mal bei Herrn Neumann. Da macht aber niemand auf.
»Und, schon was gelernt?«, frage ich Sonja.
»Ja, man muss auf alles gefasst sein.«
Halbmarathon
Die Betreuungsstelle fragt wegen eines Betreuerwechsels an. Der psychisch schwer gestörte und geistig behinderte Herr Gotthus hatte angedroht, den Hund seines rechtlichen Betreuers zu vergiften. Der Kollege will den Fall daher abgeben. Der Klient ist außerdem dafür bekannt, mit rücksichtsloser Gewalt auf Gegenstände, aber auch auf Personen loszugehen. Ich werde gebeten, den Herrn erst einmal kennenzulernen, um dann zu entscheiden, ob ich den Fall übernehme. Herr Gotthus hätte gerne eine Frau als Betreuerin. Selbstverständlich könnte ich bei dieser Vorgeschichte eine solche Fallübernahme auch ablehnen. Ich bin aber nicht nur zögerlich, sondern gleichzeitig auch ein bisschen neugierig und vereinbare einen Besuchstermin bei ihm.
Herr Gotthus lebt in einer kleinen Hütte neben einem Supermarkt. Strom und Heizung hat er dort, die räumliche Entfernung zu Nachbarn jeder Art ist aber durchaus gewollt. Als ich mit dem Auto ankomme, erwartet er mich bereits an der Straße. Es regnet in Strömen, er steht mit nassen Haaren, in schweren Arbeitsstiefeln und einem vom Regen durchtränkten Ledermantel auf dem Gehweg und schaut mich an. Er schaut mich an, ohne mit den Augen zu blinzeln, die kompletten dreißig Minuten, die ich bei ihm bin.
Seine Wohnung besteht aus einem Raum, der außer einem Bett, einem Kühlschrank und einigen Regalen nicht viele Möbel enthält, allerdings mindestens 50 Marienfiguren aus Plastik oder Gips in den kitschigsten Farben. Auf den zweiten Blick entdecke ich auch ein Sofa, das unter einem Berg von Teddybären in allen Größen verschüttet ist. Ich frage, ob ich mich setzen darf, Herr Gotthus sagt Ja, ohne mich aus den Augen zu lassen. Ich schiebe vier Bären beiseite und setze mich auf die dadurch frei gewordene Sofakante. Herr Gotthus ist offensichtlich sehr angespannt. Er presst seine Handflächen in einer Art betender Geste mit enormer Kraft zusammen. Seine Hände zittern stark.
»Ich will eigentlich keinen Betreuer mehr, ich kann alles alleine«, beginnt Herr Gotthus das Gespräch. »Ich gehe alleine zum Arzt und zur Sparkasse. Nur wenn ich in die Klinik komme, dann bräuchte ich jemanden, der mich da rausholt.«
»Warum kommen Sie denn in die Klinik?«
»Wenn ich was kaputt mache. Ich mache viel kaputt.«
»Ich kann Sie dann aber auch nicht rausholen, wenn die Ärzte dagegen sind.«
»Das weiß ich.«
»Wobei könnte ich Ihnen denn noch helfen?«
»Bei den Papieren vielleicht.«
»Wieso hat es mit Ihrem alten Betreuer nicht mehr geklappt? Haben Sie sich nicht verstanden?«
»Der hat mir meine Katze weggenommen. Da habe ich gesagt, ich bringe dem seinen Hund um.«
»Hätten Sie das getan?«
»Weiß ich nicht.«
»Und warum musste die Katze weg?«
»Weil ich die hier eingesperrt habe.«
Im Raum riecht es extrem nach Katzenpisse. Ich fürchte, dass das Gespräch keine gute Wendung nimmt. Herr Gotthus starrt mich an. Sein Gesicht zeigt kaum eine Gefühlsregung. Der gerade gefallene Begriff »eingesperrt« echot mir durch den Kopf. Ich bin allein mit Herrn Gotthus. Keiner könnte mich hören, wenn ich hier um Hilfe rufen würde. Mein Mobiltelefon liegt im Auto. Bevor ich mir überlegen kann, was ich als Nächstes sage, hat Herr Gotthus eine Frage an mich:
»Wie lange können Sie am Stück laufen?«
»Richtig laufen? Dauerlauf?«
»Ja.«
»Nicht lange, vielleicht zwanzig Minuten. Ich habe nicht so eine gute Kondition, ich sitze viel am Schreibtisch.«
»Ich kann 21 Kilometer laufen, ohne Pause. Halbmarathon.« »Wow ...!«
»Wollen Sie mal meine Urkunde sehen?«
»Ja, gerne.«
Herr Gotthus kramt in einem Karton und überreicht mir eine Teilnahme-Urkunde an einem Halbmarathon vom vergangenen Jahr. Ich bin beeindruckt. Und irgendwie bekomme ich das Gefühl, als habe sich die Situation entspannt. Herr Gotthus hat meiner Autorität etwas entgegengesetzt. Er kann etwas, was ich nicht kann. Wir sind quitt.
»Könnten Sie sich denn vorstellen, dass ich Ihre neue Betreuerin werde?«
»Ja.«
»Dann versuchen wir es mal miteinander, in Ordnung?«
»Ja, gut.«
»War nett bei Ihnen«, sage ich zum Abschluss.
»Ja?«, fragt er mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ja.«
Kaiserschnitt
Eine meiner jüngsten Klientinnen, Bianca Kreutz, gerade neunzehn Jahre alt, geistig behindert, ist schwanger. Sie wollte das Kind von Anfang an. Ich begleite sie zu allen wichtigen Arztterminen, auch zum Aufklärungsgespräch für die Geburt im Krankenhaus. Eine erfahrene, ruhige Ärztin erläutert Frau Kreutz, dass bei ihr ein Kaiserschnitt gemacht werden müsse, weil das Kind so im Mutterleib liege, dass es nicht durch eine natürliche Geburt auf die Welt kommen könne. Die Atmosphäre ist trotzdem entspannt, wir lachen viel, und der Geburtstermin wird für den nächsten Tag festgelegt.
Später am Abend klingelt dann das Telefon. Die Ärztin bittet dringend darum, dass ich mit Frau Kreutz spreche. Diese sei total aufgebracht und wolle sofort nach Hause. Sie reicht den Hörer an Frau Kreutz weiter.
»Frau Fischer, die wollen mir hier den Bauch aufschneiden!« »Ja aber, das haben wir doch am Nachmittag ausführlich besprochen, Bianca.«
»Nee, nich mit Bauchaufschneiden. Das is ja voll eklig!«
»Bianca, ein Kaiserschnitt ist immer mit Bauchaufschneiden«, versuche ich es ruhig.
»Nee, ich geh jetzt.«
Mir wird in dem Moment klar, dass die Ärztin und auch ich wahrscheinlich wirklich immer nur von Kaiserschnitt gesprochen haben, ohne tatsächlich zu erwähnen, um was es dabei geht. Alle Risiken und Eventualitäten (Verletzung innerer Organe, Infektion der Wunde etc.) können benannt werden, ohne deutlich und anschaulich zu beschreiben, dass einem der Bauch wie dem Wolf im Märchen von den sieben Geißlein aufgeschnitten wird. Ich will auch mal nicht ausschließen, dass die Ärztin und ich unterbewusst geahnt haben, dass Frau Kreutz das potenzielle Blutbad erschrecken würde und dass wir deshalb eine geschickte Vermeidungstaktik benutzt hatten.
Irgendwie bekommt die Ärztin es hin, Frau Kreutz doch noch zum Bleiben zu überreden. Sie hat die Idee, die werdende Mutter zu einer anderen Patientin zu bringen, die zwei Tage vorher per Kaiserschnitt entbunden hat. Diese Frau kann wohl vermitteln, dass die Prozedur nicht so schlimm ist.
Als ich am nächsten Tag ins Krankenhaus komme, sitzt Bianca Kreutz schon aufrecht im Bett und hat ihren kleinen Tobias im Arm. Sie ist erschöpft und glücklich und sehr, sehr stolz.
Eigensinn
Frau Kuhlmann ist fast achtzig, lebt in einem kleinen Häuschen. Es war den Nachbarn aufgefallen, dass sie nur sehr mühsam zu Fuß ihre Einkäufe nach Hause bekommt und etwas verwirrt scheint. Nach dem Besuch der Ärztin vom Gesundheitsamt und einem psychiatrischen Gutachten wird eine Betreuung angeregt und auch vom Gericht beschlossen.
Bei meinem ersten Besuch komme ich bis in den Flur, bevor mich Frau Kuhlmann hinauswirft. Der zweite Versuch führt mich immerhin bis ins Wohnzimmer. Mit Mühe entlocke ich Frau Kuhlmann, in welchen Bereichen sie Hilfe braucht: Sie hat Schulden bei der Bank, die sie nicht zurückzahlen kann, sie ist körperlich nicht mehr so beweglich und braucht Hilfe bei der Körperpflege, bei den Einkäufen und vor allem im Haushalt.
Als ich beim nächsten Mal einen netten Mann von einem ambulanten Pflegedienst mitbringe, wird er nach zwei Minuten von Frau Kuhlmann mit körperlicher Gewalt vor die Tür gesetzt, weil er durchblicken lässt, dass der Pflegedienst keine Gartenarbeiten übernehmen wird. »Waschen kann ich mich immer noch selbst! Ich brauche jemand, der im Garten klar Schiff macht! Versteht ihr Deppen das denn nicht!«, brüllt sie dem Pflegedienst hinterher. Meine Anwesenheit ist nach der Aktion auch nicht mehr erwünscht. »Gehen Sie, gehen Sie!«, ruft Frau Kuhlmann, um mich dann doch wieder zurückzupfeifen.
Ich sei doch mit dem Auto da, da könne ich doch ihre Pfandflaschen zum Supermarkt bringen. Als vertrauensbildende Maßnahme sage ich Ja – und bereue es nach einer halben Stunde bitter. Frau Kuhlmann schleppt Flasche für Flasche aus dunklen Räumen in den Flur und notiert auf einem Zeitungsrand akribisch den Pfandwert jeder einzelnen Flasche. Als mein Auto voll ist (es stinkt schrecklich), hält sie mir die Auflistung hin und fordert: »Rechnen Sie das mal aus!« Als ich sage, das könne ich ohne Taschenrechner nicht, übernimmt sie die Aufgabe schimpfend selbst und kommt auf 17 Euro 25 Cent. Ich muss ihr dies quittieren.
Beim nächsten Besuch zeigt sich Frau Kuhlmann sehr erfreut über das abgezählte Pfandgeld und einen Brief der Krankenkasse, der ihr (wie von mir beantragt) die Pflegestufe I bescheinigt. Da sie sich ja prima selbst pflegen könne, plane sie, das Geld für die Gartenpflege auszugeben, sagt sie. Sie bittet mich, einen Pflegedienst ausfindig zu machen, der sich mit Zier- und Nutzgärten auskennt, da sie gerne wieder Kartoffeln anpflanzen möchte. Mein »Das wird so nicht gehen« ignoriert sie: »Reden Sie nicht immer so einen Mist!«
Die Arbeit mit Frau Kuhlmann bleibt schwierig. Sie hat offensichtlich Schmerzen, kann sich kaum bewegen und bekommt nur schwer röchelnd Luft. Trotzdem lässt sie sich auf kein Hilfsangebot ein. Ein Pflegedienst, der den Garten nicht pflegt, kommt ihr nicht ins Haus, genauso wenig wie eine Haushaltshilfe oder ein Arzt. Stattdessen nötigt sie mich zum Schachspielen. Ich lasse mich ab und zu auf kurze Spiele ein, auch weil sie eine faszinierende Frau ist. Sie liest jeden Tag die Zeitung, indem sie jedes gelesene Wort sofort nach dem Lesen durchstreicht, und hat zu vielen politischen Themen eine präzise Meinung. Beim Schachspielen gewinnt sie jedes Mal.
Eines Tages ruft mich die Filiale der Krankenkasse an und berichtet mir, dass Frau Kuhlmann live und in Farbe dort stehe und lautstark einen Pflegedienst für ihren Garten verlange. Als Beleg dafür, dass sie zur Gartenarbeit nicht mehr fähig sei, habe sie fünfzehn Gläser mitgebracht, in denen sie über zwei Wochen ihren Hustenauswurf gesammelt habe. Ich erkläre mich für nicht zuständig und lege schnell den Hörer auf.
Als ich das nächste Mal zu ihr komme, hat sie das mit dem Garten selbst in die Hand genommen. Zwei kleine Beete sind umgegraben, und der relativ große zugewucherte Grünbereich ist mit merkwürdigen riesigen Plastiktüten übersäht. Es sieht aus, als seien gelbe Raumschiffe gelandet. Frau Kuhlmann, bester Laune, aber körperlich am Ende, lässt es sich nicht nehmen, mir ihre diesbezügliche Erfindung zu erklären: Über jede mehr als ein Meter hohe Unkrautpflanze hat sie einen gelben Plastiksack gestülpt, die Öffnung unten sorgfältig mit Erde abgedichtet und oben ein kleines Loch hineingeschnitten. Durch dieses Loch hat sie mittels Spraydosen ein hochgiftiges Unkrautvernichtungsmittel eingeführt. Lachend steht die höchstens ein Meter vierzig kleine Frau vor mir und ruft: »So geht das Gift bis in die Wurzeln!« Auf der Fensterbank stehen sieben Giftspraydosen, die sie ein Vermögen gekostet haben müssen.
Als wir an dem Tag die Wohnung betreten, hat sich auch dort das Projekt Garten breitgemacht: Überall sind alte Zeitungen ausgelegt, auf den Zeitungen ruhen Hunderte von frischen Walnüssen. »Zum Trocknen«, sagt Frau Kuhlmann. Wie sie die Nüsse vom Baum bekommen hat, ist mir schleierhaft. »Ich habe da so meine Methode«, sagt sie triumphierend.
Als ich mir immer größere Sorgen mache, versuche ich ihren Sohn zu finden, den Frau Kuhlmann zwar erwähnt, der sie aber anscheinend nie besucht. Über die Auskunft bekomme ich seine Nummer und werde am Telefon sofort von ihm beschimpft. Trotzdem willigt er ein, sich mit mir bei seiner Mutter zu treffen. Als er vorfährt, traue ich meinen Augen kaum: teurer Sportwagen mit ausländischem Kennzeichen, schwarzer Ledermantel, schicker Anzug. Beim Kaffee wird deutlich, dass er ein herzensguter Kerl ist, der sich auch Gedanken über die Zukunft seiner Mutter macht, aber bei ihr auf die gleiche Ablehnung stößt wie ich. Frau Kuhlmann genießt das Familientreffen sichtlich und drängt diesmal ihrem Sohn die Pfandflaschen auf. Er widerspricht nicht.
Wenige Wochen nach diesem Termin kommt vom Amtsgericht ein Beschluss über einen Betreuerwechsel. Der Sohn übernimmt auf eigenen Wunsch und mit Einwilligung der Mutter ab sofort die Betreuung. Wir machen eine kurze Übergabe und das war es dann.
Na ja, noch nicht ganz. Zwei Monate später ruft mich die Nachbarin von Frau Kuhlmann an, sie habe Frau Kuhlmann schon länger nicht mehr gesehen. Ich informiere den Sohn und erfahre später, dass Frau Kuhlmann allein in ihrem Haus verstorben ist.
Weil mich die Sache so beschäftigt und ich mir Vorwürfe mache, rufe ich die Pfarrerin an, die sich auch ab und zu bei Frau Kuhlmann hat sehen lassen. Sie hilft mir zu erkennen, dass es Frau Kuhlmann während meiner Betreuung nie so schlecht gegangen ist, dass ich sie hätte in einer geschlossenen Klinik unterbringen lassen müssen. Und Frau Kuhlmann hat genau das durchgesetzt, was ihr am Wichtigsten war: selbst über ihr Leben bestimmen können, koste es, was es wolle. Es war ihr vielleicht lieber, zu Hause in ihrer Unordnung zu sterben als in einem Krankenhaus. Gestorben wäre sie sowieso bald, sagt mir der Arzt, der sie obduziert hat.
Vorräte
Monatsanfang an der Supermarktkasse. Auch ich wundere mich oft, warum gerade offensichtlich arme Leute solche Mengen an Lebensmittel kaufen, dass sie vom Billigdiscounter nach Hause ein Taxi bestellen müssen. Und nie bringen sie gebrauchte Plastiktüten mit, immer werden neue gekauft, vier, fünf, sechs ...
Bei den Wohmanns konnte ich erleben, welche Bedeutung ein solcher Großeinkauf hat. Die fünfköpfige Familie hat häufig am Ende des Monats so wenig Geld übrig, dass es tagelang nur Nudeln gibt. Dieser existenzielle Mangel wird ausschließlich emotional wahrgenommen. Eine reflektierte Verknüpfung mit einer, wie die Pädagogen immer so gerne sagen, ressourcenorientierten Geldeinteilung ist Familie Wohmann nicht möglich. Es ist ein planerisches Unvermögen. Und die kleine Gier, der dringende Wunsch, sich am Monatsanfang mal etwas gönnen zu können. Nicht unbedingt einen übervollen Magen oder teures Fastfood, sondern volle Schränke. Da werden dann bunte Reihen Konservendosen aufgebaut, schön auf Kante, Ravioli neben Schinkensülze neben Knuspermüsli neben Erbsen-und-Möhrchen neben Instant-Tee Waldfrucht (violett) neben Blutorange (rot) neben Zitrone (gelb). Von allem fünf Packungen, und für Vati eine Flasche Hochprozentiges, für Mutti drei Sorten Haarfarbe (Hellblond, Mahagoni und Feuermohn, sie konnte sich nicht entscheiden) und für die Kinder jede Menge Überraschungseier. Die Familie genießt es, ihre Vorräte anzuschauen. Alle sind dann glücklich. Schlaraffenlandtage. Weil mir die Jammerei über den leeren Geldbeutel jeweils zum Monatsende auf die Nerven geht, versuche ich immer wieder, ein bisschen Planwirtschaft einzuführen: Haushaltsgeld wochenweise auszahlen und Einkaufszettel schreiben zum Beispiel. Das klappt aber selten.
»Frau Wohmann, Sie haben lauter Sachen gekauft, die gar nicht auf dem Einkaufszettel standen.«
»Die waren im Angebot, da habe ich mindestens zehn Euro gespart.«
»Aber Sie brauchen diese Woche keine zehn Dosen Cappuccinopulver.«
»Mein Mann trinkt das sehr gerne!«
»Ja, das stimmt, aber weil Sie auch noch eine Vorratspackung Brillenreinigungstücher, zwei Mini-Backformen mit Ostermotiven und dieses völlig sinnlose Raumduftspray gekauft haben, werden Sie nächste Woche mit nur 30 Euro die ganze Familie ernähren müssen.«





























