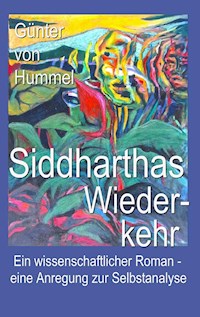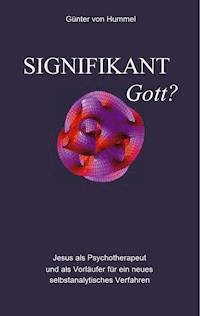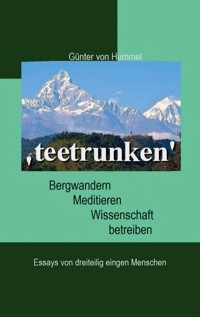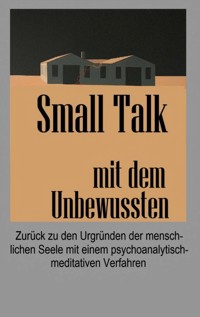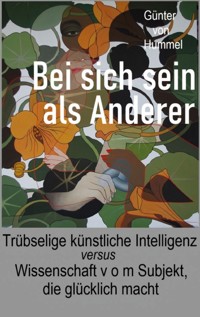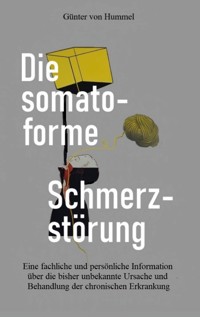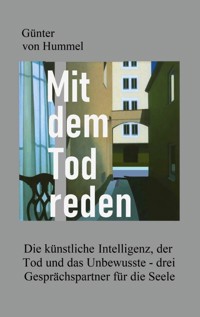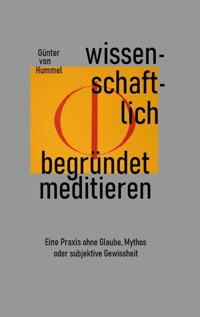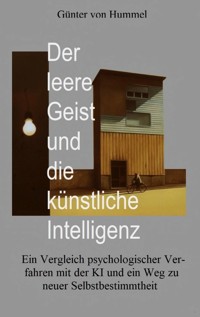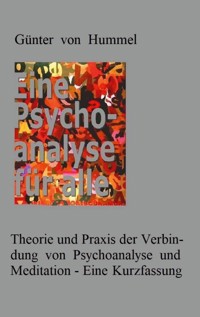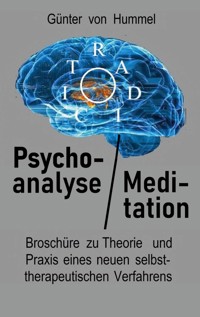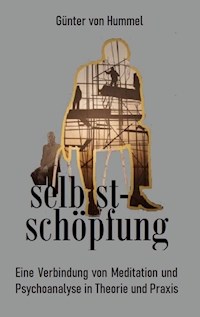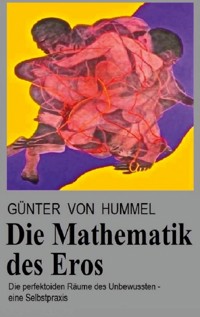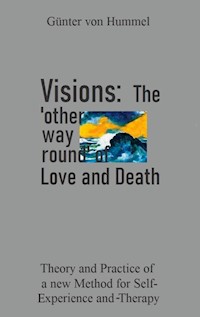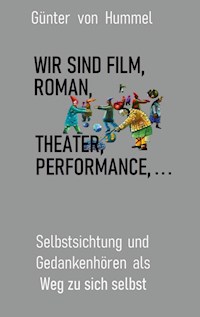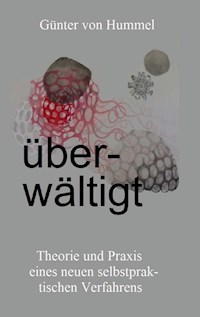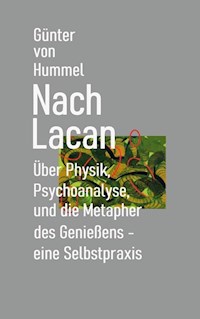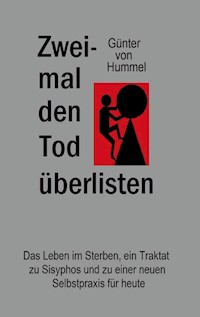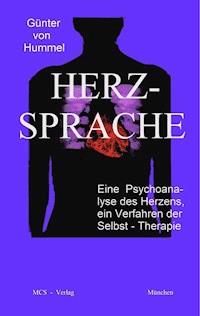
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht es um die kardiologische und psychosomatische Seite der Herzkranzgefäßerkrankung und des Herzinfarkts. Es werden in beiden Bereichen die dort ausgeprägten Widersprüche aufgezeigt und somit gefolgert, dass eine direkte, für den Betroffenen selbst zugeschnittene Methode wichtiger ist, als alle reinen Fachlösungen. Der Kranke, das Subjekt muss im Vordergrund stehen. Der Autor hat dafür ein psychosomatisches Verfahren entwickelt, das jeder selbst erlernen kann, um auf diese Weise wirkliche Herzsprache zu sprechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Der Körper in den Netzen des Diskurses
1. Wahrheit und / oder Realität
1.2 Zweierlei Herzinfarkte
1.3 Mathematische Sprachspiele
1.4 Die Cholesterin - Kontroverse
1.5 Das Sportherz ist in Ruhe krank
1.6 Der "objektive" Stoffwechsel
1.7 Der Bypass, ein Umweg
Psychosomatik der koronaren Herzerkrankung
2.1 Infarkt-Persönlichkeiten, A-Typen und andere
2.2 Herz - Gruppen-Dynamik
2.3 Psychoanalyse des Koronarkranken
Herz-Sprache
3.1 Herz- Linguistik, ein erster Versuch
3.2
COR – AMO – RIS
3.3 Das
Spricht
, das universale Gemurmel, und das
Strahlt,
das imaginäre Oszillieren
Literaturverzeichnis
Vorwort
Die hiermit vorliegende dritte Auflage ist gegenüber den Vorauflagen von 2004 und 2012 weiter verändert worden. Das anfänglich mehr für den Fachmann geschriebene Buch ist jetzt auch für den interessierten Laien und Betroffenen verfasst. Es geht in diesem Buch nicht nur um Herzerkrankungen (speziell die Herzkrangefäßerkrankung), sondern um ein psychologisches Verfahren, das die moderne technische Medizin durch eine subjektbezogene Übungsmethode ergänzen, ja vielleicht in einzelnen Teilen auch ersetzen soll. Trotz unserer wissenschaftlichen Fortschritte sind die Menschen nach wie vor verunsichert, wenn sie plötzlich Patienten geworden sind. Gerade eine Vielzahl von operativen, internen aber auch alternativen Heilverfahren macht es nicht leicht, die jeweils richtige Einschätzung der Erkrankung und den jeweils besten Behandlungsweg dafür zu finden. Wir sind in die technischen Zwänge und rein naturwissenschaftlichen Vorstellungen so eingebunden, dass wir sofort in Panik geraten, wenn uns jemand so ein Gespenst wie den „Herzinfarkt“ vor Augen hält, weil z. B. die Kathederbefunde an den Herzkranzgefäßen nicht mehr einwandfrei sind.
Umgekehrt ist die ausschließliche Anwendung von Naturheilverfahren oder der reinen Vorbeugemedizin für eine umfassende Behandlung auch nicht ausreichend. Der Herzinfarkt ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen unserer Leistungs und Zivilisationsgesellschaft, obwohl Krebserkrankungen mehr und mehr den ersten Rang einzunehmen scheinen. Aber all dies bedeutet nicht, dass der Einzelne nicht mehr von seinen gesundheitlichen Risiken wissen und auch mehr zu ihrer Bewältigung in vielfältiger Weise (Diät, Bewegungstherapie, Abbau von Risikofaktoren wie dem Cholesterin etc.) beitragen könnte. Psychosomatische Methoden, die über das Einüben seelischnervlicher Bewusstmachung, Stärkung und Entspannung wirken, können hier sehr viel zur Besserung und zum Verständnis der Krankheit beitragen. Sie können sogar Stoffwechselbefunde verbessern und die eigene Entscheidungsfähigkeit und Selbstverantwortlichkeit klären.
Um ein derartiges psychosomatisches Verfahren wird es also in diesem Buch gehen. Es kann natürlich auch bei anderen Erkrankungen helfen, bei denen in irgendeiner Weise das Psychische (vor allem das psychisch Unbewusste) und das Nervensystemmit in das Geschehen einwirken. Um aber nicht ein unübersichtliches Werk mit Bezug auf alle möglichen Erkrankungen, wie Magengeschwür, Migräne, Rheuma und nervliche Störungen – alles eben auch vom Unbewussten her mitverursachte Leiden – vorzulegen, habe ich mich in diesem Buch auf die koronare Herzerkrankung (abgekürzt KHK, Herzkranzgefäßerkrankung) konzentriert. Im ersten Teil lege ich die vielen Widersprüche der internistischen und chirurgischen Zugänge zur KHK dar, belegt durch reichliches Material aus Fachzeitschriften und -literatur. Der zweite Teil behandelt dasselbe Problem bezüglich psychologisch-soziologischer Zugänge. Dabei war ich berechtigt auch besonders krasse Beispiele für diese Widersprüche herauszuheben, um den einzelnen darin zu bestärken, dass er mehr Selbstverantwortlichkeit für seine Erkrankung lernen muss.
Dass ich im internistischen und chirurgischen Bereich speziell widersprüchliche Aussagen aus Fachzeitschriften zitiere, heißt nicht, dass die moderne Medizin nicht fortschrittlich ist und großartige Leistungen anzubieten hat. Aber Hundertprozentiges gibt es nirgendwo, und es kann also nur gut sein, wenn jeder Patient selbst mündig wird und seine Krankheit besser einschätzen, vorbeugen und sogar auch etwas mitbehandeln kann. Um dies zu betonen war ich also berechtigt, besonders kritisch vorzugehen. Im letzten Teil schließlich versuche ich dann das psychosomatische Übungsverfahren selbst aus konsequent wissenschaftlichen Vorgaben zu entwickeln, zu beschreiben und auch in seiner Praxis so darzustellen, dass jeder einzelne selbst mit seiner Anwendung beginnen kann. Der gesamte wissenschaft lich detailliert dargestellte Aufbau hat nämlich nicht nur den Zweck, die Theorie einer Erkrankung von verschiedenen Aspekten her plausibel zu machen, sondern hilft auch in der Praxis der Übungen. Vertrauen und Sicherheit in das Verfahren sollen aus eigenem Wissen und dem intellektuellen Verständnis der Übungen und nicht nur durch die suggestive Überzeugung des Arztes oder der Methode entstehen. Eigenes kritisches Mitdenken bei gleichzeitigem Üben (Lernen durch Wiederholung) wird den besten Effekt für das haben, was man dann wirklich kursivgeschrieben) Herz nennen kann.
Von der Psychoanalyse her haben wir einen sehr tiefen Zugang zum Unbewussten, das nicht die bewusste seelische Gefühlswelt meint, sondern strukturell in Form einer elementaren symbolische Ordnung verfasst ist, also eben wirklich Herz (nicht vorwiegend Herzmuskel, sondern Herz in seinen psychosomatischen Zusammenhängen) ist und bis in die Stoffwechselprozesse selbst hineinreichen kann. Daher ist ein Verfahren auf dieser Basis nicht nur wissenschaftlich fundierter, sondern auch tiefgreifender und nachhaltiger. Um es aber nicht umständlich und langwierig wie eine klassische Psychoanalyse zu gestalten, werden dem rein strukturellen Wesen des Unbewussten entsprechende Übungen verwendet, die ähnlich wie das autogene Training oder ein meditatives Verfahren aufgebaut sind und selbst erlernt und angewendet werden können. Es ist sozusagen eine Psychoanalyse „andersherum“. Im Zentrum stehen sogenannte Formel-Worte, die in einer Formulierung mehrere Bedeutungen enthalten und somit an der Grenze der Sprachlichkeit operieren. Gerade ein derartiges Vorgehen aber ermöglicht einen tiefen Zugang zum Herzen.
1. Der Körper in den Netzen des Diskurses
1.1 Wahrheit und /oder Realität
Das Herz kann nichts von sich selber sagen. Das wäre das einfachste, dass ein Herz sich selbst direkt mitteilte - einfach so, lautlos, unsichtbar und doch erfahrbar, damit es Herz-Sprache gäbe.1 Der griechische Philosoph Parmenides konnte noch auf der Suche nach dem "was das Sein wäre", behaupten, dass es sich selbst mitteilt, wenn man nur genau genug hinschaut. Aber in Wirklichkeit sagt er, Parmenides, es selber, und, Philosoph der er ist - reißt er sich dann das Sein unter den Nagel. Er behauptet einfach das Sein. Manchmal geht das in der modernen Medizin auch so: Man setzt einem Patienten einfach ein Kunstherz ein und behauptet dann, dass es genau das Herz sei, dass das jetzt fehlende des Patienten ersetzt. Es vermittelt sich - dieses Herz - exakt dadurch, dass es ein Motor, eine Pumpe mit vier Kammern und einer entsprechenden Zahl von Adern daran ist, das den gesamten Organismus mit Blut versorgen kann, und eben durch diese Definition ist es austauschbar, ist es Sein wie das andere Sein. Ist es Ein-S-Ein.2
Man spürt, dass hier etwas nicht klar unterschieden wird. Jemand mit einem Kunstherzen kann vielleicht nie mehr echt ‚herzliche‘ Gefühle haben, es kann ihm nie mehr so richtig ‚warm ums Herz‘ werden, und seine ‚Herzhaftigkeit‘ wird eventuell ein für alle Mal irgendwie anders ausfallen. Dagegen kann man einwenden, dass so jemand ohne das Kunstherz nicht mehr hätte überleben können und dass man für diesen Vorteil eben vieles andere darangeben muss. Doch auch diese Argumentation wird dem, um was es uns hier geht, nicht ganz gerecht. Es gibt Menschen, die behaupten, dass in einem ‚guten Sterben‘ mehr Sein, mehr Sinn und damit auch mehr Leben läge als in einem Dahinvegetieren mit einem Kunstorgan, also in einem Leben, das wir zwar nicht mit Anführungszeichen schreiben müssen, aber das nicht mehr viel wert ist. Gewiss, ein paar - rein zahlenmäßig - zusätzliche Jahre sind nicht zu unterschätzen. Doch ‚Lebensqualität‘ sollten sie schon auch haben. Und die kann einem nur das Herz geben, das Herz als solches. Das Herz ist weder seine ‚Herzlichkeit‘ noch das Pumporgan. Es ist etwas, was ich vorerst nicht anders hinschreiben kann als durch diese vier kursivgeschriebenen Buchstaben. Später werden wir jedoch eine generelle Lösung für dieses Herz finden, obwohl es für jeden etwas Subjektives behalten wird.
Vor einiger Zeit hat P. Pearsall ein Buch vorgelegt, in dem er genau dieses Herz beschreibt, indem es „ein eigenes Gedächtnis hat und Informationen weitergeben kann“.3 Doch der Autor bedient sich einer mystisch-mythischen Sprache, er spricht vom „Feinstofflichen“ und setzt „Energie“ mit „Information“ gleich. Derart unpräzise kann und will ich hier nicht vorgehen. Seit jeher wird im Sprechen vom Herzen grundsätzlich irgendetwas nicht klar unterschieden, etwa so etwas wie das Sein und der Sinn, die Realität und die Wahrheit. Deswegen benutze ich diese Kursivschreibung (Herz) und setze manches auch in Anführungszeichen. Diese Schreibweisen sollen schon von Anfang an zeigen, dass es nicht nur um eine Sprache des Herzens oder über das Herz geht, sondern direkt um Herz-Sprache ohne geheimnisvolle Konstrukte und auch ohne eine rein materialistische Auffassung. Denn das ist etwas anderes. Wie sollte man - was beispielsweise das Herz angeht - Realität und Wahrheit auch immer säuberlich trennen? Im Fluss des Lebens fragen wir uns, was wirklich ist und was nicht, und das genügt. Dass etwas echt ist, unwandelbar, einfach Faktum! Unverfälschtes Sein. Was soll man da philosophieren und unterscheiden zwischen einer Realität, die nackt und hart ist und einer Wahrheit, die anklingt an so etwas wie Ehrlichkeit, tieferen Sinn oder Authentizität?
Man muss es wohl einfach so anfangen, wie alles anfängt, als Geschichte. Es gibt Herzerkrankungen, z. B. Krankheiten der Herzkranzgefäße, die durch arteriosklerotische Verengungen (Stenosen) der Gefäßinnenwände entstehen. Aber sie entstehen auch durch Krämpfe (Spasmen) der Gefäßmuskulatur, vielleicht auch durch Zusammenwirken von Spasmen an den Stellen, wo schon exzentrische (nicht die ganze Rundung des Gefäßes betreffende) Verengungen vorher bestanden haben. Man weiß es noch nicht so genau. Es gibt sogar Autoren, die nicht das Herzkranzgefäß, sondern den Herzmuskel im Vordergrund der Erkrankung sehen. Etliche Wissenschaftler belegten durch umfangreiche Literatur, dass kein Zusammenhang zwischen Herzkrankheiten, insbesondere Herzinfarkt, und Herzkranzgefäßleiden besteht,4 auch wenn heute eine allgemeine Auffassung dahin tendiert, in den Verengungen der Herzkranzgefäße die Hauptursache für den Herzinfarkt zu sehen. Grundsätzlich wird noch nach den letzten Wahrheiten geforscht. Ich werde im Stoffwechsel-Kapitel zeigen, dass neuere Medikamente, die gar nicht an den Herzkranzgefäßen angreifen, ebenfalls enorme Wirkung auf diese Herzkrankheit haben (die man dann gar nicht mehr KHK nennen dürfte). Der Herzinfarkt ist also immer noch ein Rätsel!5 Ein Sein ohne Wahrheit, eine Wissenschaft, die viele Realitäten kennt.
Erst im Deutschen Ärzteblatt vom März 2016 wurde erneut beschrieben, dass wir die KHK bis heute nicht wirklich verstehen.6 Es könnten Entzündungen der Herzarterien eine große Rolle spielen, was man schon vor 150 Jahren begründet und inzwischen wieder fast ganz vergessen hat. Darauf gehe ich später noch weiter ein. Wir könnten für dieses grundsätzliche Problem von Sein und Wahrheit, Wissenschaft und Sinn, natürlich auch etwas anderes wählen als gerade Herzkrankheiten. Den Krieg vielleicht oder den Krebs. Das Wachsen der Pflanzen oder die Evolution der Schmetterlinge. Es ist eigentlich egal. Überall geht es um ein Sein, dessen Zusammenhang mit uns selbst wir genau hinterfragen müssten. Wir müssten Ökologie und Philosophie vielleicht mit einer Anthropologie zusammenbringen - das wäre nicht weniger ein ungewisses Unterfangen. Letztlich kommt es auf das gleiche heraus, nämlich zu finden, worin die Wahrheit, die uralte Wahrheit immer neu ist und mit der Realität zusammenhängt.
S. Freud z. B. fand sie zu Beginn des letzten Jahrhunderts in der Formel: Jeder Mensch trägt ein Begehren mit sich herum, das ihm unbewusst ist. Das ist Realität und das ist Wahrheit, doch sie sagt sich nicht mehr so verheißungsvoll und treffend wie früher. Das Wort ‚unbewusst‘ ist schon etwas abgenutzt, verbraucht. Zudem hat sich die Freud´sche Konzeption des Unbewussten bei körperlichen Krankheiten (selbst wenn sie psychisch bedingt sind) und auch für viele andere Fragen des menschlichen Lebens nicht so bewährt. Der Krieg, der Krebs, das Herz vermitteln sich nicht so leicht von selber, wie es die Einfälle der Nervösen in den Psychoanalysen getan haben. Denn in der „freien Assoziation“ psychisch Kranker fand Freud das Material, aus dem das Unbewusste zusammengesetzt ist. Letztlich gibt es also kein Sein, das gleich die Wahrheit wäre, sie offen und sichtbar vor sich hertrüge, sich gleich so sehr als wahr mitteilte, dass sie voll und ganz stimmte, dass sie Wissenschaft wäre, Wahrheit und Realität in einem. Doch eben da will ich hin, wenn vom Herzen die Rede ist und ich ein Verfahren entwickeln möchte, in dem das Herz sich „selbst spricht“.
Heutzutage kann dieses sich „selbst sprechen" nur innerhalb einer Wissenschaft geschehen. Dass die Mystiker früher ihr Herz direkt haben sprechen lassen, kann für uns heute nur noch historisches Interesse haben. Eine derartige Ausdrucksweise kann uns nicht mehr genügen, auch wenn sie in manchen Ergüssen christlicher oder islamischer Mystiker selbst für uns heute noch sehr authentisch und eindrucksvoll klingt. Aber auch das kalte naturwissenschaftliche Vokabular befriedigt gerade beim Thema Herz nicht. Wir benötigen eine Wissenschaft, die das Subjekt einschließt und nicht immer nur etwas zum Objekt ihrer Forschungen macht, in der sich also das Subjekt wirklich (‚objekthaft‘) selbst mitteilt. Nicht eine nur ‚objektive‘ Wissenschaft also, sondern eine Wissenschaft vom Subjekt, vom Herzen, die Wahrheit und Realität vereint.
Kehren wir zu unseren Herzkranken zurück. Es gibt sie zwar, diese Kranken, aber man kann – wie angedeutet - der zugrunde liegenden Krankheit nach der bisherigen Auffassung kein einheitliches Sein zusprechen. Das drückt sich nämlich in den unterschiedlichen Verläufen aus, die die sogenannte Koronare (= Kranzgefäß) Herzerkrankung (KHK) bei einem Mann nehmen kann, der über Schmerzen in der Brust klagt, besonders bei Belastung, aber auch gelegentlich in Ruhe, und der abgespannt und nervös ist und dem Freunde daher geraten haben, sich doch untersuchen zu lassen.
Der Mann, Herr X, wird an einen Spezialisten überwiesen, der ihm nach einer gründlichen Untersuchung einschließlich eines Belastungs-EKGs empfiehlt, eine Herzkatheteruntersuchung durchführen zu lassen (durch eine Beinschlagader in die linke Herzkranzader). Ergebnis: Eines der Hauptgefäße sei erheblich verengt, ein zweites gering. Es wird empfohlen, durch einen erneuten Katheter eine mechanische Aufweitung dieses Gefäßes vornehmen zu lassen, eine sog. PTCA, und einen Stent (ein mechanisches Gefäßröhrchen) einzusetzen. Basta - so einfach ist das!
Davon, dass der Patient sich wegen der Intrigen am Arbeitsplatz quält, kein Wort! Natürlich hätte er sagen können, dass bei Aufregungen im Geschäft die Schmerzen manchmal stärker sind. Aber der erste Arzt hat ihn auf den Zigarettenkonsum hingewiesen, und da ist zweifellos etwas dran. Die Zigaretten enthalten nämlich zu wenig Nikotin, haben jetzt Wissenschaftler bestätigt!7 Mehr Nikotin würde weniger schaden. Ohne Filter und mit naturbelassenen Tabaken würden Hunderttausende von Menschen länger leben. Aber die Tabakindustrie würde dann möglicherweise weniger Zigaretten verkaufen. Das Ganze ist nämlich eine psychologische Frage, weil das Verlangen nach dem Rauchen mit dem Nikotingehalt zusammenhängt, dagegen der Teer- und Kohlenmonoxdigehalt das eigentlich Schädliche ist. Mit mehr Nikotin würde weniger geraucht und somit würden letztlich weniger Teerstoffe aufgenommen.
Stimmt das? Wir haben doch geraucht wegen des ganzen Flairs, der Lust an der abgründigen Gelassenheit, an der nihilistischen Gebärde, der Sicherheit im Auftreten gegenüber dem anderen Geschlecht und was weiß Gott mehr! Wer will denn das in Beziehung setzen zum ‚ramus interventrikularis anterior‘ (mittlere Herzkranzarterie) und zu den Schmerzen im linken Arm, die immer morgens beim Weg zur Arbeit auftreten! Ja natürlich, morgens ist die Luft kalt, und Kälte gilt als typischer Auslöser des Angina-pectoris-Schmerzes. Aber etwa die Hälfte der Angina-pectoris-Kranken bestätigt diesen Zusammenhang nicht - oder handelt es sich bei diesen nur um Leute, die undefinierbare Brustschmerzen hatten, weil nämlich 40 % aller Patienten, die Herz-Brust-Schmerzen haben und die zum großen Teil auch arbeitsunfähig werden, gar nichts am Herzen fehlt?8 Oder die Raucher aus Angeberlust oder Söhne diabetischer Mütter waren (denen Statistiken häufiger eine KHK, also Koronare Herzkrankheit, zuweisen? Neuere Studien belegen aber, dass sich Zigaretten mit viel oder wenig Nikotin gleichermaßen auf das Infarktgeschehen auswirken.9 Entscheidend ist nämlich, wie man raucht!10 Wer gefährdet ist, also falsch raucht, lässt sich übrigens ganz einfach herausfinden. Man bestimme nur die Kohlenwasserstoffhydroxylase (ein Enzym) aus den Alveolar-Makrophagen (Zellen der Lungenschleimhaut), sagen die Wissenschaftler.10 Ein Angebot allerdings, das möglicherweise weder Realität (weil kaum jemand es durchführen lassen wird) noch Wahrheit (weil wahrscheinlich doch wieder nicht ganz erwiesen) ist.
Auf einer Tagung des "Tobacco Health Institute" in Kentucky wurden zahlreiche, nunmehr unumstößlich bewiesene Einzelheiten über das Rauchen zusammengetragen, so z. B. dass Rauchen den Fibrinogenspiegel (Blutgerinnungsstoff) im Blut erhöht, dass es Fetteinlagerungen in den Gefäßen erzeugt.11 13 Jahre nach Aufgabe des Rauchens reduziert sich das Sterberisiko um genau 5,5 %. Die Autoren stellen fest, dass die letzten Puzzle-Bausteine zum Wissen über das Rauchen bald bekannt sein werden.11 Trotzdem wird weltweit weiterhin geraucht. Aussichtslos, Wahrheit und Realität hier zusammenzubringen? Wenigstens in Europa ist seit Jahren das Rauchen zurückgegangen.
Die Sache ist dennoch diffizil, und es wundert uns nicht, dass wir über die Wirklichkeit des Herzinfarktes noch wenig wissen. Vielleicht gibt es den Infarkt gar nicht, und wir müssen uns fragen, was zwischen Wahrheit und Realität sonst noch zu finden ist, eben an Sein. Nur, wenn wir dann davon reden, kommen wir erst einmal nicht davon los, dass es immer noch Mythos ist, Geschichte, weil man das Sein ja erzählen muss: Nicht irgendein Mann geht zum Arzt, wie ich vorhin sagte, sondern Herr X, der Betriebsschlosser ist, geht zu seinem Hausarzt, von dem er sonst nicht viel hält. Aber seine Frau hat ihn jetzt gedrängt, weil der Mann ihr gegenüber häufiger Bemerkungen über Schmerzen in der Brust gemacht hatte, die manchmal bei körperlichen Anstrengungen bei der Arbeit auftreten. Eigentlich sind es nicht ganz exakt ‚körperliche Anstrengungen‘. Die Schmerzen sind nämlich meist dann da, wenn der Meister ihn gebeten hat, doch noch schnell dies und das zu erledigen und es dann auch noch körperlich anstrengend wird. Ja, wenn der Meister ihm das einfach barsch befohlen hätte, dann hätte er es ihm schon zurückgegeben. Aber der tut immer so unterschwellig bettelnd, so jovialisierend freundlich . . . Gerade das wurmt ihn besonders, da er dagegen nicht ankommt. Und während er dann die Arbeit macht und sich anstrengt und er den ganzen Ärger in sich hineinfrisst, fangen die Schmerzen an.
1.2 Zweierlei Herzinfarkte
Genau besehen geht Herr X nicht zu irgendeinem Arzt, sondern er geht zu Dr. A., der der naturwissenschaftlichen Auffassung ist, der Herzinfarkt sei eine Folge der arteriosklerotisch verengten Kranzgefäße. Nicht alle naturwissenschaftlichen (schulmedizinischen) Ärzte sind - wie ich schon eingangs sagte - dieser Auffassung.12 Einige meinen, er entstünde durch Stoffwechselprozesse in der Herzmuskelzelle selbst,13, 14 da sich immer wieder Infarkte bei einwandfreien Koronargefäßen finden, oder er sei gar Ausdruck einer vorwiegend seelischen Erkrankung. Prof. Eliot fand in seinem Sektionsgut bei 7 % aller an Infarkt Verstorbenen, bei denen bis zu 33 % ihres Herzens durch den Infarkt zerstört war, gesunde, normale Koronararterien.15 Manche Untersucher haben nachgewiesen, dass bei Männern unter 30 Jahren und bei Frauen unter 40 Jahren in über 30 % der Fälle beim Herzinfarkt keine Veränderungen an den Koronarien gefunden werden konnten.16, 17 Andere Untersucher fanden sogar bei fast 60 % der Koronarkranken keinen Koronarbefall!18 Von Frauen, die die Pille nehmen, weiß man, dass sie häufiger einen Infarkt bekommen, doch man findet bei ihnen ebenfalls so selten eine Verengung der Kranzgefäße, so dass man schon von einem eigenen Krankheitsbild gesprochen hat, das nichts mehr mit den herkömmlichen Infarktmechanismen zu tun hat.19 Beim Beim sogenannten plötzlichen Herztod finden sich sogar in über 70 % keine entsprechenden Koronarveränderungen, weil offensichtlich vom Herzmuskelgewebe selbst ausgehende Rhythmusstörungen die Ursache sind, bei denen Stoffwechselvorgänge eine entscheidende Rolle spielen.20, 21An diese Stelle passt auch die Beobachtung des genau umgekehrten Vorganges, dass nämlich Herzinfarkte durch Verengung der Kranzgefäße (Koronarien) bei rheumatischer Gefäßentzündung extrem selten auftreten, obwohl eine solche Gefäßbeteiligung bei 20 % aller Rheumakranken zu finden ist.22 Das gleiche gilt für Kranke mit der Werlhofschen Erkrankung, die sich durch starke Blutgerinnselbildung speziell auch in den Koronarien auszeichnet: trotzdem kaum Infarkte!23 Auch von Untersuchungen aus dem Koreakrieg (1950 bis 1953) sind bei jungen amerikanischen Gefallenen im Alter von 20 bis 25 Jahren hochgradige Gefäßveränderungen bekannt (z. T. mit Totalverschlüssen), ohne dass die Betreffenden je einen Herzinfarkt gehabt hätten (sog. Koreastudie).24
Schon einfache anatomische oder pathophysiologische Befunde allerdings lassen teilweise eine Erklärung dieser Widersprüche zu. Anitschkow unterschied eine „gutartige“, eher sogar mit einer Erweiterung des Gefäßes einhergehende Koronarsklerose (Koronarverdickung), die meist bei älteren Personen nachweisbar ist, von einer mehr bösartigen, verengenden Form jüngerer Personen,25 ein Phänomen, das auch neuerdings wieder belegt wurde.26 Zudem stellte Schoenmackers eine "elastische", die durch ihre Dehnbarkeit prognostisch ebenfalls gutartiger ist, einer mehr "unelastischen Koronarsklerose" gegenüber.27 Weiter sind Rückbildungen schon bestehender Verengungen auch im mittleren und höheren Lebensalter sogar bei bis zu 20 % der Betroffenen beschrieben,28 so dass also eine fixierte, starre Veränderung dieses Krankheitsbild nicht typisch charakterisiert.
Man muss der Koronarsklerose die Koronarinsuffizienz gegenüberstellen, die die eigentliche Pathophysiologie besser erfasst. Diese - definiert als "Missverhältnis von Blutangebot und - bedarf des Herzmuskels" - lässt sich jedoch wieder in 14 bis 17 Unterformen gliedern,29 so dass man besser gleich – so meinen die Autoren des Handbuches für Innere Medizin – vom „multifaktoriellen Geschehen der Koronarsklerose“ ausgehen sollte. Diese Multifaktorialität nimmt jedoch dann fast das ganze Buch ein. Im Grunde genommen gibt es überhaupt nur eine sehr ungenaue Zuordnung (auch was die noch später zu diskutierenden Risikofaktoren angeht) von Krankheit, Infarktereignis auf der einen Seite und Herzkranzgefäßbefall auf der anderen. Der mangelnde Zusammenhang von technisch erhobenen Befunden und wirklichem Krankheitswert ist übrigens auch für viele andere Krankheiten kennzeichnend (z. B. Röntgenbefunde an der Wirbelsäule).
Die Auffassung vom stoffwechselbedingten Infarkt im Gegensatz zum herzkranzgefäßbedingten ist auch eine speziell deutsche Eigenheit. Noch vor dem 2. Weltkrieg war das Gollwitzer-Meier-Institut in der deutschen Herzforschung führend, und man beschäftigte sich dort noch sehr viel mit dem Herzmuskelstoffwechsel. Unter dem Einfluss der amerikanischen Medizin nach dem Krieg rückte das Kranzgefäß mehr in den Vordergrund der hiesigen Untersuchungen. Bei Prof. M. v. Ardenne in Ostdeutschland jedoch herrschte weiterhin diese ganz andere, mehr auf die Herzmuskelzelle gerichtete Untersuchungstätigkeit vor. Seit Ende der 60iger Jahre gab es auf der Medizinischen Woche in Baden-Baden regelmäßig Tagungen dieser "alternativen Kardiologie", die immer sehr gut besucht waren und sind. Ist die Einheit von Realität und Wahrheit nur politisch zu verstehen? Inzwischen hat sich zwar die öffentliche Diskussion um diese Dinge etwas beruhigt, eine große Zahl von Patienten mit KHK sucht jedoch weiterhin ‚alternative‘ Ärzte auf, die mit besonderen Ernährungsformen, pflanzlichen oder homöopathischen Medikamenten und psychologischen Methoden arbeiten.
Der Pathologe G. Baroldi widmete der Frage dieser verschiedenen Infarktmechanismen sein Hauptwerk und hat auch plausible Erklärungen für die Herzmuskelzell-Theorie.30 Baroldi konnte nachweisen, dass es ausreichende Verbindungsäste (Kollateralen) zwischen den einzelnen Herzkranzarterien gibt und dass selbst hinter sehr stark verengten Gefäßen noch ein ausreichender Blutstrom vorhanden ist.31, 32 Dies konnte bestätigt werden: Die Kollateralen sind in der Lage sich bei Bedarf um das 25fache zu erweitern!33 Andere Autoren fanden sogar eine über 50fache Erweiterungsfähigkeit der Kollateralgefäße,34 so dass praktisch nie ein Infarkt auftreten müsste, wenn die Kranzgefäße Zeit hätten, diese Kollateralen auszubilden. Baroldi wies auch nach, dass die das Gefäß verstopfenden Thromben in keinem zeitlichen Zusammenhang mit dem Infarktereignis stehen,35 so dass man annehmen könnte, dass sie Folge und nicht Ursache des Infarktes sind. Obwohl für die Untersuchungen von Kollateralen eigentlich nur anatomische Untersuchungen nötig sind, gibt es bis heute keine festen Erkenntnisse über ihre wirkliche Bedeutung.36
Heute überwiegt allerdings die Ansicht, dass Kollaterale - wie Baroldi behauptete - doch eine erhebliche Vorbeuge- und Verhinderungsfunktion für den Herzinfarkt haben. 71 % aller Patienten mit einer Eingefäßerkrankung (nur ein Kranzgefäß ist verengt) haben nach sechs Wochen doppelt so viele Kollaterale. Verschlimmert sich die Koronarsklerose, so haben innerhalb nur kurzer Untersuchungsabstände mehr als doppelt so viele Personen Kollateralen ausgebildet.37 Aus diesen Gründen verwundert es also nicht, wenn man in Sektionen in 44 % der Fälle mit Totalverschlüssen und in 88 % der Fälle mit schweren Stenosen keine Herzinfarkte in dem entsprechenden Versorgungsgebiet dieser Arterien fand.38, 39 Was ist aber dann die Ursache des Infarkts? Immerhin wurde jetzt in Amerika die erste prospektive Studie durchgeführt, die die Wichtigkeit dieser Ersatzgefäße beweist.40
Unterstützen lassen sich diese Beobachtungen auch durch exakte Thalliumszintigraphien, die G. Dobrinski in Paris durchgeführt hat und die beweisen, dass entgegen herrschender Meinung kein Druckabfall im Kranzgefäß hinter der Verengungsstelle nachweisbar war.41 Überhaupt war die Thalliumszintigraphie eine Möglichkeit, zu zeigen, dass es stoffwechselbedingte Aufnahmestörungen in die Herzzelle selber gibt, die nichts mit vermindertem Koronarfluss zu tun haben.42 Sehr eindrucksvoll belegte Prof. Jennings mit tierexperimentellen Untersuchungen, dass metabolische Effekte, wie z. B. verminderter Verlust energiereicher Phosphate in der Zelle, einen Schutz für das minderdurchblutete Herz darstellen.43 Er hatte nämlich an Hunden die Kranzgefäße zeitweise unterbunden und sozusagen auf diese Weise das Herz gegen den Zelltod trainiert. Setzte er dann eine längere Unterbindung, so konnte er feststellen, dass die „trainierten“ Hunde wesentlich besser abschnitten als die, denen man solche vorbereitenden zeitweisen Unterbindungen nicht gesetzt hatte. Schaper und Pasyk konnten nachweisen, dass schon vier Tage bei einem stark verengten Gefäß genügen, damit sich ein derart ausreichender Kollateralkreislauf ausbildet.23 Deshalb bringen oft die „leichteren Stenosen“ den schnelleren Tod.44 Einige Untersucher fanden sogar, dass schon beim Auftreten von Spasmen der Kranzgefäße ausreichend Kollateralen zum Einsatz kommen und evtl. auch einen derartigen Trainingseffekt haben wie bei dem Hundeexperiment.45
Im ausführlichen Handbuch für Innere Medizin, Band Koronarerkrankungen, wird bestätigt, dass es letztlich unklar ist, warum eindeutig nachgewiesene Herzinfarkte bei einwandfreien Koronarien vorkommen.46 Man versucht zwar das Problem dadurch zu erklären, dass im akuten Stadium ein Verschluss des Kranzgefäßes durch eine Thrombose entstünde, die sich nachher relativ rasch wieder auflösen würde, aber gerade dieses Argument kann die Gegenmeinung, dass der Thrombus erst nach abgelaufenem Stoffwechselinfarkt sozusagen sekundär entsteht, noch eher bekräftigen, indem eben überhaupt die Wichtigkeit eines thrombotischen Geschehens betont wird. Man muss annehmen, dass es einen Zellfaktor gibt (z. B. die zitierten Phosphate oder die bereits erwähnten Angriffspunkte neuerer Medikamente), der unabhängig vom Kranzgefäß eine wichtige Rolle bei der Entstehung oder Verhütung des Herzinfarkts spielt. Dieser Faktor könnte dafür verantwortlich sein, dass bei seinem Fehlen erst nachträglich eine Thrombose in der Koronararterie entsteht, wie es verschiedene Untersuchungen nahe legten.47, 48 Z. B. erschien radioaktiv markiertes Fibrinogen (Blutgerinnselbestandteil) erst nach dem Infarkt im Koronarthrombus.48
Die Behauptung, dass sich bei jüngeren Patienten ohne Koronarveränderung nur durch einen Spasmus ein Thrombus bilden soll, klingt unglaubwürdig,49 noch dazu, wo in derselben Arbeit behauptet wird, dass schwere psychische Belastungssituationen dem Infarktereignis unmittelbar vorausgingen. Rauchen und Stress sollen genügen, dass sich in einem gesunden Gefäß eine Thrombose bildet und ein Infarkt entsteht? Neuere Untersuchungen ergaben, dass es wohl bei jedem Infarkt einen dynamischen Wechsel von Verschluss und Wiedereröffnung eines Gefäßes gibt und dass es sich also bei der Stenose um einen lebendigen, nicht eindeutig anatomischen oder pathogenetischen Faktoren zuzuordnenden Krankheitsprozess handelt.50
Hierzu passt auch das Paradox der sogenannten dilatativen Koronaropathie, eine Krankheit, bei der die Koronarien erheblich erweitert sind und trotzdem Infarkte auftreten. Das Blut fließt in diesen erweiterten Gefäßen zwar langsamer oder pendelt etwas hin und her; manchmal ist dieses Pendelverhalten aber ausgerechnet nur dann zu beobachten, wenn man die üblichen, die Koronardurchblutung verbessernden Medikamente verabreicht.51 Warum helfen diese gefäßerweiternden Mittel, wenn andererseits bereits erweiterte Gefäße sich infarktbegünstigend auswirken? Kann die negative Wirkung auf die bereits erweiterten Gefäße wirklich darin zu sehen sein, dass diese medikamentös noch mehr erweitert werden, obwohl über ein gewisses Maß hinaus nicht mehr erweitert werden kann? Klingt es dann nicht logischer, dass in einem solchen Fall eben nicht der Gefäßfaktor, sondern der Zellstoffwechselfaktor die entscheidende krankmachende Rolle spielt?
Man weiß auch, dass eine Kalziumüberladung der Zelle durch hohe Katecholaminspiegel, Magnesium- oder Vitamin-D3-mangel zustande kommen kann52 und somit auf Zellebene Infarkte möglich sind.53 Prof. Dörr nannte dies "elektive Parenchymnekrose", ein Begriff, der sich praktisch genau mit dem von Prof. Gillmann im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichten Begriff der „infarktoiden Nekrose“ trifft54 und wohl auch wieder den bereits erwähnten Begriffen wie etwa der Myozytolyse entspricht. Prof. Gillmann hatte nämlich diesen Streit zwischen den Befürwortern der Herzkranzgefäßtheorie und deren Gegnern, die eben der Ansicht sind, der Infarkt entstehe ohne wesentliche Beteiligung der Koronargefäße, aufgegriffen und eine Kompromisslösung vorgeschlagen. Beide Infarktmechanismen seien denkbar - sagte er - und griffen normalerweise wohl ineinander über. Ein Abwägen, welcher Typus bei jemandem mit Angina pectoris überwiegt, sei für die Behandlung wichtig.
Das Problem zeigt sich auch schon an der einfachen klinischen Tatsache, dass viele Menschen nur oder vorwiegend in Ruhe Herzanfälle haben, während es natürlich für die Kranzgefäßverengung typisch ist, dass bei körperlicher Belastung Schmerzen auftreten, weil dann nicht genug Blut durch die verengten Adern strömen kann. Der Kardiologe Prinzmetal und nach ihm andere konnten einen Zusammenhang mit Verkrampfungen (Spasmen) auch an sonst gesunden Arterien für diese Schmerzform nachweisen. Dennoch ist bis heute nicht klar, woher die Spasmen genau kommen und was sie wirklich für die Entstehung eines Infarktes bedeuten.55, 56, 57
Manchmal verursachen die Spasmen nämlich gar keine Schmerzen, sondern nur Rhythmusstörungen.58 Die Unterscheidung von der vegetativen Angina, die durch Reizung im vegetativen Nervensystem (Halssympathikus) wohl hauptsächlich durch Halswirbelleiden entsteht, ist schwierig. Schmidt-Vogt unterscheidet daher zehn verschiedene Angina-pectoris- Formen, von denen die Second-wind-Angina ebenfalls eine rätselhafte Spielart ist.58 Die Patienten können bei dieser Erkrankungsform nach einer akuten Schmerzphase plötzlich - als ob sie durch eine Wand hindurchgegangen wären, weshalb diese Form auch "Walk-through-Phänomen" heißt - wieder schmerzfrei lange Strecken auch unter Anstrengung gehen. Auch hierin ist erneut ein Beweis zu sehen, dass es keine Zuordnung der klinischen, ätiologischen (verursachenden), pathogenetischen, anatomischen und metabolischen Faktoren der "ischämischen" (durchblutungsgestörten) Herzerkrankung untereinander gibt.
Dass es sich beim Koronarspasmus um einen Nervenreiz handelt, der bis zum Gefäß durchgeleitet wird, wie der Londoner Kardiologe Prof. Maseri vermutet,59 ist unwahrscheinlich, denn warum kommt so etwas dann nicht bei jedem einmal vor, bei dem z. B. starke Nervenreize über die Halswirbelsäule zum Herzen geleitet werden? Halswirbelsäulensyndrome sind in der alltäglichen Praxis sehr häufig, und Zusammenhänge zwischen Herz und Wirbelsäule wird jeder Arzt bestätigen können. Doch welcher Art diese Zusammenhänge sind, ist nicht genau bekannt. Aber ein unmittelbares, direktes Infarktgeschehen, das einfach vom Kopf ins Herz geleitet wird, klingt unplausibel. Manche Autoren vermuten in 40 % aller Infarktfälle einen Koronararterienspasmus.60 Englische Forscher fanden, dass allein Angst mit überstarker Atmung (Hyperventilation) zu schweren spastischen Kranzgefäßdurchblutungsstörungen führen kann.61 Andere schließen Alkohol als Ursache für Spasmen nicht aus.62 Wahrscheinlich versteht aber jeder unter dem Begriff ‚Spasmus‘ etwas anderes. Es gibt nämlich auch eine generelle Spasmuskrankheit, bei der ganz unterschiedliche Organe und Organsysteme betroffen sind wie z. B. Kopf, Herz und Hände in Form von Migräne, Infarkt oder Morbus Reynaud, was sich nur schwer unter einer einheitlichen naturwissenschaftlichen Erklärung vereinen lässt.63 Auch Cannon vom National Institut of Health vermutet bei vielen Angina-pectoris-Kranken einen Nerven-Rückenmarksfaktor, der sich auf alle glatten Muskelzellen auswirkt (Speiseröhre, Herz).64 Neuerdings konnte ein solcher Faktor, der für nicht koronar bedingte Herzmuskelerkrankungen und Angina pectoris verantwortlich ist, in Form eines gestörten Katecholaminspeicherverhaltens nachgewiesen werden.65
Zudem stützen noch andere Fakten die These, dass der Herzinfarkt nicht nur Folge eines Koronarverschlusses ist. So ist seit dem zunehmenden Kokainmissbrauch bekannt, dass durch Kokain Herzinfarkte entstehen.66, 67 Der Mechanismus scheint genau derselbe zu sein, den Baroldi als tetanische oder versagende Nekrose beschreibt, denn man findet Herzmuskelzellen in Dauerkontraktur und kann sich den Mechanismus auch gut über eine Kalziumüberladung durch exzessiv einströmende Katecholamine erklären.68, 69 Die Tatsache, dass man auch vermehrte Koronarsklerose bei Kokainkonsumenten findet, widerspricht dem nicht, weil ein derartiger Personenkreis sicher auch mit zahlreichen sonstigen Schädigungseinflüssen lebt. Aber es sind auch Fälle beschrieben, wo Kokain bei einwandfreien Gefäßen und ohne Vorliegen von sonstigen schädlichen Risikofaktoren (auch kein Nikotinabusus) zum Infarkt führte.70 Weitere toxische Myokardinfarkte sind von Lösungsmittelmissbrauch und durch Zytostatika (Adriblastin) bekannt.71, 72 Interessanterweise, aber vielleicht durchaus dazu passend, kann diese toxische Herzkrankheit mit dem bereits oben erwähnten Strophantin behandelt werden, bezüglich dessen Wirkungen beim Infarkt die Meinungen sehr gespalten sind (siehe spätere Stellungnahme).73 Beim „Schnüffeln“ von Toluol, aber auch beim Inhalieren des bekannten Narkosemittels Halothan wurden eindeutig Herzinfarkte bei einwandfreien Koronarien beobachtet. Ursachen waren Herzhypertrophie und toxische Myokarditis, also letztlich metabolische Veränderungen in den Herzmuskelzellen selbst.74 Bei den Zytostatika ist sogar der genaue Schädigungsmechanismus weitgehend geklärt, und es ist erwiesen, dass er sich in den Mitochondrien der Herzmuskelzelle abspielt.75 Auch Amphetamin, ein Aufputschmittel, kann Infarkte bei unauffälligem koronarangiographischem Befund verursachen, wobei hier die Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs der Herzmuskelzelle diskutiert wird.76 Gerade ein solcher Mechanismus, dass hier ein Zuviel an Sauerstoffumsatz anstatt ein Zuwenig die entscheidende Schadstelle markiert, wird uns noch beschäftigen.
Unter vielen weiteren derartigen Mechanismen sollte auch noch der strahleninduzierte Infarkt (bzw. KHK) erwähnt werden, der nach Röntgenbestrahlungen im Brustraum auftritt, was kaum mit den bisherigen und bekannten Ursachen in Einklang zu bringen ist, die zu Koronarveränderungen führen.77, 78, 79 Besonders die Hochvolt-Bestrahlung wird hier angeführt.80 Im übrigen gilt das gleiche, nämlich die Fraglichkeit der Bedeutung von Gefäßverengungen für den dahinterliegenden Infarkt, auch für das Gehirn. Zeitweise ist man immer mehr dazu übergegangen, Verengungen der Halsschlagader bei weitem nicht mehr so häufig zu operieren, weil die Zusammenhänge nicht eindeutig sind und die Nutzen-Risiko-Relation der Operation ebenso nicht eindeutig zu belegen ist.81 Allerdings gibt es heutzutage Methoden einer operativen Ausputzung der Halsschlagader, die gute Erfolge haben.
In diesem Zusammenhang muss ich nochmals auf das Phänomen des plötzlichen Herztodes hinweisen, dem z. B. in England jährlich 100 000 Patienten erliegen.82 Unter dem Begriff des plötzlichen Herztodes versteht man das Auftreten eines tödlichen Infarktes oder infarktähnlichen Ereignisses ohne vorherige Anzeichen, dem nach Angaben anderer Autoren ein Siebtel aller KHK-Kranken erliegt.83