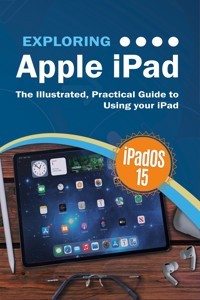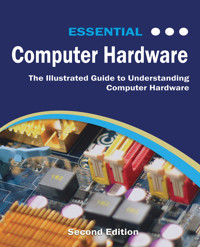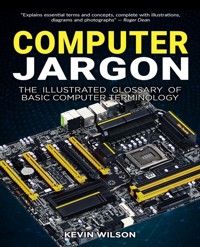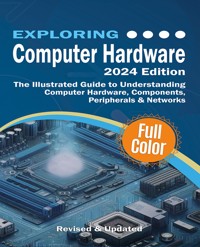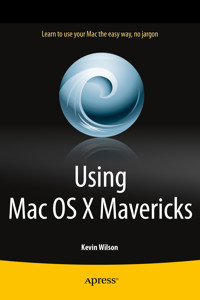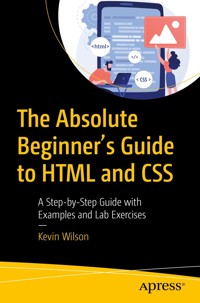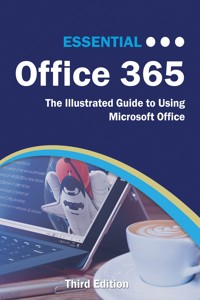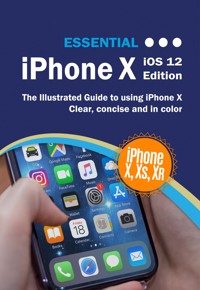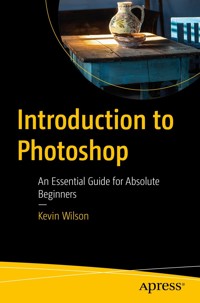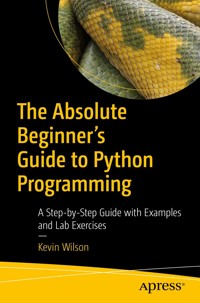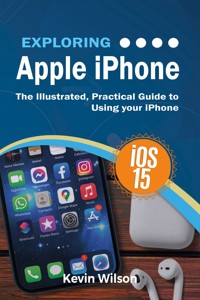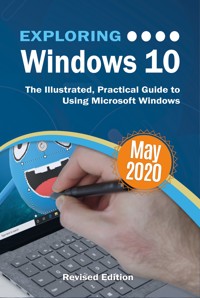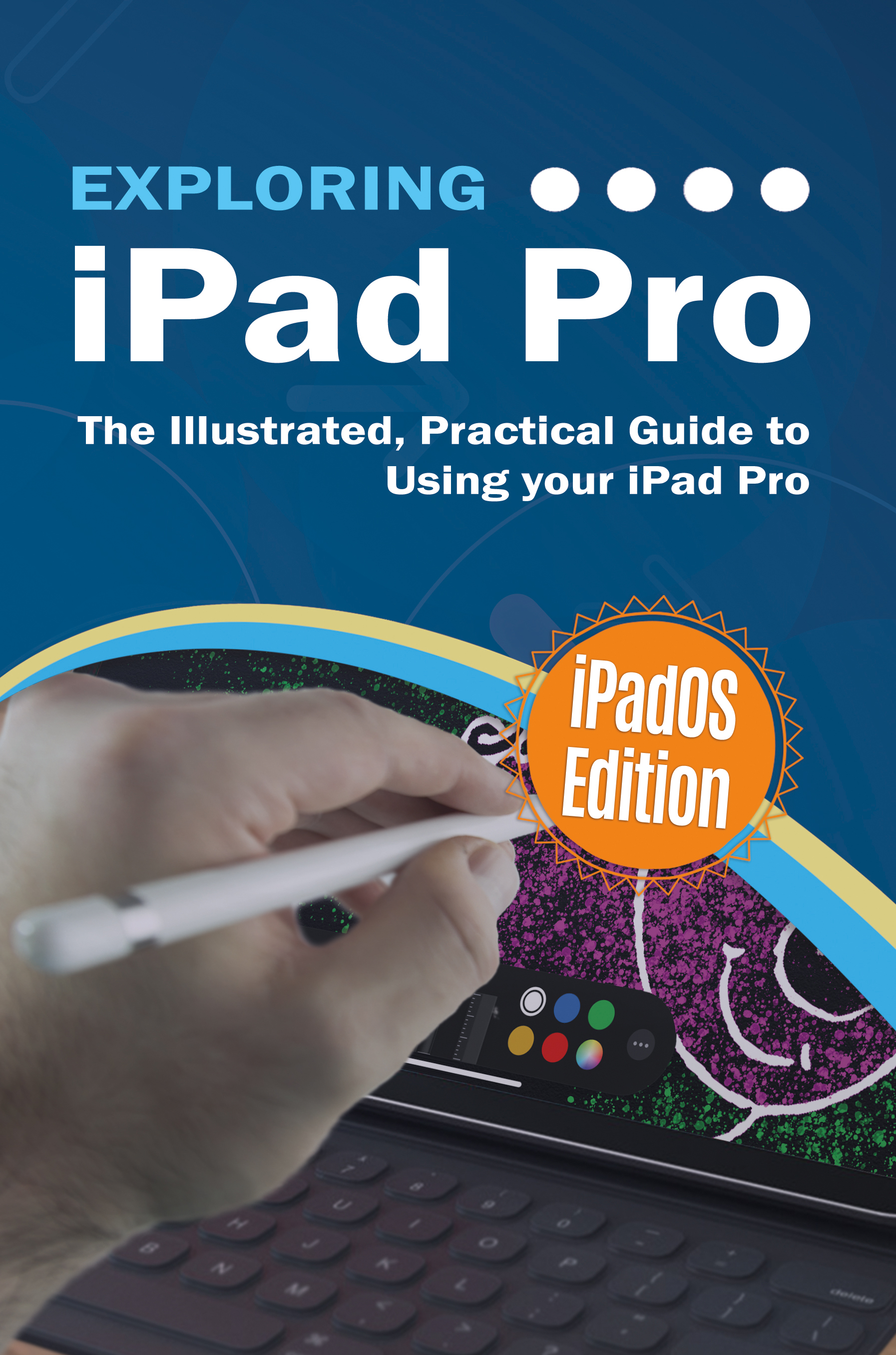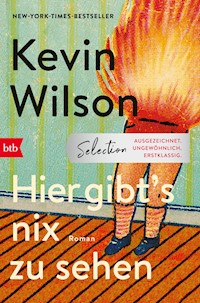
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Besondere Autor*innen, besondere Geschichten: btb SELECTION – Ausgezeichnet. Ungewöhnlich. Erstklassig.
Lillian und Madison waren ungleiche und doch unzertrennliche Freundinnen im Elite-Internat Iron Mountain – bis Lillian nach einem Skandal unerwartet die Schule verlassen musste. Seitdem haben sie kaum voneinander gehört. Doch jetzt braucht Madison Hilfe: Ihre Zwillingsstiefkinder sollen bei der Familie einziehen, und Madison möchte, dass Lillian sich um die beiden kümmert. Der Haken: Die Kinder gehen spontan in Flammen auf, wenn sie aufgeregt sind. Im Laufe eines schwülen, anstrengenden Sommers lernen Lillian und die Zwillinge, einander zu vertrauen – und cool zu bleiben. Überrascht von den eigenen intensiven Gefühlen und ihrem erwachenden Beschützerinstinkt bemerkt Lillian, dass sie die seltsamen Kinder genauso dringend braucht, wie diese sie brauchen.
Mit scharfzüngigem Witz, viel Herz und bestechender Zartheit erzählt Kevin Wilson eine höchst ungewöhnliche Geschichte über elterliche Liebe und Kinder mit bemerkenswerten Fähigkeiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Lillian und Madison waren ungleiche und doch unzertrennliche Freundinnen im Elite-Internat Iron Mountain – bis Lillian nach einem Skandal unerwartet die Schule verlassen musste. Seitdem haben sie kaum voneinander gehört. Doch jetzt braucht Madison Hilfe: Ihre Zwillingsstiefkinder sollen bei der Familie einziehen, und Madison möchte, dass Lillian sich um die beiden kümmert. Der Haken: Die Kinder gehen spontan in Flammen auf, wenn sie aufgeregt sind. Im Laufe eines schwülen, anstrengenden Sommers lernen Lillian und die Zwillinge, einander zu vertrauen – und cool zu bleiben. Überrascht von den eigenen intensiven Gefühlen und ihrem erwachenden Beschützerinstinkt bemerkt Lillian, dass sie die seltsamen Kinder genauso dringend braucht, wie diese sie brauchen.
Zum Autor
KEVIN WILSON begann mit dem Schreiben, weil er einsam war und glaubte, sobald er gute Geschichten schrieb, würde er unwiderstehlich werden. Heute lebt er mit seiner Frau Leigh Anne Couch und ihrem gemeinsamen Sohn Griff in Tennessee, wo Wilson geboren und aufgewachsen ist. Er unterrichtet Kreatives Schreiben an der University of the South. Seine Erzählungen und sein Roman »Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung« begeisterten Kritiker wie Leser.
KEVIN WILSON
HIER GIBT’S NIX ZU SEHEN
Roman
Aus dem Englischen von Xenia Osthelder
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Nothing to see here« bei Ecco, einem Imprint von HarperCollins Publishers.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe Januar 2023
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Kevin Wilson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag, München
Covergestaltung: Semper Smile nach einem Entwurf von Allison Saltzman/Harper Collins
Coverillustration: Christian Northeast
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MSP · Herstellung: sc
ISBN: 978-3-641-26818-3V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Ann Patchett und Julie Barer
Weitere Titel von Kevin Wilson
Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung
Das Große-Schwestern-Handbuch
Das Beste, was Izzy Poole passieren konnte
EINS Im Frühjahr 1995, wenige Wochen nach meinem achtundzwanzigsten Geburtstag, erhielt ich eine Nachricht von meiner Freundin Madison Roberts. Für mich war sie damals eigentlich immer noch Madison Billings. Vier- oder fünfmal im Jahr schrieb sie mir, wie es ihr ging, schickte mir Briefe, die sich lasen, als kämen sie vom Mond. Ihren Lifestyle findet man gewöhnlich nur in Zeitschriften. Sie war mit einem Senator verheiratet, der älter war als sie, und sie hatte mit ihm einen kleinen Sohn, den sie in Matrosenanzüge steckte, in denen er wie ein kostspieliger, lebendiger Teddybär aussah. Ich hatte damals zwei Jobs, jeweils als Kassiererin bei konkurrierenden Lebensmittelketten, rauchte Gras und hauste bei meiner Mutter auf dem Dachboden. Aus meinem Kinderzimmer hatte sie einen Fitnessraum gemacht, kaum dass ich achtzehn geworden war. Ein riesiger Crosstrainer stand dort, wo ich meine unglückliche Kindheit verbracht hatte. Von Zeit zu Zeit ging ich mit einem Jungen, der mir nicht das Wasser reichen konnte, sich das aber einbildete. Man kann sich vorstellen, dass Madisons Briefe an mich hundertmal interessanter waren als meine an sie, aber sie ließ unseren Kontakt nicht abreißen. Jene Nachricht im Frühling unterbrach den vorhersehbaren Rhythmus unserer Korrespondenz. Stutzig hat mich das jedoch nicht gemacht. Madison und ich schrieben uns übrigens nur auf Papier. Ich besaß noch nicht einmal ihre Telefonnummer.
Während meiner Pause im Save-a-Lot hatte ich zum ersten Mal Gelegenheit, ihren Brief zu lesen. Sie forderte mich auf, zu ihr nach Franklin, Tennessee, zu kommen. Sie hatte einen interessanten Job für mich. Fünfzig Dollar für das Busticket waren beigefügt. Sie wusste, dass mein Auto Entfernungen von über fünfundzwanzig Kilometer nicht mehr schaffte. Um was es sich genau handelte, verriet sie nicht, aber es konnte kaum schlimmer sein, als sich mit den Lebensmittelmarken des Hilfsprogramms für Bedürftige herumzuschlagen oder die verdammte Waage zu überreden, gammelige Äpfel richtig zu wiegen. In den letzten fünf Minuten meiner Pause fragte ich also meinen Chef Derek, ob ich ein paar Tage freihaben kann. Dass er ablehnen würde, war mir klar, aber sauer war ich darüber nicht. Ich war weit davon entfernt, eine gewissenhafte Arbeitskraft zu sein. Es war schwierig, zwei Jobs gleichzeitig zu haben, weil ich meine Chefs zu unterschiedlichen Zeiten enttäuschte und manchmal den Überblick verlor, in welchem Laden ich gerade besonders viel verbockt hatte. Meine Gedanken wanderten zu Madison, der wohl schönsten Frau, die mir jemals im Leben begegnet war. Sie war unheimlich intelligent und sah in allen Lebenslagen immer die Chancen. Wenn sie einen Job für mich hatte, würde ich ihn annehmen. Den Dachboden bei meiner Mutter würde ich aufgeben und mein ganzes Leben komplett entsorgen. Wenn ich ehrlich war, viel würde mir nicht fehlen.
Eine Woche nachdem ich Madison meinen Ankunftstermin geschrieben hatte, wartete ein Mann im Busbahnhof von Nashville. Er hatte eine Sonnenbrille auf der Nase und trug ein Polohemd. Mein erster Eindruck war, dass er eine besondere Schwäche für Armbanduhren hatte.
»Lilian Breaker?« Ich nickte. »Mrs. Roberts hat mich beauftragt, Sie abzuholen. Ich heiße Carl.«
»Sind Sie der Fahrer?«, fragte ich. Mich plagte die Neugier. Zu gern hätte ich gewusst, wie reiche Leute wirklich leben. Im Fernsehen hatten sie zum Beispiel alle einen Chauffeur, aber das hielt ich für ein Fantasieprodukt Hollywoods, ohne Entsprechung in der realen Welt.
»Nicht nur. Ich bin gewissermaßen für alles zuständig. Ich helfe Senator Roberts und, wenn erforderlich, auch Mrs. Roberts.«
»Haben Sie eine Ahnung, was ich hier soll?« Ich wusste, wie Bullen redeten, und in meinen Ohren klang Carl wie einer. Da sich meine Begeisterung für Ordnungshüter in Grenzen hielt, wollte ich ihm auf den Zahn fühlen.
»Ich habe eine Vermutung, aber Mrs. Roberts wird selbst mit Ihnen sprechen. Ich gehe davon aus, dass es ihr lieber ist, wenn ich ihr nicht vorgreife.«
»Was für ein Auto fahren Sie? Gehört es Ihnen?«
Nach den Stunden im Bus mit Menschen, die nur trocken gehustet oder merkwürdig geschnüffelt hatten, wollte ich hören, wie meine Stimme im Freien klang.
»Ich fahre einen MX-5 Miata. Er gehört mir. Sind Sie bereit, Ma’am? Kann ich Ihr Gepäck zum Auto bringen?« Carl war eindeutig auf dem Sprung und wollte seinen Auftrag möglichst schnell hinter sich bringen. Er hatte den Polizistentick, Ungeduld mit äußerster Höflichkeit zu tarnen.
»Ich habe kein Gepäck.«
»Wenn Sie mir nun folgen wollen, bringe ich Sie unverzüglich zu Mrs. Roberts.«
Bei seinem Miata angekommen, einer echt heißen Kiste, fast zu klein für die Straße, fragte ich, ob wir ohne Verdeck fahren könnten, aber er meinte, das sei keine gute Idee. Seine Weigerung schien ihm peinlich zu sein, oder vielleicht machte es ihn verlegen, dass ich den Wunsch geäußert hatte. Ich konnte Carl schlecht einordnen, also machte ich es mir im Auto bequem und ließ die Landschaft an mir vorüberziehen.
»Mrs. Roberts sagte mir, Sie seien ihre älteste Freundin«, kam es von Carl, der Konversation machen wollte.
»Das könnte hinkommen«, erwiderte ich. »Wir kennen uns schon eine Weile.«
Ich verkniff mir die Bemerkung, dass Madison vermutlich außer mir keine Freundinnen hatte. Ich kreidete es ihr nicht an. Schließlich hatte ich auch keine. Ich verschwieg ebenfalls, dass ich mich fragte, ob wir überhaupt Freundinnen waren. Was wir einander bedeuteten, war seltsamer. Aber das eignete sich nicht für Carls Ohren, deshalb setzten wir die Fahrt schweigend fort. Aus dem Radio kam sanfte Musik. Bei mir weckte sie den Wunsch, in heißem Badewasser unterzutauchen und davon zu träumen, alle, die ich kannte, umzubringen.
Kennengelernt hatte ich Madison auf einer piekfeinen Mädchenschule, die versteckt auf einem Berg am Ende der Welt lag. Vor hundert Jahren oder vielleicht noch früher waren Männer, die es in dieser Einöde zu Geld gebracht hatten, zu der Erkenntnis gelangt, dass sie eine Schule brauchten, auf der ihre Töchter für die Ehe mit einem reichen Mann vorbereitet wurden, damit sie die gesellschaftliche Leiter hinaufklettern konnten, bis sich niemand mehr an die Zeit erinnerte, als sie noch nicht vorbildlich waren. Man holte sich einen Briten nach Tennessee, und er führte die Schule, als seien die wohlhabenden Töchter Prinzessinnen. Bald schickten wiederum andere reiche Männer aus unfruchtbaren Gegenden ihre Töchter zu ihm. Nachdem sich das oft genug wiederholt hatte, hörten finanzkräftige Leute in richtigen Städten wie New York und Chicago von dieser Schule und begannen, ihre Töchter dort anzumelden. Eine Schule, die so ein Glück hat, kann sich jahrhundertelang auf ihren Lorbeeren ausruhen.
In dem Tal, das zu diesem Berg gehörte, bin ich aufgewachsen, gerade arm genug, um mir vorstellen zu können, von dort abzuhauen. Ich wohnte bei meiner Mutter und ihren ständig wechselnden Verehrern. Mein Vater war entweder tot oder hatte sich aus dem Staub gemacht. Meine Mutter äußerte sich nur vage über ihn, ein Foto von ihm gab es nicht. Als hätte sie ein griechischer Gott in Hengstgestalt geschwängert, bevor er zurück zu seinem Wohnsitz auf dem Olymp galoppiert war. Wahrscheinlicher ist, dass mein Vater nur ein Widerling war, der in einem der feinen Häuser wohnte, wo meine Mutter putzte. Vielleicht ein Stadtrat, den ich mein ganzes Leben gesehen hatte, ohne zu ahnen, wer sich in Wirklichkeit hinter ihm verbarg. Meine Lieblingsfantasie war jedoch, dass mein Vater mich nicht aus meinem Unglück herausholte, weil er nicht mehr lebte.
Die Iron Mountain Girls Preparatory School vergab alljährlich ein oder zwei Unterrichtsstipendien an vielversprechende Mädchen aus dem Tal. Ich war damals verdammt vielversprechend, auch wenn das heute kaum zu glauben ist. In meiner Kindheit hatte ich die Zähne zusammengebissen und war mit dem Kopf durch die Wand, nur damit ich einsame Spitze war. Mit drei Jahren brachte ich mir das Lesen bei, indem ich das, was aus dem kleinen Lautsprecher kam, mit den Wörtern im Bilderbuch verglich. Ich war acht, da machte mich meine Mutter zur Verwalterin unserer Finanzen. Das Bargeld in den Briefumschlägen, mit denen sie abends heimkam, bildete die Grundlage meines Budgets. Von der Schule brachte ich nur Einser nach Hause, anfangs aus dem instinktiven Wunsch heraus, die Beste zu sein, als ahnte ich, was in mir steckte, und müsste meine Grenzen testen. Kaum hatten die Lehrer jedoch durchblicken lassen, dass es ein Stipendium für Iron Mountain gab, konzentrierte ich meine Anstrengungen darauf. Ich hatte natürlich keine Ahnung, dass diese Schule nur eine Art Abzeichen war, das reichen Mädchen auf ihrem Weg in eine vorbestimmte Zukunft angeheftet wurde. In meiner Fantasie war Iron Mountain eine Arena für Amazonen. Bei Rechtschreibewettbewerben brachte ich nun meine Klasse zum Heulen. Ich schrieb ganze wissenschaftliche Arbeiten einfach ab, streute ein paar schwache Stellen ein und sicherte mir so einen Preis bei den Bezirksmeisterschaften. Ich lernte Gedichte der Harlem Renaissance auswendig und trug sie linkisch den Freunden meiner Mutter vor, die mich fortan für einen bösen Geist hielten, der in Zungen redete. Weil es kein Basketball-Mädchenteam gab, spielte ich als Point Guard in der Elitemannschaft der Jungen. Die Einwohner meiner Stadt betrachteten mich mit Wohlwollen, ob sie arm waren oder zur Mittelschicht, insbesondere zur oberen Mittelschicht, gehörten, als fänden mich alle gut, mich, das Paradepferd unseres kleinen, hinter dem Mond gelegenen Landkreises. Zu Großem war ich nicht auserkoren, das war mir klar, aber ich versuchte, Leute in den Schatten zu stellen, die dumm genug waren, nicht auf der Hut zu sein.
Ich erhielt das Stipendium, und ein paar Lehrer sammelten sogar genügend Spenden, um meine Unkosten für Unterrichtsmaterial und Verpflegung zu decken. Meine Mutter hatte mir unverblümt zu verstehen gegeben, dass sie weder das eine noch das andere aufbringen konnte.
Am ersten Schultag trug ich einen potthässlichen Pulli, mein einziges ordentliches Kleidungsstück, und meine Mutter brachte mich und die Tasche mit meinen Sachen, inklusive meiner Schuluniform – schwarzer Rock und weiße Bluse in dreifacher Ausführung – auf den Berg. Andere Eltern fuhren in BMWs vor und in so ausgefallenen Autos, dass ich noch nicht einmal die Marken kannte. »Herrgott, nun schau sich einer das hier an«, übertönte meine Mutter die Heavy Metall Musik im Auto. Nervös spielte sie mit ihrer Zigarette. Ich hatte sie gebeten, mit dem Anzünden zu warten, damit mein Haar nicht nach Rauch roch.
»Lillian, das klingt jetzt gemein, aber hier gehörst du nicht hin. Ich sag nicht, dass die was Bessres sind als du, aber das könnte die Hölle werden.«
»Es ist eine gute Chance«, hielt ich dagegen.
»Dein jetziges Leben ist beschissen, das weiß ich«, fuhr sie fort, geduldig wie selten, obwohl der Motor noch lief. »Dein Leben ist beschissen, und ich weiß, dass du was Bessres suchst. Aber wenn du aus Scheiße Gold machen willst, dann hast du dir was ziemlich Krasses vorgenommen. Ich hoffe, du schaffst das.«
Ich nahm ihr die Bemerkung nicht übel. Meine Mutter liebte mich, das wusste ich, wenn auch nicht auf eine Weise, die offensichtlich und für andere Menschen nachvollziehbar war. Sie wollte aber, dass es mir gut ging. Gleichzeitig mochte sie mich nicht, da machte ich mir nichts vor. Ich raubte ihr den letzten Nerv, war ihr ein Klotz am Bein. Für mich kein Problem. Ich trug es ihr nicht nach. Oder vielleicht doch, denn ich war ein Teenager und fand sowieso alles Scheiße.
Sie drückte auf den Zigarettenanzünder, und während sie darauf wartete, dass er glühte, nahm sie mich in den Arm. »Du kannst jederzeit nach Hause zurückkommen, Süße«, sagte sie, und ich dachte, eher würde ich mich umbringen. Ich stieg aus dem Auto, und sie fuhr ab. Auf dem Weg zu meinem Zimmer fiel mir auf, dass ich für die anderen Mädchen Luft war. Mit Gemeinheit hatte das nichts zu tun. Ihre Augen waren von Geburt an darauf getrimmt worden, nur wichtige Menschen zu sehen. Und zu denen gehörte ich nicht.
In meinem Zimmer, dem Zimmer, das wir zusammen bewohnen sollten, traf ich Madison. Im Sommer hatte mich ein kurzer Brief informiert, dass meine Mitbewohnerin aus Atlanta, Georgia, käme und Madison Billings heißt. Das war alles, was ich wusste. Chet, ein Ex-Freund meiner Mutter, der immer dann aufkreuzte, wenn sie gerade nicht in festen Händen war, hatte den Brief gesehen. »Ich wette, das ist eine von den Kaufhaus-Billings. Die leben in Atlanta. Haben Geld wie Heu.«
»Wie willst du das denn wissen, Chet?«, fragte ich. Gegen Chet hatte ich nichts. Er war harmlos, etwas exzentrisch, was ich aber besser fand als das Gegenteil. Auf seinem Unterarm war Betty Boop eintätowiert. »Achte auf die kleinen Hinweise«, sagte er. Er fuhr einen Gabelstapler. »Information ist Macht.«
Madisons schulterlanges Haar war blond, und sie trug ein gelbes Sommerkleid, bedruckt mit Hunderten von orangefarbenen Goldfischchen. Selbst in Flipflops war sie groß wie ein Model, und ich wusste sofort, dass ihre Fußsohlen superzart waren. Ihre Nase war perfekt, ihre Augen blau, und sie hatte gerade so viele Sommersprossen, dass es nett aussah und nicht, als hätte der liebe Gott sie in ihrem Gesicht explodieren lassen. Im Zimmer roch es nach Jasmin. Unsere Gebiete hatte sie schon abgesteckt und das Bett gewählt, das am weitesten von der Tür entfernt stand. Bei meinem Anblick lächelte sie mich an, als wären wir befreundet. »Bist du Lillian?« Ich konnte nur nicken. In meinem Scheißpulli fühlte ich mich wie eine Göre aus der Bozo Show.
»Ich bin Madison«, fuhr sie fort. »Nett, dich kennenzulernen.« Sie hielt mir die Hand hin. Ihre Nägel waren zartrosa lackiert und erinnerten mich an die Nase eines Häschens.
»Ich bin Lillian«, stellte ich mich vor, während ich ihr die Hand gab. Noch nie hatte ich jemanden in meinem Alter mit Handschlag begrüßt.
»Man hat mir gesagt, dass du Stipendiatin bist«, ließ sie mich dann wissen, es schwang aber kein Vorurteil in ihrer Stimme mit. Sie schien nur klarstellen zu wollen, dass sie es wusste.
Errötend fragte ich, warum man ihr das mitgeteilt hatte.
»Ich weiß nicht. Man hat es mir halt gesagt. Vielleicht, damit ich höflich zu dir bin.«
»Alles gut.« Schon jetzt fühlte ich, dass Madison so gut wie unerreichbar war und auch die Schule wenig daran ändern würde.
»Für mich spielt es keine Rolle«, ergänzte sie. »Es ist mir sogar lieber. Reiche Mädchen sind das Letzte.«
»Bist du denn keins?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Doch, aber ich bin anders. Ich glaube, deshalb haben sie uns zusammen in ein Zimmer getan.«
»Ach so. Gut.« Ich schwitzte entsetzlich.
»Und du? Warum bist du hier? Warum wolltest du auf diese Schule gehen?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht. Iron Mountain ist doch eine gute Schule, oder nicht?«
Noch nie war mir jemand mit Madisons direkter Art begegnet. Was sie von sich gab, war so unsäglich, dass sie eigentlich nicht ungeschoren hätte davonkommen dürfen. Aber sie kam irgendwie damit durch, weil ihre Augen so blau waren und sie nicht zu scherzen schien.
»Ja, vermutlich. Aber was versprichst du dir von dieser Schule?«
»Kann ich mal meine Tasche abstellen?«
In meinem Gesicht bildeten sich Schweißperlen und begannen mir den Nacken hinunterzurollen. Vorsichtig nahm Madison meine Tasche und stellte sie auf den Fußboden. Dann zeigte sie auf mein noch nicht bezogenes Bett, und ich setzte mich hin. Sie nahm neben mir Platz, näher als mir lieb war.
»Was willst du mal werden?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht. Himmel! Wie soll ich das wissen?«, entgegnete ich. Gleich wird sie mich küssen, dachte ich.
»Meine Eltern erwarten Toppnoten von mir. Ich soll an der Vanderbilt Universität studieren, den Präsidenten einer Uni heiraten und wunderschöne Babys zur Welt bringen. Daran hat mein Dad keinen Zweifel gelassen. Es ist uns ein Herzensanliegen, dass du den Präsidenten einer Uni heiratest. Kommt natürlich nicht infrage.«
»Warum nicht?« Wenn der Präsident sexy wäre, würde ich mit beiden Händen nach dem Leben greifen, das sich Madisons Eltern für ihre Tochter ausmalten.
»Ich möchte Macht haben. Ich will Großes bewegen. Alle sollen mir so verpflichtet sein, dass sie ihre Schuld niemals abtragen können. Ich will ein so wichtiges Tier werden, dass ich nie bestraft werde, selbst wenn ich Gott weiß was anstelle.«
Bei diesen Worten sah sie geistig gestört aus. Ich hätte am liebsten mit ihr rumgemacht. Sie warf ihr Haar auf eine Weise zurück, dass es nur instinktiv sein konnte. Evolution, dachte ich.
»Dir kann ich das gestehen, glaube ich.«
»Warum das?«
»Du hast keinen Cent, oder? Trotzdem bist du hier. Dir geht es auch um Macht.«
»Ich will nur zur Schule gehen, um aus meinem Elend rauszukommen«, erwiderte ich, hatte aber das Gefühl, dass sie nicht ganz danebenlag. Irgendwann würde ich haben wollen, was sie aufgezählt hatte. Macht könnte mich auch locken.
»Ich glaube, wir werden Freundinnen sein«, sagte sie, »wenigstens hoffe ich es.«
»Mein Gott«, stieß ich hervor. Mit Mühe gelang es mir, nicht in Krämpfe zu verfallen. »Das hoffe ich auch.«
Wir wurden tatsächlich Freundinnen. So könnte man, glaube ich, unser damaliges Verhältnis bezeichnen. Sie musste ihre sonderbare Art unter Kontrolle halten, weil es bei den Menschen Angst auslöst, wenn eine schöne Frau aus der Rolle fällt, sich hässlich macht. Auch ich musste meine Eigenarten in Schach halten, weil man mich als finanziell unterstützte Schülerin sowieso im Verdacht hatte, irgendwie abartig zu sein. Einige Tage später kam die andere Stipendiatin, die aus der Nachbarstadt stammte, zu mir und bat mich: »Bitte sprich nicht mit mir, solange wir hier zur Schule gehen.« Sie wollte mich nicht kränken, und ich stimmte gleich zu. Es war besser so.
Weil wir uns in der Öffentlichkeit unbedingt zusammennehmen mussten, war es herrlich, wenn wir in unserem gemeinsamen Reich Bilder von Bo und Luke Duke ausschneiden konnten, um damit über unsere Körper zu reiben. Es war auch herrlich, wenn Madison laut davon träumte, sie würde Juristin werden und den schlimmsten Übeltäter der Welt auf den elektrischen Stuhl bringen. Ich wollte als Erwachsene jeden Morgen einen Riegel Milky Way zum Frühstück essen. Sie fand das besser, als Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden, worauf sie irgendwie aus war.
Wir spielten auch im Basketballteam mit, die ersten Schulanfänger seit vielen Jahren. Die Schulmannschaft war durchaus ernst zu nehmen, sie hatte gegen mehrere Landesteams gewonnen. Basketball und Mountainbike gehörten in Iron Mountain unbedingt dazu. Ich hatte den Verdacht, dass sich eine Teilnahme an diesen Sportarten für die Mädchen vorteilhaft bei der Bewerbung um einen Studienplatz auswirkte. Es gab aber auch Schülerinnen wie mich, denen es einfach Spaß machte, ihre Power über Schwächere auszuleben. Ich war Point Guard, und Madison, die so verdammt lang war, Power Forward. Wir verbrachten viel Zeit in der Halle, übten ganz für uns allein Sprints übers ganze Spielfeld und Würfe mit der schwächeren Hand. Ich war schon immer eine gute Spielerin gewesen, aber mit Madison im Team steigerte ich mich noch. Ich lernte das ganze Spielfeld zu erfassen, ohne dass ich dazu meine Augen brauchte. Madison war so schön, ich fand sie, ohne hinsehen zu müssen. Wir waren Magic und Kareem. Unseren Trainer flehten wir an, schwarze Basketballstiefel tragen zu dürfen, aber er lehnte es ab.
»Herrgott, Mädchen, ihr führt euch auf wie New Yorker Playground-Legenden. Passt lieber auf, dass ihr kein Foul macht oder den Ball verliert.«
Manchmal setzte sich Madison ab, aber das nahm ich nicht persönlich. Wäre ich ein anderer Mensch gewesen – ich spreche nicht von Geld –, hätte ich zu ihrer Clique gehören können, aber ich war nicht interessiert. Sie und die anderen Schönheiten saßen beim Lunch zusammen. Manchmal verließen sie heimlich das Schulgelände, um sich in einer Bar beim College für Experimentelle Kunst von Jungs anbaggern zu lassen. Gelegentlich kauften sie Kokain von einer zwielichtigen Gestalt namens Panda. Es kam vor, dass Madison erst gegen drei Uhr morgens in unserem Zimmer aufkreuzte. Irgendwie schaffte sie es immer wieder, an der Schlafsaalaufsicht vorbeizukommen. Dann setzte sie sich auf den Fußboden und leerte eine riesige Flasche Wasser. »Mein Gott, wie sehr ich mich dafür verachte, so wenig originell zu sein.«
»Es sieht so aus, als würde es Spaß machen«, log ich.
»Manchmal ja«, sagte sie, die Pupillen bis zum Anschlag geweitet. »Aber das geht sowieso alles vorbei.«
Der Unterricht war komplizierter als im Tal, der Stoff jedoch nicht sonderlich schwierig. Ich bekam glatte Einser. Madison auch. Bei einem Lyrikwettbewerb schaffte ich es mit einem Gedicht über das Heranwachsen in Armut auf den ersten Platz. Madison hatte mir geraten, über das Thema zu schreiben, nachdem ich ihr mein erstes Gedicht über eine doofe Tulpe gezeigt hatte.
»Setze sie zum richtigen Zeitpunkt gezielt ein«, hatte sie gesagt, womit sie, glaube ich, meine schreckliche Kindheit meinte. »Dann kannst du eine Menge herausschlagen.« Ich glaube, ich habe sie verstanden. Ich meine, immerhin befand ich mich in Iron Mountain, und es ging mir prima. Madison schlief manchmal in meinem Bett, wir hielten uns eng umschlungen. Mein Leben hatte seine guten Seiten, und ich bekannte mich ziemlich mühelos zu meiner Herkunft, war ich doch inzwischen genau dort angekommen, wo ich eigentlich hingehörte.
Und dann ärgerte sich eine von Madisons schönen Freundinnen – wenn man gemein sein will, die am wenigsten hübsche – über einen Witz, den Madison in einem unbesonnenen Moment über sie riss. Das Mädchen verpetzte Madison, und so wurde das Kokain in der Schublade ihres Schreibtischs gefunden. Madison blieb jedoch optimistisch. Iron Mountain ist eine Schule für Leute mit Geld und hängt von ihnen ab, meinte sie eines Abends bei mir im Bett, als wir ihre Lage erörterten. Deshalb wird man ein Auge zudrücken. Ich hingegen sah die Sache so, dass eine Schule wie Iron Mountain manchmal auch bei einer wohlhabenden Schülerin hart durchgriff, um das Vertrauen anderer reicher Eltern zu gewinnen.
Das Schuljahr neigte sich seinem Ende zu. Bis zu den jährlichen Abschlussprüfungen waren es nur noch wenige Wochen. Die Schulleitung, nicht mehr der Brite, sondern eine Ms Lipton, die aus den Südstaaten kam, einen rötlichbraunen Hosenanzug trug und weißes Haar hatte, das ihr wie eine Eierschale um den Kopf lag, bestellte Madison mit ihren Eltern zu sich ins Büro – schriftlich, auf dem offiziellen Briefbogen der Schule. Die unverheiratete Ms Lipton sprach ihre Schülerinnen übrigens mit »Tochter« an.
Madisons Vater traf am Abend vor dem Gespräch ein. Ihre Mutter käme nicht mit, hatte er zu Madison am Telefon gesagt, sie wäre »zutiefst enttäuscht« von ihrer Tochter. Es berührte mich seltsam, dass er Madison und mich zum Essen einladen wollte. Er holte uns in einem fabrikneuen Jaguar ab und war älter, als ich erwartet hatte. Wenn er mich ansah und mir dabei zuzwinkerte, erinnerte er mich an Andy Griffith. Mit einem »Hallo, Mädchen!« öffnete er die Autotür. Er ließ die leise vor sich hin brummende Madison schnell einsteigen, auf mich wartete eine Begrüßung mit Handkuss.
»Madison hat mir viel von Ihnen erzählt, Miss Lillian.«
»So«, sagte ich. Erwachsenen gegenüber fehlte es mir immer noch an Selbstbewusstsein. Ich dachte, dass er womöglich mit mir ins Bett wollte.
Wir fuhren zu einem Steakhaus, wo er einen Vierertisch reserviert hatte, wie er unterwegs ankündigte. Und da sah ich auch schon meine Mutter. Für ihre Verhältnisse hatte sie sich in Schale geworfen, aber für das Steakhaus reichte es nicht wirklich.
»Einen Drink, Ma’am?«
Sie verlangte einen Gin Tonic. Er trank einen Bourbon pur. Als wären wir im Handumdrehen eine neue Familie geworden. Ich sah ständig zu Madison hinüber, suchte nach einem Hinweis darauf, ob sie so angepisst war wie ich, aber sie wich meinem Blick aus und studierte die Speisekarte von oben nach unten und wieder zurück.
»Ich freue mich, dass Sie Madison und mir heute Abend Gesellschaft leisten«, kam es von Mr. Billings, nachdem er das Essen für uns bestellt hatte. Meine Mutter hatte ein Filet für fünfundzwanzig Dollar gewählt, ich Bandnudeln, das billigste Gericht auf der Karte. Sosehr ich mir das Gehirn zermartere, ich habe keine Ahnung mehr, was Madison und ihr Vater aßen.
»Danke für die Einladung«, sagte meine Mutter. Sie hatte es schwer im Leben, und sie rauchte zu viel, aber in der Highschool war sie Cheerleader und Schönheitskönigin gewesen. Sie sah immer noch nicht schlecht aus, das musste ich ihr lassen, nur leider hatte sie ihr gutes Aussehen nicht an mich weitergegeben. Ich konnte mir mühelos vorstellen, dass sie Mr. Billings für eine Nacht ins Bett kriegen konnte.
»Bedauerlicherweise ist der Grund für unser Treffen weniger erfreulich«, fuhr er fort und ließ seine Augen auf Madison ruhen, die nun das Tischtuch fixierte. »Madison sitzt in der Klemme. Sie ist ein Dickschädel. Ich habe fünf Kinder. Madison, die Jüngste, macht mir mehr Sorgen als die vier anderen zusammen.«
»Vier Jungen!«, brauste Madison auf.
»Madison hat einen Fehler gemacht, und dafür wird sie bestraft werden. Zumindest glaube ich, dass es morgen Vormittag um ihre Strafe gehen wird. Deshalb wollte ich hier mit Ihnen und Lillian reden.«
»Paps«, setzte Madison an, erstarrte aber unter seinem strengen Blick.
»Hat Lillian etwas angestellt?«, fragte meine Mutter. Sie war bereits beim zweiten Gin.
»Nein, Verehrteste«, fuhr Mr. Billings fort. »Lillian hat sich vorbildlich benommen, seit sie in Iron Mountain ist. Sie sind sicherlich mächtig stolz auf sie.«
»Bin ich«, sagte meine Mutter, aber es klang eher wie eine Frage.
»Die Dinge liegen folgendermaßen. Ich bin Geschäftsmann und gewöhnt, eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ich erfasse alle Möglichkeiten. Meine Frau hat sich geweigert mitzukommen. Sie meint, Madison muss ihre Strafe auf sich nehmen und danach das Beste aus ihrem Leben machen. Aber meine geliebte Frau hat die Folgen eines Schulverweises nicht bis in die letzte Konsequenz durchdacht. Die Auswirkungen auf Madisons Zukunft sind vielfältiger, als ich aufzählen kann.«
»Nun ja, Kinder machen halt Fehler«, ließ sich meine Mutter vernehmen. »Es ist ihre Art zu lernen.«
Mr. Billings Lächeln verrutschte für den Bruchteil einer Sekunde. Dann fasste er sich. »Ganz richtig. Sie lernen. Ihnen unterläuft ein Fehler, und dann lernen sie, ihn nie wieder zu begehen. Aber in Madisons Fall wird es keine Rolle spielen, dass sie ihn nie wieder machen wird. Ihr Schicksal ist bereits jetzt für alle Zeiten besiegelt. Und deshalb wollte ich Ihnen ein Angebot unterbreiten.«
Da wusste ich es! Genau in jenem Moment ging mir ein verdammtes Licht auf. Ich ärgerte mich schwarz, dass ich den Braten nicht schon ein paar Stunden früher gerochen hatte. Ich sah Madison an, und natürlich mied sie meinen Blick. Ich packte sie unter dem Tisch am Arm und umklammerte ihn, als wolle ich ihn abquetschen, aber sie zuckte noch nicht einmal.
»Was für ein Angebot?«, wollte meine Mutter wissen, angetrunken, aber hellhörig geworden.
»Ich bin davon überzeugt, dass die Direktorin den Fall nachsichtiger beurteilen würde, wenn es sich nicht gerade um Madison handelte. Ihre Tochter ist ein rechtschaffenes Mädchen und hat es weit gebracht, obwohl sie keinen guten Start im Leben hatte. Ich schätze, sie würde nur pro forma bestraft werden, maximal, sagen wir, mit einem Schulverweis von einem Semester.«
»Warum das?«, wollte meine Mutter wissen, und ich hätte sie am liebsten ins Gesicht getreten. Wenn sie nur nüchtern gewesen wäre. Andererseits, es war sowieso alles egal.
»Es ist kompliziert, meine Gnädige. Ich bin jedoch überzeugt, wenn Sie beide morgen in das Büro dieser Frau gehen würden und Lillian gestehen würde, dass die Drogen in Wirklichkeit ihr gehören, würde sie nicht groß zur Rechenschaft gezogen.«
»Davon kann man nicht unbedingt ausgehen«, erwiderte meine Mutter. Vielleicht war sie doch nicht so betrunken, wie ich befürchtet hatte.
»Zugegeben, ein Restrisiko bleibt, das räume ich gerne ein, deshalb bin ich bereit, Sie für Ihre Mühe zu entschädigen. Dieser Scheck über zehntausend Dollar ist auf Sie ausgestellt, Ms Breaker. Der Betrag dürfte für Miss Lillians weitere Ausbildung nützlich sein und auch einen Teil Ihrer eigenen Unkosten decken.«
»Zehntausend Dollar?«, wiederholte meine Mutter.
»Richtig«.
»Mutter!«, begehrte ich im selben Moment auf, wie Madison »Paps!« sagte. Beide fuhren uns jedoch über den Mund. In diesem Augenblick sah Madison mich an. Selbst in dem gedämpften Licht des beschissenen Restaurants waren ihre Augen tiefblau. Es war ein seltsames Gefühl, jemanden zu hassen und gleichzeitig zu lieben. Ob dieser Zustand für Erwachsene normal war?
Mr. Billings und meine Mutter setzten ihre Unterhaltung fort. Das Essen wurde gebracht. Madison und ich rührten unsere Teller nicht an. Ich hatte meine Ohren auf Durchzug gestellt. Madison griff unter dem Tisch nach meiner Hand und hielt sie fest, bis ihr Vater die Rechnung bezahlt hatte. Er geleitete uns aus dem Restaurant. Sein Scheck steckte in der Handtasche meiner Mutter.
An der Tür des Gebäudes, in dem wir untergebracht waren, lieferte er uns ab, und wir meldeten uns bei der Aufsicht zurück. Als wir uns für die Nacht fertig machten, fragte Madison, ob sie bei mir schlafen konnte. Ich schickte sie zum Teufel, dann putzte ich mir die Zähne. Während sie auf ihrem Bett saß und Shakespeare für eine Arbeit las, die sie nun doch würde schreiben müssen, weil sie bleiben durfte, packte ich meine Reisetasche. Wieso passte jetzt weniger hinein als vorher? Und was sollte aus mir werden? Ich legte mich ins Bett und knipste das Licht aus. Wenige Minuten später löschte Madison ebenfalls ihr Licht. Wir lagen in der Dunkelheit, und keine von uns sagte ein Wort. Nach wer weiß wie vielen Minuten kam Madison leise in meine Zimmerhälfte und stellte sich an mein Bett. Sie war meine einzige Freundin. Ich rückte zur Seite, und sie kroch zu mir. Sie legte ihre Arme um mich, ich konnte ihre Brust an meinem Rücken fühlen. »Es tut mir leid«, sagte sie. Ich habe nur »Madison« herausgebracht. Meine Hoffnung auf ein anderes Leben würde nicht in Erfüllung gehen. Oder es würde schwieriger sein, mein Ziel zu erreichen, sollte sich mir eine zweite Chance bieten. »Du bist meine Freundin«, sagte sie, aber ich konnte nur noch schweigen. Ich lag still da, irgendwann schlief ich ein. Morgens, als die Schlafsaalaufsicht an die Tür klopfte, um mir zu sagen, dass meine Mutter draußen auf mich wartete, sah ich, dass Madison irgendwann in der Nacht zurück in ihr eigenes Bett gegangen war.
Die Direktorin schien zu wissen, dass ich log. Sie versuchte mehrmals, mich umzustimmen, aber meine Mutter fiel mir ständig ins Wort und ritt darauf herum, wie schwer ich es gehabt hätte. So flog ich von der Schule. Meiner Mutter war es gleichgültig. Bis zu jenem Tag hatte ich noch nicht einmal ihre Zigaretten angerührt, und nun flog ich, weil ich angeblich Drogen genommen hatte! Ich hatte das Gefühl, alles im Leben falsch zu machen.
Als ich meine Tasche aus dem Zimmer holte, war Madison nicht da. Auf der Fahrt hinunter ins Tal sprach meine Mutter davon, etwas von dem Geld für mein College zur Seite zu legen, aber ich wusste, dass davon bereits nichts mehr vorhanden war. Es hatte sich in dem Augenblick in Luft aufgelöst, als sie den Scheck in Händen hielt.
Vier Monate später traf ein Brief von Madison bei mir ein. Darin erzählte sie von ihren Sommerferien in Maine und den letzten schrecklichen Wochen in der Schule ohne mich. Ich sollte sie in Atlanta besuchen, das wünschte sie sich von ganzem Herzen. Auf das, was mir zugestoßen war, was ich für sie getan hatte, ging sie mit keinem Wort ein. Sie erwähnte einen Jungen, den sie in Maine kennengelernt hatte, und zählte auf, wie weit er bei ihr gehen durfte. Ich hörte ihre Stimme, als ich den Brief las. Es war eine hübsche Stimme. In meiner Antwort ging ich nicht auf die unsägliche Scheiße ein, die jetzt zwischen uns stand. Wir wurden Brieffreundinnen.
Ich ging zurück auf meine grässliche öffentliche Schule, bewegte mich wieder auf der Höhe des Meeresspiegels, nachdem ich ein Jahr auf dem höchsten Gipfel verbracht hatte. Alle Lehrer, alle Schüler, jeder Einwohner unserer Stadt hatte mitgekriegt, dass ich hochkant aus dem Internat geflogen war. Man wusste von dem Kokain, und dass ich die Chance meines Lebens verspielt hatte. Man schmückte den Vorfall aus, damit alles noch schlimmer klang. Von allen Seiten hagelte es Vorwürfe. Die Leute waren sauer und fragten sich, wie sie jemals auf die Scheißidee kommen konnten, dass jemand wie ich es auf einer solchen Schule schaffen könnte? Ich war abgeschrieben. Von weiterführenden Schulen oder Stipendien war keine Rede mehr. Man machte mich zu einem Geist, zum warnenden Beispiel. Nur, wem würde meine Geschichte Angst einjagen? Wer würde sie sich anhören?
Der Unterricht in der öffentlichen Schule war kinderleicht, und kein Mensch scherte sich darum, was aus mir wurde. Ich verlor jegliches Interesse, jobbte nach dem Unterricht und half meiner Mutter auf ihren Putzstellen. Solange ich nicht mitmachen musste, trieb ich mich mit Jungen und Mädchen herum, die kifften und Tabletten nahmen. Als sie mich nicht mehr in Ruhe ließen, besorgte ich mir Hasch auf eigene Faust. Das rauchte ich alleine auf unserer hinteren Veranda, und meine Welt wurde immer flacher. An die Zukunft verschwendete ich keinen Gedanken mehr, es ging ausschließlich darum, wie ich die Gegenwart erträglicher machen konnte. Das war mein Leben.
Als wir uns dem Anwesen näherten, sah ich nur Grün und einen scheinbar kilometerlangen Zaun. Was der Zaun sollte, verstand ich nicht, denn er hat niemanden ein- oder ausgesperrt. Er stand nur dekorativ in der Landschaft. Dann ging mir ein Licht auf! Wenn man superreich war, konnte man sich dekorative Gesten leisten. Ich ermahnte mich, meinen Verstand einzuschalten. Grips hatte ich nämlich. Er lag nur unter einer dicken Schicht von Dummheit begraben, die sich auf mir abgesetzt hatte. Doch wenn es darauf ankam, steckte noch Feuer in mir. Ich würde dazulernen. Mochte Madison besitzen, was sie wollte, ich würde locker gleichziehen.
Die dämliche Zufahrt zum Haus schien nicht enden zu wollen und sah aus, als würde sie direkt zum Himmelstor führen, so gepflegt war sie. Selbst wenn an ihrem Ende eine heruntergekommene Pizzabude mit vergitterten Fenstern gestanden hätte, wäre man noch begeistert gewesen.
»Fast da«, sagte Carl.
»Wie läuft das hier mit der Post?«
»Wie meinen Sie das?«
»Muss man die ganze Strecke zum Briefkasten laufen? Oder gibt es eine Art Golfmobil? Oder ist jemand dafür zuständig, die Post zu holen?«
Ich fragte nicht, ob es seine Aufgabe war, die Post zu holen, hatte aber das Gefühl, er wusste, dass ich genau darauf abzielte.
»Der Postbote kommt bis an das Eingangsportal«, erklärte er.
»Ach so.«
Vor meinem geistigen Auge sah ich Madison mit einem Becher Eistee in der Hand, wie sie geduldig darauf wartete, dass der Postbote sich die Auffahrt hinaufschleppte, um ihr den Brief zu bringen, in dem ich ihr meine Idee für eine Knöcheltätowierung erklärte.
Schon oft hatte ich versucht, mir Madisons Haus vorzustellen. Ich hatte sie schlecht um ein Foto bitten können, so nach dem Motto: Du, ich kann mühelos ohne ein weiteres Bild von deinem Teddysöhnchen leben, aber bitte schick mir eine Aufnahme von jedem Raum in deinem Landsitz. Auf den Bildern, die ich erhielt, konnte ich Teile ihres Hauses ausmachen, es sah nach viel Geld aus und war sehr gepflegt. Vielleicht hätte ich den ganzen Prachtbau sehen können, wenn ich alle Fotos zerschnitten und die Gebäudeteile zusammengefügt hätte. Manchmal hatte ich mir einfach eingebildet, dass Madison im Weißen Haus wohnte. Damals machte das Sinn für mich. Madison lebte in dem bescheuerten Weißen Haus.
Während wir durch den Park fuhren, bildete sich ein Knoten in meiner Kehle, und fast hätte ich nach Carls Hand gegriffen. Das Gebäude vor uns hatte drei Stockwerke, vielleicht noch mehr. Ich konnte meinen Hals nicht hoch genug recken, um das Dach zu sehen. In jenem Moment wusste ich nur, dass es bis in den Weltraum reichte. Die Fassade war blendend weiß, ohne Spuren von Verwitterung oder Schmutz. Ein Haus, wie man es im Traum baut. Rundum führte eine Veranda. Wenn man sie entlangschritt, bildete man sich wahrscheinlich ein, dass sie mehrere Kilometer lang war. Auf Wohlstand war ich gefasst gewesen, aber mein bisheriges Leben hatte mich eindeutig schlecht auf wahren Reichtum vorbereitet. Schwamm Madisons Mann wirklich so im Geld? Er hatte keinen Computer erfunden und besaß auch kein Fast-Food-Imperium. Dennoch repräsentierte dieses Haus das ganz große Geld. Geld, das ihm auch Madison in den Schoß gelegt hatte. Plötzlich stand sie im Eingang. Sie winkte mir zu und war so schön, dass ich wusste, ich würde mich jedes Mal für sie entscheiden, müsste ich zwischen ihr und dem Haus wählen.
Carl umrundete das Rondell mit dem Brunnen vor dem Haus und hielt genau am Eingangsportal. Er sprang bei laufendem Motor aus dem Fahrersitz und öffnete meinen Schlag. Ich konnte jedoch nicht aufstehen. Meine Beine verweigerten den Dienst. Plötzlich kam Madison mit ausgebreiteten Armen die Freitreppe herunter, wie um mich aufzufangen. Es gelang mir aber immer noch nicht, denn ich war überzeugt, wenn ich nur einen Muskel bewegte, würde sich alles in Luft auflösen, ich würde auf meinem Futon aufwachen und die Klimaanlage wäre mal wieder kaputt. Carl musste mich schließlich wie eine Stoffpuppe zu Madison schleifen, als wäre ich ein Geburtstagsgeschenk für sie, und dann plumpste ich in ihre Arme. Groß und stark hielt sie mich, bis ihr Duft mich erreichte und ich mich an uns beide im Bett in jenem Zimmer in der Schule erinnerte. Ich war in der Wirklichkeit angekommen. Über zehn Jahre hatte ich Madison nicht gesehen, aber sie sah aus wie eh und je. Leicht gebräunt und mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen. Sie wirkte weder wie ein Roboter noch als hätte sie keine Seele.
»Du siehst wunderschön aus«, begrüßte sie mich, und ich glaubte ihren Worten.
»Und du siehst aus wie ein Supermodel.«
»Wäre ich das nur, dann hätte ich einen Terminkalender, in dem sich alles nur um mich drehen würde.«
Und so waren wir wieder vereint, ich, der schräge Vogel, und sie, wie sie mir soeben wieder gezeigt hatte, ebenfalls ein schräger Vogel.
Carl sah auf seine Armbanduhr, verbeugte sich knapp, sprang zurück in sein Auto und fuhr davon. Wir hätten den Rest des Tages damit verbringen können, ihm hinterherzublicken. Ich wartete darauf, dass sich sein Auto in einen Kürbis verwandelte und er zu einer Maus wurde. Eingestimmt auf das Wirken magischer Kräfte wusste ich, dass ich nicht enttäuscht werden würde.
»Hier draußen ist es heiß«, sagte Madison. »Gehen wir hinein.«
»Gehört das Haus euch?«
»Neben etlichen anderen.«
Sie zog die Nase kraus, in ihren Augen tanzten Lichter. Diese Sprache verstanden weder ihr Mann noch die Luxusfrauen, mit denen sie verkehrte. Alles war gut. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Ich auch nicht.