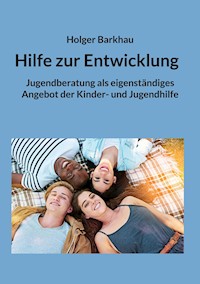
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Autor postuliert auf der Basis des Kinder- und Jugend-- hilfegesetzes die Etablierung von Jugendberatung als eigenständiges Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene in Abgrenzug zur Erziehungs- und Familienberatung. Praxisnah wird aufgezeigt, wie Jugendberatung realisiert werden kann, welche Voraussetzungen sie erfüllen sollte und welche Angebote sich bewährt haben. Der Autor geht weiterhin auf die Einbeziehung der Neuen Medien in die Beratung junger Menschen ein und beschreibt, wie Jugendberatung als reines Online-Angebot realisiert werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 2
Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
UN-Kinderrechtskonvention, Artikel 12
Inhalt
Einleitung
Jugendberatung als eigenständiges Beratungsangebot
1.1 Wozu überhaupt Jugendberatung?
1.2 Jugendliche suchen einen eigenen Raum
1.3 Hemmschwellen
1.4 Anforderungen an eine niedrigschwellige Jugendberatung...
1.5 Jugendberatung ja - aber in welchen Altersgrenzen?
1.6 Institutioneller Rahmen von Jugendberatung
Jugendberatung als Face-to-Face-Beratung
2.1. Der theoretische Rahmen
2.2 Das Team
2.3. Zugangsbedingungen
2.4 Settingbedingungen
2.5 Prozessuale Diagnostik
2.6 Beratungsverfahren
2.7 Öffentlichkeitsarbeit
2.8 Vernetzung
2.9 Zielgruppenbezogene Ansätze
2.10 Beratung in der Corona-Pandemie
Jugendberatung und Neue Medien
3.1 SMS, Messengerdienste
3.2 Soziale Medien
3.3 E-Mail
3.4 Telefonberatung
3.5 Videoberatung
3.6 Chatberatung
Online-Jugendberatung
4.1 Anonymität - Vor- und Nachteile
4.2 Mailberatung
4.3 Chatberatung
4.4 Foren
4.5 Einzelchat
4.6 Angebotsvielfalt
Schlusswort
Literaturverzeichnis
Kontakt
Danksagung
Einleitung
Zwei Zahlen:
1977 - in diesem Jahr wurde in Braunschweig im Rahmen eines vom Bund geförderten Modellprojektes eine Jugendberatung ins Leben gerufen - die Jugendberatung bib. bib stand und steht auch heute noch für „Beratung und Information für junge Menschen in Braunschweig“. Die Jugendberatung - damals zunächst lediglich ausgestattet mit einer hauptamtlichen Personalstelle für einen Diplom-Psychologen - war ein neues Angebot eines gemeinnützigen Trägervereins. Dieser Verein mit dem heutigen Namen BEJ („Beratung für Familien, Erziehende und junge Menschen e.V.“) war und ist der Trägerverein für drei Erziehungs- und Familienberatungsstellen in Braunschweig und Gifhorn sowie für die Jugendberatung bib. Der hauptsächliche Grund für das neue Beratungsangebot war die Beobachtung, dass Jugendliche und junge Erwachsene nur sehr selten von sich aus eine der Beratungsstellen des Vereins aufsuchten. Dies sollte sich ändern - und dies hat sich geändert: Etwa 450 Jugendliche und junge Erwachsene nahmen in den Vor-Coronajahren jährlich das Angebot der Jugendberatung bib wahr. Nach einem pandemiebedingten Einbruch steigen die Zahlen der Klientinnen und Klienten seit geraumer Zeit wieder an. Knapp zwei Drittel der Ratsuchenden sind weiblich, ein gutes Drittel ist noch minderjährig. Jugendberatung als eigenständiges Angebot der Jugendhilfe wurde und wird benötigt und in Anspruch genommen. Diese Erkenntnis verfestigte sich nach der Modellphase und führte dazu, dass die Jugendberatung bib zu einem festen Bestandteil der Braunschweiger psychosozialen Landschaft geworden ist.
37 Jahre: So lange durfte ich in der Jugendberatung bib mit jungen Klient*innen arbeiten. Diese Aufgabe war für mich Beruf und Berufung, die Beratung junger Menschen war spannend, anregend, wichtig, befriedigend, sinnstiftend - vom ersten bis zum letzten Tag. Nun bin ich in den Ruhestand eingetreten - und meine Beiträge in diesem Buch sind Teil meiner beruflichen Lebensbilanz. Damit verbinde ich die Hoffnung, in anderen Kommunen zu ähnlichen Beratungsangeboten und Settings für junge Menschen ermutigen zu können. Es lohnt sich - für die betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen und für die psychosoziale Gesundheit im Gemeinwesen.
Das Thema dieses Werkes ist „Jugendberatung“ oder genauer „Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen“. Welche Angebote der Beratung und Unterstützung benötigen junge Menschen? Welche Rahmen- und Settingbedingungen haben sich bewährt? Was trägt dazu bei, dass junge Menschen sich von Beratungsangeboten angesprochen fühlen und diese auch in Anspruch nehmen? Wie kann der Vielfalt junger Menschen durch ein flexibles und vielfältiges Unterstützungsangebot Rechnung getragen werden? Diesen Fragen soll nachgegangen werden.
„Hilfe zur Entwicklung“ - das ist der Titel dieser Ausarbeitung. Der Titel steht bewusst im Kontrast zur Formulierung in § 27 SGB VIII, nämlich der „Hilfe zur Erziehung“. Es geht in diesem Werk um junge Menschen als Subjekte von Veränderung: Menschen, die sich entwickeln wollen, die Ziele, Wünsche, Ansprüche und Träume hinsichtlich ihres Lebens in unserer Gesellschaft haben. Menschen, die auf ihrem Weg auf Widerstände, Probleme und Aufgaben stoßen und bei deren Bewältigung Hilfe und Unterstützung suchen. Diesen jungen Menschen sollten passende Beratungsangebote zur Verfügung stehen, die das Ziel verfolgen, bei der persönlichen Entwicklung Hilfestellung zu leisten - eben „Hilfe zur Entwicklung“. Selbstverständlich ist dabei, dass diese „Entwicklungshilfe“ zwar auf den einzelnen ratsuchenden jungen Menschen ausgerichtet ist, diesen jedoch immer im Kontext seiner sozialen und gesellschaftlichen Umgebung betrachtet - im Spannungsfeld zwischen individueller Persönlichkeitsentfaltung und sozialer Bezogenheit.
In Kapitel 1 wird dargelegt, weshalb es sinnvoll und geboten ist, eigenständige Beratungsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene vorzuhalten. Dabei wird auch Bezug genommen auf die rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen.
Kapitel 2 befasst sich mit der Theorie und der konkreten Praxis von Jugendberatung: Welche Beratungsansätze werden verfolgt, wie funktioniert die Zusammenarbeit im Team, wie können „jugendfreundliche“ Zugangsbedingungen hergestellt werden, welche Settingbedingungen haben sich bewährt, welche Angebote sind hilfreich und notwendig, was ist notwendig für eine gute Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit?
In Kapitel 3 wird auf die Einbeziehung neuer Medien in die Beratungsarbeit mit jungen Menschen eingegangen. Die verstärkte Nutzung des Internet für die Beratung kann die Face-to-face-Beratung nicht ersetzen, sie kann jedoch eine sinnvolle Bereicherung des Beratungsprozesses darstellen.
Schließlich geht es in Kapitel 4 um eine spezielle Zugangsform zur Beratung junger Menschen: der anonymen Online-Jugendberatung und den mit ihr verbundenen Chancen und Risiken.
Eine Anmerkung noch: An verschiedenen Stellen des Buches werden Klient*innen namentlich erwähnt. Die angeführten Beispiele und Aussagen sind authentisch - die Namen wurden jedoch verändert und die Kontexte nicht dargestellt oder verfremdet, so dass keine Rückschlüsse auf die realen Personen möglich sind.
1. Jugendberatung als eigenständiges Beratungsangebot
1.1 Wozu überhaupt Jugendberatung?
Man stelle sich vor:
Auf einer Kreuzung stoßen zwei Autos zusammen. Um den Sachverhalt zu klären, gibt es die Regel, dass beide Parteien denselben Rechtsanwalt aufsuchen. Der soll dann die für beide beste Lösung herausfinden.
Die Mitarbeiter*innen einer Firma wollen, dass sie nach einem Tarifvertrag entlohnt werden. Außerdem möchten sie einen Betriebsrat wählen. Der Arbeitgeber will Beides verhindern, weil er höhere Kosten und mehr Unruhe im Betrieb befürchtet. Es wird ein/e Mediator*in eingesetzt, der/die die Aufgabe hat, eine von beiden Seiten akzeptierte Lösung zu vermitteln.
Bei Bundesligaspielen wird der Videobeweis wieder abgeschafft. Stattdessen moderiert der Schiedsrichter ein Gespräch zwischen den beiden Mannschaftskapitänen, bis sich alle darauf einigen, ob es nun den Elfmeter gibt oder nicht.
Klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es auch.
Bei Konflikten des Alltags wird selbstverständlich davon ausgegangen, dass es unterschiedliche Perspektiven und Interessen gibt. Es ist auch nicht anrüchig, wenn eine Rechtsanwältin parteilich ist oder ein Schiedsrichter eine Entscheidung aufgrund objektiver Kriterien trifft.
In der Jugendhilfe ist das (noch) anders: Es wird nicht klar formuliert, dass Kinder, Jugendliche und ihre Eltern durchaus sehr unterschiedliche Perspektiven und Interessen haben können. Stattdessen haben Personensorgeberechtigte „bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 SGB VIII).
Die Personensorgeberechtigten haben also den Anspruch auf Hilfe - und die Kinder und Jugendlichen selbst?
Im neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist klar formuliert:
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs.1 SGB VIII).
„Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,
2. jungen Menschen ermöglichen oder erleichtern, entsprechend ihrem Alter und ihrer individuellen Fähigkeiten in allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt zu interagieren und damit gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können“ (§ 1 Abs. 3 SGB VIII).
„Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Beratung ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten, solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der Beratungszweck vereitelt würde“ (§ 8 Abs.3 SGB VIII).
Seit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen“ (KJSG) vom 3.6.2021 „erhalten Kinder und Jugendliche durch den Wegfall der Voraussetzung des Vorliegens einer Not- und Konfliktlage … nunmehr einen uneingeschränkten Anspruch auf Beratung der Kinder- und Jugendhilfe auch ohne Kenntnis ihrer Personensorgeberechtigten“ (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/26107, S.73). „Der bedingungslose Beratungsanspruch ermöglicht somit einen niedrigschwelligen Zugang für Kinder und Jugendliche zur Beratung …“ (ebenda). Weiter heißt es dort: „Der Anspruch nach § 8 Abs. 3 SGB VIII ist grundsätzlich von demjenigen Jugendamt bzw. Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu erfüllen, an den sich ein Kind oder Jugendlicher wendet“ (ebenda). Ferner wird ausgeführt, „dass der Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Anspruch eines Kindes oder Jugendlichen auf Beratung auch mittels Leistungserbringung durch einen Träger der freien Jugendhilfe erfüllen kann“ (ebenda). Durch den Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern der freien Jugendhilfe „soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe eine niedrigschwellige unmittelbare Inanspruchnahme der Beratung zulassen bzw. ermöglichen“ (ebenda).
Hinsichtlich der Beratung ohne Kenntnis der Eltern führen Wiesner u.a. aus: „Wie bisher ist das Recht des Kindes auf Wahrung der Vertraulichkeit persönlicher Informationen (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG) mit dem Interesse der PerSorgeBer (Personensorgeberechtigten, d. Verf.) an der Kenntnis dieser Informationen (Art 6 Abs. 2 S. 1 GG) abzuwägen (…). Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind in diese Abwägung zwingend einzubeziehen, da es sich auch bei der Information der PerSorgeBer um eine Entscheidung iSd Abs. 1 handelt, an der die Betroffenen zu beteiligen sind. Der Wunsch des Kindes oder Jugendlichen, einen Beratungsprozess unabhängig von den PerSorgeBer durchzuführen, ist als Ausdruck der wachsenden Eigenständigkeit alters- und reifeangemessen zu berücksichtigen.
Vereitelt wird der Beratungszweck nicht nur, wenn dem Kind oder Jugendlichen negative Reaktionen ihrer Eltern oder anderer PerSorgeBer (Personensorgeberechtigten) drohen, sondern idR auch dann, wenn das betroffene Kind bzw. der/die Jugendliche den Beratungsprozess nach der Offenlegung nicht weiterführen würde, obwohl ein entsprechender Bedarf besteht. Der Bedarf wiederum ist wesentlich nach der subjektiven Einschätzung zu bestimmen, da der Beratungsanspruch eine Antwort auf die wachsenden Selbstbestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen darstellt (…). Die Bitte um vertrauliche Beratung begründet insofern regelmäßig die Vermutung ihrer Notwendigkeit. Unabhängig davon kann zu einem gelingenden Beratungsprozess auch gehören, über Möglichkeiten zu sprechen, ob und wie Eltern ggf. zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll einbezogen werden können“ (Wiesner/Wapler/Wapler, 2022, SGB VIII § 8 Rn. 44, 45).
Im gleichen Sinne erläutern Münder u.a.: „Die Beratung ohne Kenntnis (der Personensorgeberechtigten, d. Verf.) ist solange zulässig und kann beansprucht werden, wie das Interesse des Kindes oder des/der Jugendlichen an der Fortsetzung der Beratung unter Wahrung von Vertraulichkeit (Art. 2 Abs. 2 iVm Art.1 Abs. 1 GG) das Interesse der Personensorgeberechtigten (Art. 6 Abs. 2 GG) an der Kenntnis über die Beratung überwiegt. Die beratende Fachkraft ist zu Beginn und während des Verlaufs der Beratung zur Vergewisserung über die Voraussetzungen verpflichtet. Dabei sind die beraterisch-fachlichen Grundsätze bei Aufbau und Erhalt einer Vertrauensbeziehung zwischen dem Kind bzw. dem/der Jugendlichen und der Fachkraft zu achten“ (Münder, Meyser, Trenczek, 2022, S. 137). Hinsichtlich des Datenschutzes führen sie weiter aus: „Die in der Beratung bei einem Träger der freien Jugendhilfe vom Kind oder Jugendlichen anvertrauten Daten können grundsätzlich ebenfalls nur mit der Einwilligung des anvertrauten Kindes oder des/der Jugendlichen selbst weitergegeben werden; Kind oder Jugendlicher sind insoweit regelmäßig als einwilligungsfähig anzusehen“ (ebenda, S. 138). Analog gilt dies auch für die Datenweitergabe, wenn das Jugendamt selbst die Beratung durchführt: „Bei der Datenweitergabe sind die in der Beratung durch das JA (Jugendamt, d. Verf.) vom Kind oder Jugendlichen anvertrauten Informationen regelmäßig nach § 65 besonders geschützt und ist eine Weitergabe an die Eltern nur mit Einwilligung des Kindes oder Jugendlichen zulässig (…)“ (ebenda).
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Beratungszweck vereitelt würde, wenn in Folge einer Mitteilung an die Personensorgeberechtigten ein Beratungsabbruch, konflikthafte familiäre Auseinandersetzungen oder eine Kindeswohlgefährdung zu erwarten wäre. Insofern steht sowohl die Offenbarung der Tatsache als auch der Inhalte einer Beratung unter dem Vorbehalt der Einwilligung des betroffenen jungen Menschen.
Sicherlich gibt es auch Situationen, in denen die Personensorgeberechtigten von der Beratung - unter Umständen auch gegen den Willen des jungen Menschen - in Kenntnis gesetzt werden müssen. Dies trifft zum Beispiel im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung (z.B. bei Suizidgefahr oder sexuellem Missbrauch) zu, wenn unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. In diesen Fällen ist es wichtig, gegenüber dem/der Jugendlichen offen und transparent zu sein und in verständlicher Form zu begründen, weshalb der unmittelbare Handlungsbedarf besteht. In der Bundestagsdrucksache heißt es in diesem Zusammenhang: „Unberührt bleiben die rechtlichen Vorgaben, wonach sämtliche Maßnahmen, die nach der Beratung zu ergreifen sind (weitere Gespräche, Leistungen, Inobhutnahme), nur mit Kenntnis der Personensorgeberechtigten bzw. deren Beteiligung erfolgen dürfen, soweit dadurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird“ (Deutscher Bundestag, Drucksache 19/26107, S.73).
Leider spiegelt sich die neue rechtliche Festlegung und die nun erfolgte Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen bisher noch nicht im entsprechenden Beratungsparagrafen ab. Hier wird weiterhin nicht zwischen den unterschiedlichen Perspektiven der Beteiligten unterschieden:
„Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen. Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sind“ (28 SGB VIII).
Die Negierung potentiell unterschiedlicher Interessen und Perspektiven zwischen den Personensorgeberechtigten einerseits und den von Erziehung betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen andererseits und die Ideologie von „Familie“, die einem besonderen gesetzlichen Schutz unterliegt und gleichsam als eine Einheit betrachtet wurde und wird, haben dazu geführt, dass in der Jugendhilfe in der Regel nicht zwischen Hilfeangeboten für Eltern einerseits und ihren Kindern andererseits unterschieden wird. Entsprechende Beratungseinrichtungen tragen immer noch die Bezeichnung „Erziehungsberatung“, deren Dachorganisation nennt sich immer noch „Bundeskonferenz für Erziehungsberatung“. Auch die Benennung der Beratungsstellen als „Beratungsstellen für Familien, Kinder und Jugendliche“ verändert nichts an der grundsätzlichen Perspektive, dass sich die Beratungsangebote vornehmlich an die Personensorgeberechtigten richten. Kinder und Jugendliche dürfen zwar auch eigenständig ohne Beteiligung ihrer Eltern kommen, aber in der Realität der Beratungsarbeit ist dies eher die Ausnahme als die Regel. „Erziehungsberatung“ ist die Überschrift des § 28 SGB VIII. Es geht um Erziehung von Kindern und Jugendlichen, nicht um Parteilichkeit, Interessenvertretung und Unterstützung bei der selbstbestimmten Persönlichkeitsentwicklung.
Auch wenn der Begriff „Jugendberatung“ im SGB VIII an anderen Stellen vorzufinden ist, nämlich im eher präventiven Kontext von „Jugendarbeit“ (§ 11) und der „Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie“ (§ 16), so fehlt er doch dort, wo es um die konkrete „Hilfe zur Erziehung“ (§ 27 ff) geht - in den Fällen, wo „eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist“ (§ 27 Abs. 1 SGB VIII). Leider wurde die elternzentrierte Perspektive mit der Fokussierung auf den Begriff „Erziehungsberatung“ bei der Reform des SGB VIII beibehalten. Eine offenere Formulierung, die stärkeres Gewicht auf die jungen Menschen als das Subjekt von Hilfeangeboten legt, wäre hier hilfreich gewesen, wie zum Beispiel der Titel „Beratung für Eltern und junge Menschen“ in § 28 SGB VIII.
Im SGB VIII wird die Perspektive deutlich, um die es geht: „das Recht des jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 Abs. 1 SGB VIII). Es geht also nicht in erster Linie um das Recht auf Erziehungsberatung, sondern um ein Recht von Kindern und Jugendlichen auf Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Hilfe zur Entwicklung.
Diesem Recht wird bisher in der bundesdeutschen Wirklichkeit der Jugendhilfe noch zu wenig Rechnung getragen. Das Recht auf Beratung und Unterstützung wird häufig noch als ein Elternrecht verstanden. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden nicht als eigenständige Subjekte mit eigenen Interessen, Bedürfnissen und Wünschen wahrgenommen, sondern als Objekte von Erziehung. Sie sollen erzogen, ausgebildet und für die Gesellschaft kompatibel gemacht werden. Auf diesem Weg bietet die Gesellschaft den Eltern Unterstützung in Form von „Hilfe zur Erziehung“ an:
Die Erziehung steht hier im Vordergrund, nicht die Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit des jungen Menschen. Angesichts dessen ist es kein Wunder, dass junge Menschen eine „Erziehungsberatungsstelle“ oder eine „Beratungsstelle für Familien, Kinder und Jugendliche“ nicht in erster Linie als ein Beratungsangebot für ihre Interessen, Bedürfnisse und Sorgen wahrnehmen, sondern als eine Institution für ihre Eltern. Erwachsene Berater*innen bieten ihre Dienste den erwachsenen Eltern an. Kinder und Jugendliche dürfen zwar auch kommen, werden aber in der Praxis häufig von ihren Eltern (mit-)gebracht oder geschickt. Beratungsanlässe sind meist Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen, Erziehungsprobleme der Eltern oder Aufträge der Schulen und anderer Institutionen, seltener die selbst formulierten Nöte und Sorgen der betroffenen jungen Menschen. Unter diesen Voraussetzungen wundert es nicht, wenn gerade Jugendliche sich schwer damit tun, die Beratungsangebote einer „Erziehungsberatung“ anzunehmen.





























