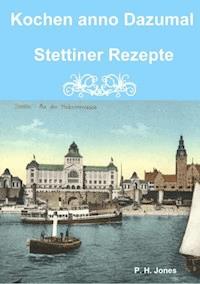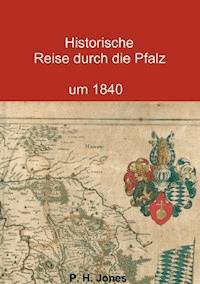
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Historische Reise durch die Pfalz um 1840 Begeben Sie sich auf eine Reise durch die Pfalz anno dazumal aus der Sicht eines Wanderers zur Zeit der Romantik. Über 760 Orte. Wie war Ihr Ort vor 200 Jahren? Erkunden sie die wild romantische Natur als noch Wölfe durch die Wälder streiften. Entdecken Sie Burgen, Römische Straßen und Ruinen, Klöster, ja ganze Dörfer die Heute gänzlich verschwunden sind. P. H. Jones
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reise – Handbuch
durch alle Teile
der
Königl. Bayrischen Pfalz
in lokaler und historischer Beziehung
Von
Vorwort
ich möchte hier Herrn Karl Geib meinen großen Respekt zollen, der um 1840 fast ausschließlich zu Fuß die gesamte Pfalz und seine Orte bereiste und uns diese eindrucksvolle Reisebeschreibung und seine Eindrücke hinterließ.
P. H. Jones
Vorbericht
Dieses Werkchen soll weder eine statistische, noch selbst eine topographische, Beschreibung der Pfalz im engeren Sinne des Wortes enthalten. Der Hauptzweck dabei war, ein Reisebuch zu geben, das sowohl dem einheimischen Leser ein genaues und anschauliches Bild unseres schönen Vaterlandes in allen seinen Teilen gewährt, als auch dem Fremden, der dieses durch Naturschönheiten, Denkmäler der Vorzeit und historische Erinnerungen so merkwürdige Land bereisen will, zum treuen Führer dienen kann, der sein Interesse für das Ganze, wie für manche besondere, in den von ihm durchwanderten Orten und Landschaften befindliche, Gegenstände, noch mehr anregt, und somit auch seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Einzelheiten richtet, die bei der nähern Kenntnis einer Provinz beachtet werden. Darum hat man nicht allein das, was Verfassung, natürliche Beschaffenheit, physische und geistige Kultur der Pfalz betrifft, sondern auch die Lokalitäten selbst, genauer angezeigt als in andern Reisebüchern, die sich über mehrere Lande verbreiten, schon ihrem Plane nach, geschehen kann, weshalb auch jeder einzelne Ort, nebst den in seinem Bereiche liegenden Höfen und Mühlen , etc., wenn er auch außerdem nichts Bemerkenswertes hat, namentlich erwähnt ist. Da während der Abfassung solcher Schriften manchmal hier und da eine auf örtliche Gegenstände Bezug habende Änderung eintritt, so ist es wohl möglich, das auch hier, obwohl nur selten, in diesem Punkte irgendeine Berichtigung oder Ergänzung stattfinden mag. Die Seelenzahl der Gemeinden konnte um deswillen ohnehin nur ungefähr angegeben werden. Was das historische anlangt, so ist die Geschichte der Pfalz, entweder für sich allein oder mit der des übrigen Rheinlandes verwebt, in mehreren gehaltreichen, diesem Felde angehörigen Werken dargestellt. Der Zweck bei gegenwärtiger Schilderung des Landes konnte in diesem Betracht kein anderer sein, als den historischen Ereignissen der früheren oder späteren Zeit allerdings eine vorzügliche Aufmerksamkeit zu widmen, sie aber jedes Mal nur bei den Orten, Burgen, Klöstern, Denkmalen , etc., wo sie für diese aber auch für das Ganze von Wichtigkeit findet, auf einfache und gedrängte, aber gründliche, Weise mitzuteilen. Die Schriften, welche, als geschützte und sichere Quellen, sowohl bei diesem Gegenstande, als bei der topographischen Darstellung etc. benutzt worden, hier aufzuzählen, wäre überflüssig, da sie meist an Ort und Stelle angeführt sind.
Die Ausflüge in das rheinhessische und preußische Nachbarland, wo man jedoch, um des Raumes willen, nur die Hauptgegenden und Hauptorte mit ihren Merkwürdigkeiten, und diese nur in Umrissen, schildern konnte, werden dem Publikum keine unangenehme Zugabe sein. Das Buch schließt mit einigen Sagen und Geschichten aus der Pfalz und den Nahegegenden, worin sich der romantische Volkssinn früherer und auch späterer Zeiten verkündet. Wurden auch schon manche derselben von geschätzten Dichtem zu Darstellungen in Prosa und Versen benutzt, so sind sie doch weit weniger bekannt worden, als z. B. die so häufig und vielfach erzählten Sagen aus der untern Rheingegend, weshalb eine neue Bearbeitung um so mehr an ihrer Stelle sein wird. Vielleicht sind wir im Stande, späterhin eine vollständige Sammlung dieser acht pfälzischen Kunden der Vorzeit unserer vaterländischen Lesewelt mitzuteilen.
Orts Namen Register
Einleitung
Das herrliche Land am Rhein, welches seit dem 1. Mai 1816 mit der Krone Bayern vereinigt worden, und erst die Benennung „Rheinkreis", im Anfange des Jahres 1837 aber, nach einem königlichen Beschlusse, wieder den an historischen Erinnerungen so reichen Namen der „Pfalz" erhielt, liegt zwischen dem 24° 50' 25" und 26° 12' 10" östlicher Länge, und zwischen dem 48° 57' 20" und 49« 48' 40" nördlicher Breite. Seine Grenzen sind gegen Süden und Südost die französischen Departemente vom Niederrhein und der Mosel, großenteils durch den Lauf des Flüßchens Lauter bestimmt, gegen Osten der Rhein, welcher es von dem großherzoglichen badischen Gebiete trennt, gegen Nordost die großherzogliche hessische Rheinprovinz, gegen Norden die königlich preußischen Rheinlande, wo die Nahe, von der Einströmung des Glans bis zur Aufnahme der Alsenz, die Grenze bildet, und gegen West und Nordwest Teile von Hessen Homburg, Sachsen Coburg und Rheinpreußen. Der Flächenraum des gesamten Kreises wird auf 104 Quadratmeilen geschätzt. Dieser besteht aus etwa drei Bierteilen des ehemaligen Departements vom Donnersberg, aus fast drei Kantonen des von der Saar und drei des vom Niederrhein (Unter Elsass), welches, letztere meist noch zu Frankreich gehört.
Bekanntlich hat in früherer Zeit der größte Teil dieses Landes den wesentlichsten der diesseitigen „Pfalz" gebildet. Hauptbesitzer waren die Kurfürsten von Pfalzbayern und ihnen zunächst die Herzoge von Zweibrücken außerdem befanden sich darin mehrere Herrschaften, welche kleineren, sowohl weltlichen als geistlichen, Fürsten, dann Grafen, Freiherrn, etc. gehörten. Durch den Lüneviller Frieden kam es an Frankreich, ward aber 1814 und 1815, so wie das ganze linke Rheinufer, wieder abgetreten und Fiel, nebst dem oben benannten Zuwachse, dem Königreiche Bayern anheim.
Was vie gegenwärtige Verwaltung desselben betrifft, so ist die Kreisregierung, welche ihren Sitz in der Hauptstadt Speyer hat, der in den jenseitigen Kreisen gleich gebildet, und das vollziehende Organ der Staatsministerien des Äußeren, des Innern und der Finanzen für alle Gegenstände, so in die verschiedenen Fächer dieser Ministerien einschlagen. An ihrer Spitze stehen ein Präsident (zugleich Generalkommissär), und ein Vizepräsident. Sie ist in zwei Kammern, die des Innern und die der Finanzen, geteilt. Die erste zählt einen Direktor und sieben Räte (worunter ein Kreismedizinalrat), zwei Regierungsassessoren, zwei Registratoren, drei Rechnungskommissäre, einen Kreisingenieur und einen Zivilbauinspektor , die zweite einen Direktor (zugleich Vizepräsident), fünf Räte (wobei der Kreis Forstrat), einen Assessor, zwei Forstinspektoren, einen Forstkommissär, zwei Registratoren und fünf Rechnungskommissäre. Zudem sind für beide Kammern ein Präsidialsekretär und vier andere Sekretäre angestellt. Ein der Regierung zur Seite stehendes, bereits in der französischen Verfassung begründetes, Institut ist der vier und zwanzig Mitglieder starke Landrat, welcher sich jedes Jahr einmal, zudem auch bei außerordentlichen Fällen, in der Kreishauptstadt versammelt, wo er sich mit Verteilung der Steuern, Prüfung der Umlagen, Abhör der fälligen Rechnungen etc., beschäftigt, und zu gleich sein Gutachten in Betreff des Zustandes, der Verwaltung und Bedürfnisse des Landes erteilt. Ferner enthält der Kreis Pfalz in administrativer Beziehung zwölf Land kommissariate, welche zusammen ein und dreißig Kantone umfassen. Letztere sind in Gemeinden oder Bürgermeistereien eingeteilt, deren jeder größere Ort eine für sich bildet, während die kleineren Ortschaften, Höfe, Mühlen und einzelnen Häuser mehrere entweder zu einer Bürgermeisterei vereinigt, oder den zunächst liegenden größeren Gemeinden einverleibt sind. Für die Erhebung der direkten Steuern in den Gemeinden sind besondere Einnehmer angestellt, von welchen der Betrag in die Bezirkskassen, die unter der Kreiskasse in Speyer stehen, abgeliefert wird. Anderer Verwaltungs zweige des Landes sei bei den verschiedenen Stationen ihrer Ämter gedacht.
Das Justizfach, welches, nach der weisen Anordnung der französischen Gesetzgebung, von dem administrativen getrennt ist, bewahrt dem Kreise die ihm so werten Institutionen, welche hauptsächlich in der Gleichheit vor dem Gesetze, in der Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtspflege, der Einführung einer kontrollierenden Staatsbehörde bei den Gerichten, und der Aburteilung krimineller Anklagen durch Geschworene, bestehen. In jedem Kanton befindet sich ein Friedensgericht, durch den Friedensrichter und seinen Gerichtsschreiber gebildet. Es entscheidet in erster oder letzter Instanz über Zivilstreitigkeiten von geringerem Belange, Feld und Waldfrevel, Injurien, die keine Kriminalklage veranlassen etc., während es zugleich in Füllen, die seine Kompetenz übersteigen, das Menschen freundliche Amt der Vermittelung und Friedens stiftung übt. Auch präsidiert der Friedensrichter die Familienversammlungen, welche Kuratoren oder Vormünder ernennen. Er nimmt bei Sterbefällen im Interesse Minderjähriger unter anderem die Anlegung und Abnahme der Siegel vor, und ist überdies polizeilicher Hilfsbeamter des Staats Prokurators. Die Berufungen von den Urteilen des Friedensgerichts gehen an die einschlägigen Bezirksgerichte. Deren sind im Kreise vier, welche in Landau, Frankental, Kaiserslautern und Zweibrücken ihren Sitz haben. Zu dem ersten gehören in judiciärer Beziehung die Landkommissariate Bergzabern, Landau und Germersheim, zum zweiten die von Neustadt, Speyer und Frankental, zum dritten die von Kirchheimbolanden, Kusel und Kaiserslautern, und zum vierten die von Homburg, Zweibrücken und Pirmasens. Das Personal dieser Gerichte besteht aus einem Präsidenten, einem Untersuchungs richter, zwei Richtern, einem bis drei Ergänzungs richtern, einem Staatskurator, einem Substituten, einem Gerichtschreiber und einigen Untergerichts schreibern. Die Zahl der Anwälte (Advokaten) an jedem beträgt verhältnismäßig zwischen sechs und neun. Die Kompetenz der Bezirksgerichte erstreckt sich auf alle Zivilrechtsklagen, in denen der Friedensrichter nicht in letzter Instanz entscheidet. Auch erkennt es unter dem Namen Zucht polizeigericht über alle Vergehen, deren Strafe fünf Tage Gefängnis und 7 fl. Geldbuße übersteigt. Das königliche Appellationsgericht (Appellhof) welches seinen Sitz in Zweibrücken hat, zählt einen Präsidenten, einen Direktor, zehn Räte, einen Generalstaatsprokurator, zwei Staats, Prokuratoren, einen Ober und zwei Untergerichtschreiber, außerdem neun Anwälte. Es entscheidet in letzter Instanz über alle zivilrechtlichen Fälle, gegen deren Urteile Appellation statt findet. Eben so unterliegen die Aussprüche der Zuchtpolizeigerichte sämtliche der Berufung an dasselbe, wo es dann erkennt, ob hinreichende Gründe zur Kriminalanklage vorliegen. Ist dies der Fall, so werden die Angeklagten vor das Assisengericht verwiesen, welches alle drei Monate am Sitze des Appellhofes gehalten wird und, auf die Erkenntnisse der Geschworenen, seine Urteile füllt. Sowohl in Zivil als Kriminalsachen kann Kassation nachgesucht werden. Der in München befindliche Kassationshof entscheidet jedoch nie über den Gegenstand des Prozesses, sondern er kassiert die Urteile, wenn die Formen verletzt worden, oder das Gesetz eine unrichtige Anwendung fand. Auch kann man in einigen durch das Gesetz bestimmten Fällen auf Revision des Prozesse beantragen.
Die Ladungen vor Gericht und die Vollziehung der von demselben ausgehenden Befehle geschehen durch die Gerichtsboten (Huissiers), eine Institution, die schon seit mehreren Jahrhunderten in Frankreich besteht.
In jedem Kanton sind, nach Verhältnis der Bevölkerung, zwei oder drei Notare angestellt, öffentliche Beamte, welche alle Kontrakte, Obligationen, etc., verfertigen, die den Charakter der Authentizität haben und zugleich erecutorisch sind.
Die verwaltende Polizei, welche von der königlichen Kreisregierung ausgeht, wird unter ihr von den Landkommissariaten, dann von den Bürgern meistern, Adjunkten und Polizeikommissären, geleitet. Die gerichtliche steht unter Aufsicht der Gerichtshöfe. Zur Ausübung beider werden die Gendarmerie, die in den Gemeinden bestehende Sicherheitsgarde, die Flurschützen, Forsthüter, etc. verwendet. Die Medizinalpolizei anlangend, so befindet sich deshalb bei der Kreisregierung ein Medizinalrat. Auch ist fast in jedem Kanton ein besonderer Kantons Physikus, und in jedem Landkommissariat ein Tierarzt, angestellt. Man findet nicht allein in den Städten, sondern auch in manchen wichtigen Landgemeinden, Ärzte, Chirurgen und Apotheken, letztere besonders im Osten des Kreises.
Die kirchliche Verfassung ist im Allgemeinen folgende: 1) Katholische Kirche. Das Bistum Speyer, welches zu dem Erzbistum Bamberg gehört, hat einen Bischof, einen Dompropst, einen Domdechant, acht Domkapitulare und sechs Domvikare. Der ganze Kreis ist in elf Dekanate und zweihundert und fünf Pfarreien eingeteilt. 2) Evangelisch Protestantische Kirche. Das Konsistorium zu Speyer, dem protestantischen Oberkonsistorium des Königreichs untergeordnet, besteht aus einem Vorstand (zugleich Regierungsrat), einem weltlichen und zwei geistlichen Räten, einem Sekretär und Registrator. Der Kreis enthält fünfzehn Dekanate und zweihundert elf Pfarreien, wiewohl die Zahl der protestantischen Pfarrer, da in verschiedenen größeren Gemeinden diese Stellen mit zwei oder mehreren besetzt sind, auf zweihundert acht und dreißig kommt. 3) Mennonietische Konfession. Die Zahl der Mennonieten in diesem Lande ist nicht unbedeutend. In einigen Gemeinden haben sie Kirchen. Wo diese nicht sind, halten sie ihre Gebete in Privatwohnungen. Ihre Kinder besuchen meist die zunächst gelegenen Volksschulen, vorzüglich die der protestantischen Religion. 4) Jüdische Konfession. Die staatsbürgerlichen Rechte dieser, ziemlich zahlreichen, Glaubensgenossenschaft sind durch die Konstitution gesichert, wenn sie auch nicht ganz in der Vollkommenheit wie die der christlichen Gemeinden bestehen. In den Kantonen Grünstadt und Landau trifft man die meisten Juden an. Für jeden der vier Gerichtsbezirke ist ein Rabbinaht errichtet, dem in religiöser Beziehung die Synagogen unter geben sind. Auch viele Judenkinder nehmen an dem Unterrichte in den Volkschulen teil, doch haben sie an manchen Orten eigene Lehrer.
Außer der, sehr wohl eingerichteten, Kreisarmen und Krankenanstalt, (siehe den Artikel Frankental) sind im Lande mehrere Wohltätigkeitsanstalten oder Hospitäler, die ansehnliche Funds besitzen.
Was die Erziehungs und Bildungsanstalten betrifft, so ist bekannt, wie sehr sich unter der königlich bayrischen Regierung der öffentliche Unterricht vervollkommnet hat, und wie dieselbe hier sowohl, als in allen ihren Landen, das Streben im Gebiete der Kunst und Wissenschaft zu ermuntern und zu fördern sucht Höhere Studienanstalten oder eigentliche Gymnasien befinden sich in Speyer und Zweibrücken. Zudem sind lateinische Schulen in diesen zwei Städten, in Frankental, Landau, Neustadt, Grünstadt, Germersheim und Dürkheim. Auch hat man an einigen Orten lateinische Vorbereitungsschulen errichtet. In Kaiserslautern besteht eine Kreislandwirtschafts und Gewerbsschule, und ein Seminar zur Bildung der Lehrer für die zweckmäßig eingerichteten Volksschulen, über welche Bezirksschul inspektoren, aus der Zahl der Pfarrer beider Konfessionen, unter Oberaufsicht der Kreisregierung, gesetzt sind. Andere öffentliche und Privatanstalten für Erziehung und Unterricht sehen an Ort und Stelle erwähnt. Als wissenschaftliche und Kunstvereine nennen wir den, seit dem Anfange des Jahres 1830 entstandenen, historischen Verein. Seine Majestät der König haben das Protektorat der Pfälzischen Pharma zeutischen Gesellschaft, welche ihren Sitz in Kaiserslautern hat, zu übernehmen geruht, Sie hat 1841 einen erweiterten Wirkungskreis erhalten und führt jetzt den Titel: „Pfälzische Gesellschaft für Pharmazie und Technik und deren Grundwissenschaften," das Antiken Kabinett in Speyer, zur Aufbewahrung römischer und anderer Altertümer, die man im Lande entdeckt, und die musikalischen Gesellschaften in einigen Städten der Kreises, welche das gebildete Publikum jährlich mit der Ausführung größerer Werke der Tonkunst erfreuen. Außerdem gewinnt der zur Vorbereitung der wissenschaftlichen Kultur so nützliche Buchhandel immer mehr Fortgang.
Jeder Fremde, der als treuer Beobachter von Sitten und Lebensweise die Rheinpfalz betritt, wird hier eine glückliche Mischung des deutschen und französischen Nationalcharakters finden. Er wird erkennen, das die Bewohner dieses schönen Landes, wie die Rheinländer überhaupt, im Durchschnitte ein biederes, sinniges, aufgeklärtes und lebhaftes Volk sind, empfänglich für das Gute und Schöne, von kräftiger Natur, gesundem Urteil und lobenswerter Tätigkeit. Wohl gibt es hier, wie überall, Individualitäten, welche sich mehr zur Heiterkeit oder zur Schwermut neigen. Aber im Ganzen ist der für die geselligen Freuden des Lebens herrschende Sinn mit einem Ernste verbunden, der ihn nicht in Leichtsinn ausarten lässt. Dass auch die Sitten meist reiner sind, als in vielen andern Gegenden, hat sich schon durch manchen über diesen Punkt angestellten Vergleich erprobt. Das rheinpfälzische Volk ist von germanischer Abkunft, und das Land war in der ältesten Zeit, die uns geschichtlich bekannt ist, von den Bangionen, Nemetern ,etc. bewohnt. Trotz den Vermischungen, welche durch den Aufenthalt der Römer, die große Völkerwanderung und die Ereignisse späterer Zeit hier, so wie in andern Ländern, statt gefunden, sind doch ohne Zweifel die Stämme der Franken und Alamannen diejenigen, welche man als die Hauptgrundlagen des der jetzigen Bewohner ansehen kann. Obschon letztere, was sowohl physische als geistige und moralische Eigenschaften anlangt, in den verschiedenen Gegenden des Kreises nicht weit von einander abstehen, so ist doch der Eingeborene des östlichen Teils, nämlich der Rheinebene und der sie begrenzenden Vorhöhe des Gebirges, im Allgemeinen wohlgebauter, stärker und aufgeweckter, auch, wegen der Üppigkeit seines Bodens, luxuriöser, als der im Westen, oder der eigentlichen Berggegend, wo man kleinere Gestalten, die das Gepräge mühsamer Arbeit tragen, ein geräuschloseres Wesen, einfachere Sitten, und zugleich einen geringeren Grad an Kultur, unter den Landleuten antrifft. Aber sowohl in den mit allen Gaben der Natur gesegneten, als in den wilderen Teilen der Pfalz, ist ausdauernder Fleiß im Anbau der Felder das, was ihre Bewohner höchst rühmlich auszeichnet. Auch haben die Söhne dieses Landes in den furchtbaren Kriegen unserer Zeit hinlängliche Beweise geliefert, wie die von den Voreltern Angestammte Tapferkeit ihr Eigentum blieb, und was auch künftig von denselben und ihren Nachkommen als Vaterlandsverteidiger zu erwarten ist. Das weibliche Geschlecht besitzt großenteils ein gefälliges, mit Verstand und Anmut verbundenes, Äußeres, und kann hier, besonders in einigen Gegenden, mit Recht das schöne genannt werden. Die Wirkungen einer guten und sorgfältigen Erziehung sind im geselligen Umgange mit den meisten Personen der gebildeten Stände, sowohl Männern als Frauen, unverkennbar. Dass auch der Sinn für geistige Bildung hier so gut als irgendwo einheimisch sei, beweiset schon der regsame, helle Geist und die lebhafte Phantasie des Rheinpfälzers, und wenn bereits in früherer Zeit, unter weniger günstigen Verhältnissen, tüchtige Männer in jedem Fach aus diesem Lande hervorgegangen sind, so möchte dies jetzt um so häufiger der Fall sein, wo durch Vermehrung und Vervollkommnung zweckmäßiger Anstalten, das Studium der ernsteren Wissenschaften und zugleich der Anbau schöner Literatur und Kunst, noch eifriger und gründlicher betrieben werden, so dass die Anmaßung gewisser andern Provinzen, welche sich hierin größere Vorzüge zuschreiben, durch Tatsachen genugsam widerlegt wird.
Was die Einwohnerzahl des Kreises betrifft, so war dieselbe Ende 1840 auf 571.137 Seelen, ohne das im Lande garnisonierende Militär, berechnet. Darunter befanden sich 311.225 Protestanten, 241 176 Katholiken, 3340 Mennoniten und 15.396 Juden. Wenn man diese Bevölkerung mit dem oben gemeldeten Flächenraum des Landes vergleicht, so wird man erkennen, dass sie nach dem Verhältnis unter die stärksten gehört, indem hier ans einer Quadratmeile eine beträchtlichere Menschenmasse wohnt, als dies in vielen andern, selbst großen und reichen, Staaten gefunden wird. Auch vermehrt sich die Bewohnerzahl jährlich, trotz mancher Auswanderungen nach Amerika ect.. Da die Einwohneränderungen noch häufiger sind, und die Sterbefälle von den Geburten bedeutend überstiegen werden. Der östliche Teil der Pfalz ist mehr bevölkert, als der minder fruchtbare westliche, wiewohl auch in letzterem seit Jahren die Seelenzahl außerordentlich zugenommen hat.
Mit Recht wird die Rheinpfalz der Garten Deutschlands genannt. Denn die Natur hat sie gleich dem benachbarten Elsass, zu einem der schönsten und fruchtbarsten Länder Europas gebildet. Der westliche Teil ist meist bergig, und eine Fortsetzung der aus Frankreich kommenden Vogesen, deren Zug sich nördlich im Donnersberge, dem höchsten Punkte derselben, endigt und dann gegen Rheinhessen hinabsenkt. Von dieser Gebirgskette ziehen anmutige Hügel nach Osten, wo sie sich in die reizende Fläche verlieren, welche, die linke Seite des herrlichen Rheintals bildend, von dem mächtigen Strome begrenzt wird. Was die Beschaffenheit und die Kultur des, Bodens anlangt, so ist allerdings diese Ebene und die östliche Vorhöhe des Gebirges der fruchtbarste Teil, obschon auch hier die Ergiebigkeit des Erdreichs nicht überall gleich ist, da man an einigen Orten auch Strecken von Sand und Heideland zwischen reichen Fluren erblickt. In dieser Gegend wird der Getreidebau am stärksten getrieben. Die Abhänge des Gebirges und die Hügel sind zum Teil mit Reben bepflanzt, welche sich hier und da bis zur Ebene erstrecken. Doch ist die Güte des Weins verschieden, wiewohl an mehreren Stellen, besonders in den Kantonen Neustadt und Dürkheim, ein köstliches Gewächs erzeugt wird. Der westliche Teil, obgleich rauer, bringt ebenfalls mancherlei Feldfrüchte hervor. Sein Hauptreichtum jedoch besteht in Waldungen, deren sich aber auch an den Vorhöhen und in der Ebene, namentlich gegen den Rhein hin, schöne und ansehnliche Distrikte befinden. Zudem enthält der Kreis mehrere Bergwerke, wo Eisen, Blei, Alaun, Quecksilber (das man im übrigen Deutschland nicht antrifft) und Steinkohlen gewonnen werden und verschiedene Brüche von Basalt, Sandstein, etc. Auch finden sich mehrere Mineralquellen, deren manche durch zweckmäßige Fassung zu guten Trink und Badeanstalten eingerichtet werden könnten. Die Getreidearten des Landes bestehen vorzüglich in Korn (Roggen), Gerste, Weizen, Spelz (Dinkel), Hafer und Hülsenfrüchten. Auch wird türkisches Korn (Welschkorn) und Hirse angebaut. In der Rheinebene übersteigt die Ernte den jährlichen Bedarf, so dass noch ziemlich viel Getreide in das Ausland verkauft wird. Die westlichen Gegenden erzielen gewöhnlich nur das, was zu ihrem Verbrauche hinzureicht. Die Kartoffeln, dieses treffliche Produkt, werden im ganzen Lande gepflanzt, jedoch die Festen am Donnersberge und in andern Teilen des so genannten Westrichs. Sie dienen nicht allein zur Nahrung der Menschen, sondern auch zur Mast für das Vieh und zum Brandweinbrennen. Hier und da mischt man sie selbst unter dass Futter der Pferde. Reps (Kohl) wird fast überall gebaut. Hanf findet man in der ganzen Rheinebene, Flachs namentlich bei Mutterstadt. Der Tabak, dessen Bau unter der französischen Regierung sehr im Flor war, wird jetzt wegen des geringen Preises weniger, aber doch, besonders in den Kantonen Speyer, Mutterstadt und Germersheim, fortwährend gepflanzt. Was Futterkräuter betrifft, so ist der nützliche Kleebau, wie auch die Pflanzung der Runkelrüben, im ganzen Kreise verbreitet. Eben so die der weißen und gelben Rüben, die zur Nahrung für Menschen und Vieh dienen. Das Land enthält viele und schöne Wiesen. Die vorzüglichsten sind in den Tälern der Blies, Queich, Alsenz, am Glan, und längs dem Rhein. Der Wein ist ein Hauptprodukt des Kreises. Außer den Riesling Trauben, die auch auf der Ebene gut gedeihen, werden, hauptsächlich an der östlichen Seite des Gebirges, Traminer, Rulander, Gutedel, Muskateller und Alben gepflanzt. Man baut treffliches Gemüse aller Art, worin sich die Gegend von Frankental, Zeiskam und Speyer auszeichnet. Auch erzielt man verschiedenerlei Gewürze. Die Obstkultur ist, namentlich in den östlichen Kantonen, im herrlichsten Zustande, Außer den gewöhnlichen Sorten von Stein und Kernobst gedeihen hier auch Früchte der milderen Zone, wie Aprikosen, Pfirsiche, Mirabellen, Reine Claudes, Maulbeeren, Nüsse, Mandeln und Kastanien , sehr gut. Letzte finden sich häufig auf den Abhängen des Haardtgebirges, einigen daran stoßenden Hügeln, und selbst an der östlichen Seite des Donnersbergs. Zudem bringen die Gärten, Felder und Wälder mancherlei Staudengewächse, Kräuter etc. in der Menge hervor. Unter den Gattungen der Waldbäume sind die der Eichen, Buchen und Föhren (Waldsichten), sowohl im Gebirge als auf der Ebene, die gewöhnlichsten. Von andern Laub und Nadelhölzern findet man die Ulme (Rüster), Esche, Erle, hier und da auch die Roth und Weißtanne, die Lärche, die Akazie und den Ahorn. An mehreren, besonders niedern und feuchten, Stellen werden Linden, Espen und Weiden gepflanzt. Die Trauerweide und Wehmutssichte erscheinen oft als sinniger Schmuck der Gärten und Denkmale. Durch Abhilfe verschiedener Mängel und durch eine zweckmäßige Organisation hat die Forstkultur unter der jetzigen Regierung sehr gewonnen. Außer den Staatsforsten gibt es beträchtliche Gemeinde Waldungen, auch mehrere, die Privateigentum sind. Dass in einem Lande, wo der Feldbau so getrieben wirb, auch die Viehzucht in großer Aufnahme sei, versteht sich von selbst. Das Rindvieh, dessen Zucht am bedeutendsten ist, gehört meist zum Mittelschlage. Eine stärkere Gattung findet man im Glantale, wie auch in der Gegend von Kirchheimbolanden und Göllheim, wo sie durch Schweizerart veredelt ist. Die Stallfütterung ist allgemein, obschon auch an mehreren Orten die Gemeindeweiden benutzt werben. Zugleich war die Pferdezucht von jeher in der Pfalz ein Hauptgegenstand der Landwirtschaftlichen Einrichtung. Doch nur im Zweibrückischen wurde sie ehemals durch eine edlere Rasse vervollkommnet. Das dortige Gestüte kam während der stürmischen Revolutionsjahre sehr in Verfall, ward aber unter der Regierung Napoleons wieder hergestellt, und gewinnt dermalen immer schöneren Fortgang, jedes Jahr werden aus demselben zur Beschälzeit mehrere Zuchthengste von arabischer, englischer, normannischer etc. Rasse in die verschiedenen Distrikte des Kreises gesandt, wodurch schon eine wesentliche Veredlung der einheimischen Art bewirkt worden ist. Auch erhält jetzt das im Lande garnisonirende Chevaulegersregiment in diesem seine Hauptremonte. Die vorzüglichste Schafzucht besteht in den westlichen Gegenden. Schweine werden überall Häusig gezogen. Die Festen jedoch finden sich in den Waldkantonen, wegen der Eichel und Buchenmast. Esel werden in einigen Bergorten gebraucht. Auch Ziegen hält man hier und da im Gebirge und auf der Ebene. Bedeutende Vieh (vorzüglich Rindvieh) Märkte bestehen das Jahr hindurch an mehreren Orten. Besonders im westlichen Teile des Landes. An zahmem Hausgeflügel ist Überfluss, und in manchen größeren Höfen sieht man auch Pfauen, Trut und Perlhühner. Die Bienenzucht ist allgemein, obschon die Kantone Landau, Bandstuhl und Neuhornbach hierin den Vorzug haben. Zur Begünstigung der Agrikultur und der damit verbundenen Zweige Besteht im Kreise ein Bezirks Komitee des landwirtschaftlichen Vereins für das Königreich Bayern. Auch ist in Speyer eine treffliche Baumschule angelegt.
Da die Pfalz vorzugsweise unter die Landbautreibenden Länder gehört, so sind hier die Manufakturen allerdings weit weniger zahlreich, als da, wo sie die Hauptnahrungsquelle der Einwohner bilden. Dennoch fehlt es nicht an Gewerbsindustrie, namentlich an solcher, die der Feldbau nicht entbehren kann. Den vorzüglichsten Rang behaupten die Eisenwerke und Hämmer, worunter sich auch ein Kupferhammer befindet. Auch hat das Land drei Glasfabriken und eine Saline, die dem Staate gehört. Außerdem gibt es in demselben mehrere Tuchmanufakturen, Lohgerbereien, Tabakfabriken, Brauereien, Ziegelhütten, eine Fayence und Steingutfabrik, ein und zwanzig Papiermühlen etc. Aller dieser Anstalten sei an den Orten, wo sie bestehen, im Einzelnen gedacht. Als Institut zur Beförderung der Industrie nennen wir die Baugewerbeschule in Speyer. Was den Handel nach dem Auslande betrifft, so sind Wein und Getreide, besonders ersterer, die Hauptartikel desselben. Zudem werden Pferde, Rindvieh, Schweine, Papier, Blättertabak, Reps und Mohnöl, Hanf und Krapp ausgeführt. Im Innern bezieht der westliche Teil von dem östlichen Wein, auch etwas Feldfrüchte, und liefert ihm dagegen Holz, Steinkohlen etc.. Gegenstände der Einfuhr sind, außer dem Kolonialwaren, seine Tücher und Leinen, Seidenzeuge, Kattune, Porzellan, Bijouterien, Seefische, Zinn, Kupfer etc.. Alle bedeutenden Orte haben einen oder einige Jahrmärkte, die kleineren jährlich Kirmessen. Der Getreidemärkte bestehen wöchentlich zu Landau und Neustadt zwei, zu Edenkoben, Frankental, Kaiserslautern, Kusel, St. Ingbert, Speyer und Zweibrücken. Viktualienwochenmärkte sind in allen größeren Gemeinden. Zur Erleichterung und Beförderung des Handels dienen mehrere Kunst und Landstraßen (unter welchen die große Pariser oder Kaiserstraße und die neue, über Zweibrücken, Pirmasens und Landau nach Karlsruhe führende, die wichtigsten sind), und der Frankentaler Kanal, wovon wir seines Orts das Nähere melden. Welche Sorgfalt die königlich bayerische Regierung auf den Bau und die Unterhaltung der Straßen verwendet, und wie seit 1816 deren noch neue angelegt, auch verschiedene, ehemals üble, Gemeindewege in Chausseemüßigen Stand gesetzt worden, ist allgemein bekannt.
Unter den Flüssen des Landes ist der Rhein, welcher die östliche Grenze bildet, der Hauptstrom, und allein für größere Fahrzeuge schiffbar, indem er Lasten von 2400 Zentnern tragt. An beiden Ufern sind hohe und starke Dämme gebaut. Dennoch tritt der Strom zuweilen aus seiner Bahn, und überschwemmt mit wilden Wogen die nahen Felder. Dies geschieht besonders dann, wenn er durch den Alpenschnee, der sich in den Monaten Juni und Juli löset, geschwellt wird, oder wenn die Eismasse, welche in strengen Wintern seine Oberfläche deckt, wieder angestaut. Aber schon sind, in Folge der zwischen Bayern und Baden geschlossenen Übereinkunft, viele Krümmungen des Rheins durchstochen, so dass, nach Vollendung dieser Arbeit, nicht allein jenem Unheil abgeholfen, sondern auch der Lauf des Stromes hier um vieles abgekürzt und zugleich eine große Strecke Land gewonnen werden muss. Bekanntlich führt der Rhein auch Goldsand, der namentlich bei Selz, im Unterelsass, dann weiter abwärts bei Knielingen und Linkenheim, im Badischen, und hier besonders an dem Ufer zwischen Germersheim und Speyer, machen wird. Doch ist die Ausbeute an Gold zu gering gegen die, zwar einfache, aber mühsame Arbeit. Kleinere Flüsse von Bedeutung sind die Nahe, die einen Teil der nördlichen Grenze beströmt, der in sie fallende Glan, und die Blies im Südwesten des Kreises. Eine Menge größerer und kleinerer Bäche, von denen er bewässert wird, und die sich zum Teil in letztere, meist aber in den Rhein ergießen, nennen wir an den Orten und in den Gegenden, durch welche ihr Lauf geht. Auch gibt es, besonders in den westlichen Kantonen, mehrere ansehnliche Weiher und Teiche. Alle diese Gewässer sind mehr oder weniger Fischreich. Der Rhein enthält treffliche Karpfen, Hechte, Aale, Salmen und Störe. Die drei ersten Gattungen finden sich auch in andern Flüssen, Bächen und Weihern, so wie Barsche, Weißsische, Grundein (Schmerle), und Krebse, im Gebirge auch Forellen.
Durch die, unter der französischen Verfassung geschehene, Aufhebung der Hege hat sich die Zahl des Wildes vermindert. Doch gibt es in den Wäldern des Gebirges und der Ebene noch Hirsche und Rehe, seltener wilde Schweine, die man wegen ihrer Schädlichkeit so viel möglich auszurotten sucht. Die jagdbaren Tiere des flachen Landes sind meist Hasen, sodann Füchse und Dachse. Auch Wölfe, deren eigentlicher Aufenthalt das lothringische Gebirge und der westliche Teil der Vogesen ist, kommen, besonders in strengen Wintern, manchmal an einem oder dem andern Orte zum Vorschein. Von den zur Jagd gehörigen Vogelarten findet man Auerhahnen und Haselhühner (im Gebirge), dann wilde Gänse und Enten, Trappen, Krammetsvögel, Böheimer (oft in ungeheurer Zahl), Schnepfen, Rebhühner, in Wäldern am Rhein auch Fasanen etc. Zudem gibt es Singvögel aller Art, von Raubvögeln hier und da Falken, Weihen, Sperber etc. Die Jagden auf den Feldern und in Gemeindewaldungen sind meist verpachtet.
Die Pfalz liegt unter einem gemäßigten Himmelsstriche, wo ein regelmäßiger Wechsel der Jahreszeiten herrscht. Das Klima ist im Allgemeinen gesund und angenehm, doch bedeutend milder im östlichen Teile, als in der westlichen Gebirgsgegend. Die Winter sind gewöhnlich mehr feucht als trocken. Da zuweilen schon gegen Ende des Oktober Schnee auf den Bergen fällt, die Kälte auch in manchen Jahren während der Monate Dezember und Januar ziemlich strenge ist, und der Winter nicht selten bis in den März dauert, so könnte man das Klima in diesem Betracht mehr zu den nördlichen als zu den südlichen rechneu. Doch erscheint der Frühling weit eher, als in Norddeutschland und am Niederrhein. Oft schon im März blühen Maßlieben und Violen, und oft sind in der Mitte des Aprils die Bäume schon mit Blüten, und die Felder und Gärten mit allerlei Blumen geschmückt. Auch kommen dann manchmal vor Ablauf des Maies die Frühkirschen zur Reife. Doch gibt es Jahre, wo der Wonnemonat unfreundliche Tage und Nachtfröste hat, die besonders dem als dann schon weit gediehenen Weinstock schädlich sind. Die Sommerhitze ist in der Regel zur Erntezeit groß, doch treten oft Gewitter ein. welche die schwüle Luft wieder abkühlen. Die im Vogesischen Gebirge aufsteigenden Wetterwolken brechen sich in ihrem Zuge nach der Ebene an den höchsten Gipfeln, und sind darum minder schwer, als die, welche, obwohl seltener, vom Rheine herwandeln, da ihnen die Bergkette einen Haltpunkt entgegensetzt. Manchmal erfolgt starker Hagel, auch heftiger Sturm und Wolkenbruch, welches letztere jedoch nicht häufig geschieht. An Regen ist kein Mangel. Er wird größtenteils durch die Winde aus den südwestlichen Tälern zur Ebene geführt. Der September, in welchem man die heimischen Baumfrüchte erntet, ist gewöhnlich ein sehr angenehmer Monat. In heißen Jahren beginnt schon am Ende desselben die Weinlese, meist aber im Oktober. Dann fangen die Nebel zu herrschen an, obwohl deren auch manchmal zu Ende des Sommers entstehen, wodurch die Reife der Herbsterzeugnisse gefördert wird. Ein Beweis von dem stärkeren Einfluss der Sonne und der größeren Wärme des Bodens ist der , dass, außer einigen Arten ausländischen Getreides und vorzüglichen Reben, gewisse in südlichen Gegenden einheimische Früchte, wie Mandeln und besonders zahme Kastanien, mit dem Festen Erfolg gepflanzt werden, was in vielen andern Teilen Deutschlands, und namentlich in den beiden oben erwähnten Ländern, nicht möglich ist.
Nach dieser gedrängten Darstellung und Übersicht desjenigen, was die Lage, die politische Verfassung, den wissenschaftlichen Zustand, den Charakter der Bewohner, und die natürliche Beschaffenheit der Pfalz betrifft, treten wir nunmehr unsere Wanderung durch den gesamten Kreis an, der sowohl in jenem Betracht, als durch seine Naturschönheiten und seine geschichtlichen Denkmäler, jedem gebildeten Reisenden ein vielfaches Interesse gewährt. Damit aber bei Angabe und Schilderung der Orte und Gegenden, die in den Kantonen der verschiedenen Landkommissariatsbezirke enthalten sind, eine bestimmte Norm beobachtet werde, nehmen wir, letztere jedes Mal bezeichnend, unsern Weg zuerst von der südlichen Grenze des östlichen Teils bis zur nördlichen, indem wir abwechselnd den Hauptstraßen am Gebirge und am Rheine folgen, jedoch mit Hinweisung auf Verbindungswege, die der Reisende, welcher die Karte des Landes vor sich hat, nach Gefallen einschlagen kann, und wenden uns dann nach dem westlichen Teile, um in der Richtung von Norden nach Süden seine verschiedenen Punkte zu betreten.
Land Kommissariat Bergzabern
Kanton Bergzabern
Das Flüsschen Lauter oder Wieslauter, welches bei Merzalben entspringt, und sich in mancherlei Windungen durch das Wald und Wiesen reiche Dahn Tal nach dem französischen Gebiete hinschlängelt, beströmt hier die Stadt Weißenburg und bildet in seinem weiteren Laufe die Grenze der Kantone Bergzabern und Kandel, und so zugleich die des Kreises Pfalz, gegen Frankreich, worauf es sich, nachdem es den Reisbach und andere kleine Wasser aufgenommen, unweit Lauterburg in den Rhein ergießt. An der Lauter, zwischen Weißenburg und der letztern Stadt, befinden sich die 1706 von dem berühmten Baumann angelegten Linien, ein Meisterstück der Kriegsbaukunst, das man für unüberwindlich hielt. Im Revolutionskriege wurden sie, von den Vogesen bis an den Rhein, noch stärker befestigt. Nachdem aber die französische Moselarmee von den Preußen, bei Pirmasens geschlagen worden, gerissen diese die hier genommene Stellung der Rheinarmee in der linken Flanke an, während sie von den Österreichern rechts und in der Front gefasst war, wodurch denn diese Linien am 13. Oktober 1793, nach heftigem Widerstande , mit Sturm erobert wurden, welcher Sieg jedoch die Verbindung der beiden französischen Heere nicht unterbrach.
Bei Weißenburg die Grenze Frankreichs überschreitend, betreten wir das bayerische Land, und verfolgen unseren Weg längs dem Gebirge hin. Hier endet das eigentliche Elsass oder das niederrheinische Departement, welches ehemals noch die Kantone Bergzabern, Kandel und Landau umfasste. Der erste Ort des Kantons Bergzabern, den man auf der Poststrasse berührt, ist das 940 Seelen starke Gebirgsdorf Schweigen, nahe bei Weißenburg, zu welchem vor der letzten Grenzberichtigung sogar sein Bann gehörte. Unsere Wanderung geht über das, an 1100 Einwohner zählende, ehedem herzogliche zweibrückische Dorf Rechtenbach durch eine malerische und fruchtbare Gegend fort. Rechts erscheint die Ebene, mit üppigen Getreidefluren und Wiesen geschmückt, links erheben sich anmutige, mit Reben bepflanzte, Hügel, und die Gebirgsmassen, von herrlichen Waldungen bekrönt, welche sich in die Täler der westlichen und raueren Teile des Kantons hinab zieht. Der Flecken Oberotterbach, durch den jene Straße führt, liegt an der an dem nahen Gebirge herfließenden Otter, welche die Brücke, Spring und Brendelsmühlen treibt. Der Ort zählt 1756, grössen Teils protestantische, Einwohner Er kommt, nebst dem westlich davon entlegenen Niederotterbach (über 420 Einwohner), mit der Weidelmühle, schon in Urkunden des zehnten Jahrhunderts vor. Beide gehörten ehedem zu dem Zweibrücker Amte Guttenberg, welches nach dem Schlosse genannt war, dessen Ruine auf der westlichen Berghöhe steht. Dies war im Mittelalter eine Reichsfeste, und schon im zwölften Jahrhundert erscheinen Ritter von Gnttenberg oder Guttenburg, wie auch von Otterbach, unter dem Adel des Landes. Von hier geht der Weg nach der Stadt Bergzabern, die, zwei Stunden von Weißenburg, am Fuße der Vogesen oder des Wastchengebirges, in einer sehr romantischen Gegend liegt. Der Erlenbach, der aus dem wilden Tale, in dessen Eingange man eine schöne Pflanzung von Weißtannen sieht, hervorrauscht, durchfließt die Stadt, und eilt nach der Farben und fruchtreichen Ebene, auf die das grüne Gebirge mit seinen Wäldern und schönbelaubten, zum Teil in Terrassen aufgeführten, Rebengeländern herabschaut. Es ist sein Zweifel, das Bergzabern, wie schon sein Name beweist, auf oder bei der Stelle erbaut ward, wo in der Vorzeit römische Tabernae (Montanae), oder Etappenorte für den Marsch der Truppen, errichtet waren, obwohl dies nicht aus alten Schriften, sondern allein durch Überlieferungen, bekannt ist. Im Mittelalter hieß der Ort bloß Zabern, auch Kleinzabern. Urkundlich wird derselbe erst im Jahr 1l80 genannt, und zwar als Villa (offener Ort mit einem Schlosse) der Grafen von Saarbrücken, deren einer, Namens Heinrich, bald darauf als erster Graf von Zweibrücken erscheint. Durch Kaiser Rudolph von Habsburg erhielt Bergzabern Gemeinderechte und Freiheiten wie die Stadt Hagenau. Nach Erlöschung jenes gräflichen Stammes kam es (1390) an die Pfalzgrafen am Rhein, und ward 1410 mit dem Herzogtume Zweibrücken vereint, dessen erster Landesherr Pfalzgraf Stephan war, dem sein Sohn Ludwig der Schwarze 1459 in der Regierung folgte. Die Stadt befand sich schon zur damaligen Zeit durch gute Verwaltung, Fruchtbarkeit des Bodens und den Gewerbfleiß ihrer Einwohner in einem sehr blühenden Zustande. Allein der verheerende 30jährige Krieg schuf ihr große Drangsale durch die Raubsucht der Spanier und kroatischer Horden, durch Pest, Hungersnot, etc.. Im darauf folgenden Jahre worden sie (1676, während der Weihnachtstage) von den Franzosen rein ausgeplündert, und, nebst dem Schlosse, niedergebrannt. Erst nach dem Frieden von 1714 stellte man beide wieder her. Die Stadt gelangte nach und nach zu neuem Wohlstande, und als die Herzogin Caroline von Zweibrücken 1744 ihren Wittwensitz auf dem hiesigen Schlosse nahm, wo sie an dreißig Jahre zubrachte, ward dasselbe noch verschönt und bequemer eingerichtet. Doch der Revolutionskrieg zerstörte wieder einen großen Teil dieses Baues. Bergzabern ist der Sitz des königlichen Landkommissaramts, überdies befindet sich hier ein Friedensgericht, ein Dekanat, ein Forstamt, ein Rentamt, ein Kantons Physikat, ein Notariat, ein Steuerkontroleur, ein Tierarzt und eine Posterpedition. Zum Gebiete der Stadt gehören noch zwei benachbarte Meierhöfe (der Herrschafts und Frauenberger Hof), zwei Mahlmühlen, eine Schneid und Ölmühle, und zwei Waffenschmieden. Die Zahl der Einwohner beträgt 2564, großen Teils Protestanten, die zwei Geistliche haben, wovon Einer Dekan ist, dann Katholiken, deren Pfarrer in dem benachbarten Dorfe Pleisweiler wohnt, und einige Juden. Feld und Weinbau sind Hauptnahrungszweige, doch gibt es hier auch mancherlei Gewerbe, vorzüglich Gerbereien. Eine bemerkenswerte Erscheinung, die sich besonders in den Gebirgswaldungen dieser Gegend sind, sind die so genannten Böheimer, eine Art Strichvogel, welche sich manchmal zur Winterzeit in ungeheuerer Zahl niederlassen, wo man sie leicht mit dem Blasrohre schießt und dann häusig verkauft. Ihr brausender Flug und ihr seltsames Geschrei bei Nacht haben schon unkundige Wanderer zu dem Gedanken verleitet, es könne hier das wilde Heer vorüberziehen. Dem Forstmeisteramte zu Bergzabern sind sieben, Teils in diesem, Teils in den Nachbarkantonen Annweiler und Dahn liegende, Revierförstereien untergeordnet. Noch fügen wir bei, das diese Stadt, ehemals der Sitz eines herzoglichen zweibrückischen Oberamts war. Darauf wurde sie unter der französischen Regierung der Hauptort eines Kantons.
Durch Bergzabern geht jetzt die von Landau über Weißenburg nach Straßburg führende Poststraße. Vorher zog sie durch das östlich von hier auf der Ebene liegende Dorf Barbelroth (410 Einwohner), wo die Posterpedition war, über Schweighofen (740 Einwohner) an der französischen Grenze. Ersteres gehörte ehemals dem Hause Zweibrücken, letzteres nebst Hof und Mühle, dem Bischof von Speyer. Der protestantische Pfarrer in Barbelroth hat die Schulinspektion. Auf dem Seitenwege von der Kantonsstadt nach Barbelroth kommt man über Kapellen und Drusweiler, am Erlenbache, welche beide Dörfer eine Gemeinde von 642 Einwohnern bilden. Sie waren ehedem Zweibrückisch. Ihr Bann umschließt noch zwei Meiereien, den Dentschhof, auch Sünken-Thierbach genannt, und den Kaplaneihof. Erster gehörte dem deutschen Orden und zu dessen unter französischer Hoheit gestandener Komthurei Weißenburg. Bei diesem Hofe ergießt sich der Dörrenbach in den Dierbach. Den Namen Drusweiler wollen Einige von dem römischen Feldherrn Drusus herleiten. Auch hat man in dieser Gegend sehr interessante römische Altertümer gefunden, welche in dem Intelligenzblatte des Rheinkreises von 18l9 beschrieben sind. Ein anderer Weg führt von Bergzabern westlich durch das Gebirg über Birkenhördt, (560 Einwohner), das am Erlenbache, im so genannten Abtswalde, liegt, und dann weiter über Dahn etc., nach Zweibrücken. Der genannte Forst, und noch ehe die Mundat Waldungen im Süden des Kantons, gehören zu den bedeutendsten der pfälzischen Lande. Die Poststraße lenkt jenseits Bergzabern in die Ebene und geht über Niederhorbach (590 Einwohner), am Horbach, und Ingenheim nach der drei Stunden entfernten Stadt Landau. Ingenheim, ein beträchtlicher Ort am Klingenbach, zählt 1631 Einwohner wo von etwa ein Drittel Juden sind. Hier ist die stärkste israelitische Gemeinde in der ganzen Pfalz. Auch hat sich dieselbe in neuerer Zeit eine schöne Synagoge erbaut. Ehemals gehörte Ingenheim den Freiherren von Gemmingen Hurnberg, als Mitgliedern des rheinischen Ritterkreises, jedoch unter französischer Hoheit. Der Bach treibt hier eine Mühle. Virkenhördt (mit der Ölmühle) war vorher Kurpfälzisch, Niederhorbach aber Zweibrückisch. Der katholische Pfarrer in Birkenhördt ist Schulinspektor.
Unweit dieses Ortes, gen Osten, liegt das Städtchen Billigheim, in einer anmutigen, wahrhaft idyllischen, mit reichen Fluren, Wiesen und Bäumen geschmückten Gegend, welche oberhalb der Stadt von dem Wäsch oder Klingbach, und unterhalb derselben von dem Kaiserbach, durchflossen wird, die sich bei dem nahen Dorfe Rohrbach vereinigen. Jeder dieser Bäche treibt eine Mühle. Mit solchen zählt Billigheim 1731, größten Teils protestantische, Einwohner Man hat die Erzählung bewahrt, das Julius Cäsar in dieser Gegend den deutschen König Ariovist besiegt, und darauf hier ein Kastell errichtet habe, woraus sich eine Stadt gebildet, die von den Landes Einwohnern Belliheim genannt, aber nochmals durch die Hunnen zerstört worden sei. Allein diese Sage wird durch die historische Nachricht widerlegt, dass jene Schlacht in Burgund, und zwar bei der Stadt Vesontium (Besancon) vorfiel. Erst in einer Urkunde vom Jahr 1235 wird des gegenwärtigen Ortes unter dem Namen Bullinkeim gedacht, der sich später in Billigkheim und Billigheim verwandelte. Ursprünglich ein unmittelbares Eigentum des Reichs kam derselbe durch Verpfändung an die Pfalz. Kaiser Friedrich III erteilte ihm 1450 Stadtgerechtigkeit, und zugleich einen Jahr und Wochenmarkt, welcher erstere Purzelmarkt genannt, als ein Fest für die ganze Gegend, stark besucht, wird. Durch Kurfürst Friedrich I (den Siegreichen) ward das bisherige Dorf mit Toren versehen, auch der noch stehende Turm erbaut, an welchem die Wappen dieses Fürsten und des damaligen Fauts von Germersheim, Hans von Gemmingen, ausgehauen sind. Als 1552 König Heinrich II. von Frankreich mit einem großen Heerzug unter Elsass überfiel, ließ Kurfürst Friedrich II in dieser Not Billigheim, auf den Rat seines hier geborenen Geheimschreibers Georg Weisbrod, mit Wall und Gräben befestigen, wovon man noch einige Spuren sieht. In der zweiten Hälfte des l7. Jahrhunderts kam eine wallonische Kolonie aus der Landschaft Calleve, im französischen Flandern, hier her, die von Kurfürst Karl Ludwig verschiedene Privilegien erhielt, und der man vorzüglich den trefflichen Anbau der umliegenden Felder dankte. Auch ist Billigheim der Geburtsort des gelehrten Theodor Gerlach, Billicanus genannt, der als Professor der Veredtsamkeit und Weltweisheit auf der hohen Schule zu Marburg angestellt war. Vor seiner Bereinigung mit Frankreich und späterhin mit Bayern war das Städtchen der Sitz eines kurpfälzischen Unteramtes, das zum Oberamte Germersheim gehörte. Jetzo befindet sich daselbst ein Notariat. Die ehemalige, von Landau nach Altstadt und Weißenburg führende, Poststraße geht hier vorbei. Der ehemals zum Amte Billigheim gehörige Ort Rohrbach zählt etwa 1490 Einwohner
Der angenehmste Weg von Bergzabern nach Landau, besonders für den Fußwanderer, ist der längs dem Gebirge, wo sich an den mannichfachen Höhen und in der Aussicht auf die herrliche, nach dem fernen Rheinstrome hinziehende, Ebene eine sehr reizende und malerische Naturseen eröffnet. Man kommt zuerst nach dem oben erwähnten Dorfe Pleisweiler, ehedem kurpfälzisch, das mit Oberhofen eine Gemeinde von beinahe 2000 Seelen bildet, und dessen Bann auch eine Wappenschmiede und eine Ziegelhütte enthält, sodann nach Gleiszellen, am Krebsbächlein, das mit dem links am Horbache liegenden Gleishorbach nur eine Gemeinde bildet. Auf einer Rebenhöhe, die sich zwischen beiden Dörfern erhebt, steht die Kirche. Man glaubt, das sich ehemals ein Kloster und einige Häuser, Zelle genannt und zur Abtei Klingenmünster gehörig, hier befanden, und nach Zerstörung derselben die zwei Orte am Fuße des Berges erbaut wurden. Auch wird diese Vermutung durch einige noch dort vorhandene Überreste bestätigt. Die Gemeinde stand einst unter dem kurpfälzischen Amte Landeck, und zählt dermalen an 930 Einwohner. Von hier gelangen wir nach dem beträchtlichen Marktflecken Klingenmünster, der, eine Stunde von Bergzabern, am Fuße der Vogesen und am Klingenbache liegt, von dem er seinen Namen hat. Dieser Bach entspringt im Gebirge, oberhalb Sültz, treibt an gegenwärtigem Orte eine Säge, eine Öl, eine Papier und drei Mahlmühlen, und stieß nach dem Rhein. Klingenmünster, dessen Gemarkung auch zwei Meierhöfe umfasst, hat schöne Felder, Wiesen und Weinberge, und ist besonders reich an Waldung. Die Zahl der Einwohner beträgt dermalen 1541. Zur kurpfälzischen Zeit gehörte der Ort zu dem gedachten Unteramte Landecken, Oberamt Germersheim. Das Stift Klingenmünster, von dem der Flecken einen Teil seiner Benennung erhielt, so das derselbe in der umliegenden Gegend auch gewöhnlich Münster heißt, war wohl das älteste Kloster in der Pfalzgrafschaft am Rhein. Es hatte seinen von dem Orte abgesonderten Umfang, und gehörte, unabhängig von dem Unteramte, zu der gleichnamigen Stiftsschaffnerei. Nach einer Bestätigungsurkunde Kaiser Heinrichs IV vom Jahr 1080 ward es von dem fränkischen Könige Dagobert (ungewiss, ob vom ersten oder zweiten dieses Namens) gegründet. Wegen der heiteren und angenehmen Gegend nannte man es damals Blidenfeld (wie sich denn das alt germanische Wort blithe, fröhlich, noch im Englischen bewahrte), sodann Klinga von seiner Lage am genannten Bache, welchen Namen ihm auch jene Urkunde verleiht, bis endlich der gegenwärtige üblich ward. Das mit Benediktinern bevölkerte, Stift wurde sehr reich, da es fast Niemand zinsbar war, und nur, außer dem täglichen Gebet für des Kaisers und des Reiches Wohl, dem Erzbischof von Mainz in Kriegszeiten einen Klepper, nebst einem Scheffel Weizenmehl, senden musste. Mehrere Grafen und Edelleute, wie die von Spanheim, Leiningen, Ochsenstein etc., waren von demselben mit Dörfern und Grundgütern belehnt. Aber durch Üppigkeit, Verschwendung und Zuchtlosigkeit, die unter den Mönchen einrissen, kam das Kloster nach und nach in Verfall, so das endlich der größte Teil seiner Besitzungen an verschiedene Fürsten und Herren veräußert wurde. Von den Äbten des Stiftes, deren Erster, Adelbert, aus dem berühmten schwäbischen Benediktinerkloster Hirsau im Jahr 990 hier her berufen ward, sind mehrere in der Geschichte des Landes angeführt. Der Abt Bernhard, genannt Schilling von Surburg, ein frommer und gelehrter Mann, suchte die unter einigen seiner Vorgänger zerrüttete Disziplin wieder Herzustellen und die verkauften Güter neu zu erwerben. Wenn ihm auch das Letztere durch Ersparung und Tätigkeit zum Teil gelang, so konnte er doch seine moralischen Zwecke nicht erreichen, weshalb er auch 1457 das ihm anvertraute Amt niederlegte. Der Letzte dieser geistlichen Oberherren war Eucharius von Weingarten. Unter seiner Verwaltung kam wieder Beides in Rückgang, der Geldmangel riss ein, und die Mönche wollten sich der vorgeschriebenen Ordnung und Lebensart nicht mehr fügen. Diese Umstände bewogen endlich selbst den Papst Innozenz VIII , die Abtei in ein weltliches Stift zu verwandeln. Die Mönche legten l491 ihre geistlichen Gewänder ab, wurden Chorherren, und erhielten Eucharius zum Probste. Ihm folgten in dieser Würde nacheinander Rupert und Johann, beide aus dem pfalzgräflichen Hause, und Wolf Böcklein. In dem bekannten Bauernkriege erfuhr das Stift großes Unheil, indem es (1552) von den Bewohnern einiger nahe liegender Dörfer geplündert und verwüstet ward. Kurfürst Friedrich III von der Pfalz, der die protestantische Lehre in seinen Landen einführte, zog dieses, wie andere Klöster, ein, und ließ sich 1567 alle Urkunden und Register der Kirche ausliefern. In dem französischen Reunionskriege ward zwar ein gewisser Abbe de Cartigni zum neuen Prälaten von Klingenmünster ernannt, aber seine Trägheit war nicht geeignet, diese Probstei wieder in Aufnahme zu bringen. Endlich nahm Kurpfalz im Jahr 1700 alle Gefälle derselben in Beschlag, und überwies sie nachgehends dem katholischen Kultus im Oberamte Germersheim. Von dem ehemaligen Kloster blieb nur ein altes Gebäude übrig, welches zu Getreidespeichern diente. Dabei war für den Stiftschassner eine besondere Wohnung erbaut. Auch diese Anstalt ward durch den französischen Revolutionskrieg und die aus ihm erfolgte Änderung der Dinge aufgehoben. Neben dem Mönchskloster soll, der Sage nach, ehedem auch ein Nonnenkloster zu St. Magdalena gestanden haben, auf dessen Stelle jetzt Wiesen und Weingärten angelegt sind.
Von dem waldigen Berge, an dessen, Fuß die Überreste der ehemaligen Abtei liegen, schaut noch die Ruine der alten Burg Landeck auf den Ort herab. Ihr Ursprung verliert sich in fabelhafte Zeiten. Man findet in den mit Wahrheit und Dichtung gemischten, Altertümern des Königreichs Austrasien die Nachricht, das Landfredus, ein Stadthalter der fränkischen Könige, im Jahr 420 das Bergschloss Landfreduseck erbaut, König Dagobert I dasselbe 620 erweitert und zum königlichen Stuhl (auf dem man die Gaugerichte hielt) für diese Gegend erwählt habe. Wenn auch diese Kunde nicht historisch begründet ist, so könnte doch die Burg Landeck noch früher, als das Kloster erbaut worden sein, und letzterem nach dessen Stiftung zum Schutze gedient haben. Lag ja doch, wie wir schon anderswo, der Meinung eines berühmten Schriftstellers zufolge, bemerkten, in dem Freiheit und Natur liebenden Charakter unserer altdeutschen Vorfahren die Neigung, sich auf weit umsehenden Höhen, von grünen Wäldern, wiesenreichen Tälern und klaren Bächen umringt, anzusiedeln. Daher entstanden jene uralten Felsburgen, die man in der nachmaligen Fehdezeit zu Schutz und Trutz gebraucht und noch vermehrt hat. Der Name des gegenwärtigen Schlosses soll von seiner Lage auf der höchsten Spitze oder Ecke dieses Landes herkommen. Die geschichtliche Urkunde, welche der Burg Landhechen (später Landeggen, Lanteck und Landeck) zuerst gedenkt, ist vom Jahr 1237. Damals scheinen sie die Grafen von Zweibrücken und von Leiningen, als unmittelbares Reichslehen, gemeinschaftlich besessen zu haben. Als während des stürmischen und für Deutschland so verderblichen Zwischenreichs die Rheinischen Städte einen bewaffneten Bund zu ihrer Sicherheit und zur Aufrechthaltung des Friedens geschlossen, entbrannte hierdurch manche Fehde mit dem hohen und niedern Adel. Da geschah es auch, das der Graf Emich von Leinnigen die Gesandten dieses Bundes, welche im September 1255 von Mainz her nach Straßburg zogen, in dieser Gegend anhalten und an der Feste Landeck eine Zeit lang gesänglich verwahren ließ. Nachmals Fiel der Leiningische Anteil dieser Burgen die Herren von Ochsenstein, und das Ganze wird im 14. Jahrhundert als ein Lehn der Abtei Klingenmünster genannt. Der Zweibrückische Teil kam nachmals an Kurpfalz, der Ochsensteiner an das Bistum Speyer, welches Letztere den seinigen 1709 ebenfalls dem Kurhause gegen Tausch abtrat, so das dieses nunmehr den Besitz des gesamten, nach dem alten Schlosse benannten, Amtes erhielt. Östlich von hier liegt das Dorf Klingen (550 Einwohner), am Klingenbach, wovon im 13. Jahrhundert ein ritterliches Geschlecht benannt ist, und weiter landeinwärts gewahrt man die Dörfer Heuchelheim, mit 820, und Appenhofen, mit 270 Einwohnern am Kaiserbache, die beide in den Lorscher Urkunden vom 8. Jahrhundert, ersteres als Huglinheim und Heuchlenheim (Sitz des Hugelins), letzteres als Abbenhova (Hof des Abbo), vorkommen. Alle drei waren Kurpfälzisch.
Gleich unterhalb Klingenmünster betritt man den Kanton Landau, wo denn der weitere Weg über das Dorf Eschbach, an welchem sich auf dem Berggipfel die Ruine der Madenburg erhebt, und dann rechts durch das flachere Land, nach der Stadt Landau führt. Ehe wir jedoch den Kanton Bergzabern verlassen, sei besonders noch das beträchtliche Dorf Dörrenbach erwähnt, das, südwestlich von dem Hauptort, über, einem Bergtal und am Ursprung des Dörrenbaches gelegen ist. In der Nähe befindet sich die Kolbruunderger Kapelle mit einem Eremiten sitzend. Ein ähnliches, dem heiligen Wendelin geweihtes Kirchlein, nebst Einsiedelei, liegt oberhalb der Stadt Bergzabern. Dörrenbach ist dadurch historisch merkwürdig, das im Mittelalter hier ein Behmgericht soll gewesen sein. Der Ort zu dem eine Loh , Öl, und andere Mühlen, wie auch die so genannte Zöpfelslust Wohnung, gehören, zählt 1181 Einwohner die Feld und Wiesenbau treiben. In alten Urkunden heißt er Türrenbach. Noch übrige Orte des Kantons sind im Gebirge, Die ehemals Kurpfälzischen Dörfer Blankenborn (152 Einwohner) und Bellenborn mit Reichsdorf l290 Einwohner). Dann östlich in der Ebene Mühlhofen, 676, Oberhausen, mit einer Mühle am Erienbach, 500, Hergersweiler, 162, und Dierbach, 617 Einwohner zählend. Sämtlich vorher Zweibrückisch Ferner nach Süden Steinfeld, mit dem Weiler Klein Steinfeld, 16l2 Seelen stark und Kapsweier (1014 Einwohner), mit ersterem vor dem der Probstei Weißenburg unter französischer Hoheit gehörig.
Land Kommissariat Bergzabern
Kanton Annweiler
Dieser sehr große Kanton, welcher den von Bergzabern südlich begrenzt, unterscheidet sich von demselben wesentlich dadurch, dass man hier keine fruchtbare Ebene, sondern grössen teils raue, gebirgige und mit Waldungen bedeckte, Gegenden sind. Darum ist auch das Klima weniger mild und der Boden lange nicht so ergiebig. Kartoffeln, Gerste und Hafer sind Hauptprodukte, doch gibt es auch Stellen, wo der Weinstock ziemlich gut gedeiht und schöne Baumfrüchte, sogar etwas Kastanien, erzielt werden. Was aber den Reisenden, der ein Freund der schönen Natur und der Denkmäler des Altertums ist, in diesem Landstriche besonders anzieht, sind die malerischen, wildromantischen Täler, ihre lieblichen Wiesen, von Bächen durchströmt, die schauerlichen Felsgruppen, und die hohen steilen Gebirge, auf deren Gipfeln man die Ruinen alter Burgen erblickt, die eben so seltsam durch ihre Lage, als merkwürdig in den Geschichten und Sagen der rheinischen Vorzeit erscheinen.
Wir treten zuerst unsere Wanderung nach dem herrlichen Annweiler Tale an, wohin gewöhnlich der Weg von Landau her über Sibeldingen, an Godramstein vorbei, genommen wird. Der erste Ort des Kantons, den man auf dieser Seite betritt, ist Albersweiler, ein Marktflecken von 2160 Seelen, grössen teils protestantischer Religion. Er liegt am Eingange des Tals, und wird von der Queich durchflossen, nach welcher jenes auch das Queichtal genannt ist, indem es von hier an derselben hin und bis hinter Falkenburg sanft bergan zieht, worauf es sich wieder längs dem Horbach gegen die Wieslauter herabsenkt. Die Queich durchläuft den ganzen Kanton, nimmt rechts im Gebirge den Rinn und Ebersbach, links den vereinten Fisch und Wellbach, sodann die Sülz, auf, und teilt sich bei Albersweiler in zwei Arme, wovon der linke das eigentliche Flüsschen bleibt, der rechte aber im Jahr 1686 durch den berühmten Ingenieur Bauban, zum Behuf des Festungsbaues von Landau, als Kanal angelegt wurde, der sich bei dieser Stadt wieder mit dem Gewässer des andern vereint. Albersweiler wird in einer Urkunde von 1254 Adelbrachteswilre genannt, da ein adliches Geschlecht dieses Namens vorkommt. Später hieß der Ort Älbrechtswilre, dann Albirswilre etc., bis er endlich den gegenwärtigen Namen erhielt. In dem nahen, von Rebenhügeln eingeschlossenen, Tälchen, am Schweltenbächlein, liegt der Weiler Kanskirchen oder St. Johann, der, nebst dem Steigerthof, (welcher sich am so genannten Steigert, einem über das Gebirge nach der Burg Scharfeneck führenden Wege befindet,) der Ziegelhütte und Waffenschmiede, zur Gemeinde Albersweiler gehört, (ehemals stand die Südseite des letztern Ortes unter Zweibrücken, die Nordseite aber, nebst Kanskirchen und dem Steigerhofe, besaßen die Fürsten von Löwenstein Werthheim wegen der Herrschaft Scharfeneck. Der schon im Anfang des l3. Jahrhunderts erwähnte, Name Kanskirchen entstand aus Johanniskirch den, wie noch jetzt die dortige Kirche heißt. In diesem Örtchen bestand auch einst ein Frauenkloster. Albersweiler hat schöne Weinberge und betreibt die Kultur derselben stärker, als irgendeine Gemeinde des Kantons. Auch ist dabei ein sehr ergiebiger Granitsteinbruch. Durch den Ort geht die Straße, welche von Landau über Annweiler und Pirmasens nach Zweibrücken zieht.
Unsern Weg auf dieser Straße, an dem Ufer der Queich hin, fortsetzend, kommen wir bald nach dem Städtchen Annweiler, das eine dreiviertel Stunde von hier und 2 Stunden von Landau entfernt ist. Mit Recht wird seine malerische Lage gerühmt. Ein anmutiges Wiesenthal, durch welches der starke helle Bach, an dessen beiden Ufern der Ort erbaut ist, heranfurtet, erstreckt sich zwischen waldreichen Höhen, auf welchen hier und da die Trümmer zerfallener Burgen emporragen. In mancher wunderlichen Form erscheinen die Felsen, Kolosse des Gebirges, deren einige wie alte Schlösser, andere, in größerer Masse, wie ganze Dörfer von der Natur gestaltet sind. Diesen seltsamen Anblick hat man besonders auf dem Fußwege, der von Annweiler aus durch die wilde Gegend nach Dahn führt. Die Stadt Annweiler (ehemals Anwilre, Annewil und Anninwilir) bestand, nach Urkunden, schon im Anfange des 12. Jahrhunderts als Dorf, welches Friedrich II Herzog in Schwaben, 1116 gegen Mornsbrunn (im Elsass, an der Sur) eintauschte. (Siehe Urgeschichte des Herzogtums Zweibrücken, nach Johaunis und Crollius Kalenderarbeiten) Kaiser Friedrich I (Barbarossa), Sohn des genannten Herzogs, umgab den Ort mit Mauern, und erklärte ihn somit zur Stad. Nach Herzogs klassischer Chronik wurde ihm zugleich Friedrichs Gemahlin Anna der lateinische Name Annae Villa erteilt. Der Enkel dieses Kaisers, Friedrich II verlieh demselben sogar die Rechte und Freiheiten der Stadt Speyer. Nach Abgang des Hohen, staufischen Hauses ward Annweiler (1269) eine Reichsstadt. Aber Kaiser Ludwig IV verpfändete diese 1330 an seine Neffen, die Pfalzgrafen. Jedoch mit Bestätigung ihrer Reichsfreiheiten, und endlich kam sie ganz in Besitz des Pfalzgräflichen Hauses, und namentlich der Herzöge von Zweibrücken, als eine zu dem Oberamte Bergzabern gehörigen Stadtschultheiserei, bis sie in neuerer Zeit das wechselnde Los der ganzen Gegend teilte. Dermalen ist Annweiler der Hauptort des Kantons, und es befinden sich hier ein Friedensgericht, zwei Notariate, eine Gendarmerie Station, ein Physikat, ein Rentamt und ein Forstamt, zu welchem letztern 5 Revierförstereien im Kanton gehören. Die Stadt, nebst dem Dorfe Sarnstal, mit welchem sie eine Gemeinde bildet, der Minken und Michelischen Papiermühle , zählt 2602, meist protestantische, Einwohner Weinbau, starke Obstpflanzung und Viehzucht, welche die grasreichen Täler sehr begünstigen, sind Haupterwerbzweige. Auch wird hier Holzhandel getrieben, und Leder, Papier und Kirschenwasser verfertigt. Der beste Gasthof ist der zum Trifels. Das genannte Dorf Sarnstal (von einigen auch Sarnstall geschrieben) liegt unweit der Stadt am Queichflusse. Professor Crollius konnte von ihm keine Nachrichten vor dem 15. Jahrhundert auffinden. Beide Konfessionen in Annweiler haben Pfarreien, mit der katholischen ist zugleich eine Schulinspektion vereint.
Wenden wir uns jetzt nach den östlich von hier aufsteigenden Höhen des Vogesischen Gebirges, wo auf dem erhabensten Gipfel des in drei Felsenspitzen geteilten Hag oder Sonnenbergs die uralte Feste Trifels steht. Ein schöner Waldweg, der unter Leitung des Königlich Bayrischen Herrn Forstmeisters Cramer angelegt worden, führt den Wanderer in einer kleinen Stunde von Annweiler zu dieser durch Geschichte und Sage so merkwürdigen Stelle hinauf. Dies war vorher ein schmaler Pfad für Fußgänger. Ehedem befand sich hier noch ein Weg, der Eselssteig genannt, auf welchem die Burgbewohner ihre Lebensmittel durch Esel hinaufbringen ließen, und ein Dritter, dort in Krümmungen am steilen Berg hinanlief und zum Reiten und Fahren gebraucht wurde. Man gelangt nun, an einem tiefen, in den Fels gehauenen und von einem Turme beschirmten, Brunnen vorbei, in das Innere der Burg. Ihr hoher, viereckiger, aus Quadersteinen erbauter, Turm, steht durch mehrere Bogen, wovon einer noch in gutem Stande ist, mit jenem in Verbindung. Einige Gemächer der Ruine sind ziemlich erhalten, und auf steinernen Treppen gelangt man zu den Überresten der Kapelle, wo, historischen Nachrichten zufolge, von 1125 bis 1273 die Reichskleinodien, oder der kaiserliche Krönungsschmuck, aufbewahrt wurden. Hinter diesen Gebäuden sind nur mächtige Trümmer. Doch bestehen noch einige unterirdische Gewölbe, die wahrscheinlich zu Gefängnissen bestimmt waren. Herrlich ist von dieser Bergkuppe die Aussicht auf das romantische, von der Queich durchströmte Annweiler Tal, wo sich eine mannichfache Naturseen von grünen Auen, Rebenhügeln, düsterer Waldung und grotesken Steinmassen ausbreiten, dann rings auf die wilden Höhen, welche enge Täler trennen, und endlich nach Osten hin, zwischen zwei Bergen hindurch, in die lachende, unübersehbare Ebene, diesernhin der stolze Rhein wie ein Silberband umwindet. Auf dem zweiten, von diesem durch ein kleines Tal geschiedenen, Gipfel des Sonnenberges blickt man die Trümmer der ehemaligen Feste Anebos. Oben ist eine Felsenplatte, zu der, wie an den Spuren erkenntlich, ehedem eine Treppe geführt hat. Einst nannte sich ein adliches Geschlecht von dieser Burg, wie denn in Urkunden von 1194 und 1197 zwei Brüder, Eberhard und Heinrich, als Marschälle von Anebos erwähnt sind. Gegenwärtig ist dieser Platz nur ein Chaos von Felsstücken und zerfallenem Mauerwerk, wo man noch den Schutt einer gewesenen Ringmauer und die Spur eines in den Stein gehauenen Grabens wahrnimmt. Die dritte und niedrigste Bergspitze trägt die Ruine von Scharfenberg, in der Gegend unter dem Namen die Münze bekannt. Das Hinansteigen durch das dichte Gebüsch, womit die Felsen bewachsen sind, während immer Steine herabrollen, geschieht mit vieler Mühe und Beschwerde. Auch bei dieser Burg befindet sich ein tiefer Brunnen, und ein, noch ziemlich erhaltener, viereckiger Turm, etwa 150 Fuß hoch. Man steht hier von düsterer Wildnis umgeben, aber die ringshin sich verbreitende Aussicht ist noch freier und mannichfaltiger, als auf dem Trifels. In der Nähe überrascht das Auge ein hoher Felsenkoloss, der Asselstein genannt, und in der Ferne ragt der Engelsberg empor, wo sich ein merkwürdiges Denkmal der Vorzeit befindet, nämlich zwei ungeheure Steine, über welchen horizontal ein drittes Felsenstück von gleicher Größe ruht. Mit Recht schließt man aus dieser Form, das das Monument altkeltischen Ursprungs sei. Schon in Urkunden des 12 und l3 Jahrhunderts kommen Ritter von Scharfenberg vor. Nach verschiedenen Wechseln wird die Burg ein Reichslehen, das aber Kaiser Ludwig IV. dem Abte zu Weißenburg überließ. Im 15. Jahrhundert bemächtigten sich ihrer die Pfalzgrafen des Zweibrückischen Hauses. Die deshalb entstandene Fehde, worin das Stift von Kurpfalz unterstützt wurde, beschloss ein Vergleich, wonach der Herzog von Zweibrücken dieses Schloss von Weißenburg zu Lehen nahm. Aber es ward, wie viele andere Burgen an den Vogesen, in dem Bauernaufstande um das Jahr 1525 durch Feuer verheert, und der damalige Inhaber und herzogliche Lehnsmann, Ritter Christoph Landschad von Steinach, war außer Stand, es wieder aufzubauen. Der dreißigjährige und der nach ihm erfolgte französische Reunions Krieg vollendeten die gänzliche Zerstörung dieser Feste.