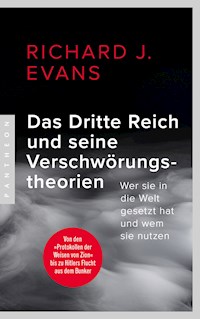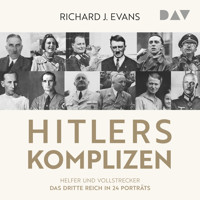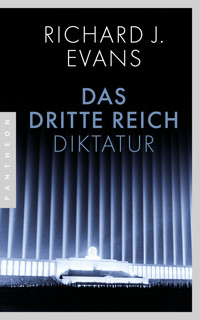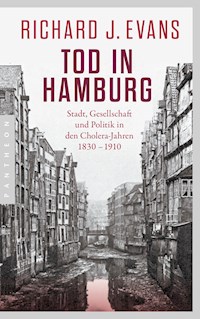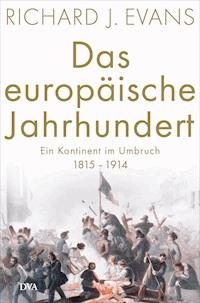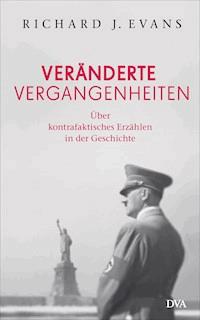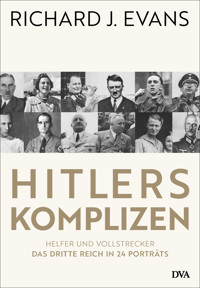
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Sunday-Times-Bestseller von NS-Experte Sir Richard Evans über Hitlers Helfer und Vollstrecker - von Paladinen wie Göring, Goebbels, Himmler bis zu Propagandisten wie Riefenstahl und Handlangern wie Irma Grese und Paul Zapp
Wer waren die Nazis? Verfolgten sie kriminelle Absichten, oder waren sie »gewöhnliche Deutsche«? Was brachte sie dazu, furchtbare Gräuel gegen wirkliche oder eingebildete Feinde zu begehen oder zu billigen? Warum waren so viele Deutsche an den Verbrechen beteiligt? Wie kam es, dass sie Hitler fast bis zum Ende folgten?
Der renommierte Historiker Richard J. Evans zeichnet oft verblüffend neue Porträts der Männer und Frauen, die NS-Deutschland schufen und ihm dienten, angefangen bei Hitler über Paladine wie Göring, Goebbels und Himmler bis zu Exekutoren wie Eichmann und Heydrich, Propagandisten wie Leni Riefenstahl, Täter wie die berüchtigte KZ-Aufseherin Irma Grese und unbekannte Sympathisanten und Mitläufer, die das Regime auf vielfältige Weise unterstützten. Evans hilft die Struktur des Dritten Reiches besser zu verstehen und zeigt auf, wie weit Einzelne gehen, wenn der moralische Kompass abhandengekommen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1135
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Der renommierte Historiker Richard J. Evans zeichnet oft verblüffend neue Porträts der Männer und Frauen, die NS-Deutschland schufen und ihm dienten, angefangen bei Hitler über Paladine wie Göring, Goebbels und Himmler bis zu Exekutoren wie Eichmann und Heydrich, Propagandisten wie Leni Riefenstahl, Tätern wie der berüchtigten KZ-Aufseherin Irma Grese und unbekannten Sympathisanten und Mitläufern, die das Regime auf vielfältige Weise unterstützten. Evans hilft, die Struktur des Dritten Reiches besser zu verstehen, und zeigt auf, wie weit Einzelne gehen, wenn der moralische Kompass abhandengekommen ist.
Autor
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt. Zuletzt sind von ihm erschienen Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch – 1815 – 1914 (2018) und Das Dritte Reich und seine Verschwörungstheorien (2021).
Richard J. Evans
Hitlers Komplizen
Helfer und Vollstrecker: Das Dritte Reich in 24 Porträts
Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt
Deutsche Verlags-Anstalt
Die Originalausgabe dieses Buches erschien 2024 unter dem Titel Hitler’s People. The Faces of the Third Reich bei Allen Lane, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Richard J. Evans
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildungen: © Imagno/Getty Images (Papen); © picture alliance/United Archives (Riefenstahl); © Bettmann/Getty Images (Rosenberg, Göring); © Universal History Archive/Getty Images (Goebbels); © Ullstein Bild/Getty Images (Himmler, Heydrich); © picture alliance/SZ Photo (Heß); © Ullstein Bild/Getty Images (Streicher, Hitler); © FPG/Archive Photos/Getty Images (Ley); © Staatsarchiv Hamburg (Solmitz-Nachlass, Bestand 622-1/140 Solmitz, Akte 16) (Solmitz); © Heinrich Hoffmann/Ullstein Bild/Getty Images (Leeb); © public domain sourced/access rights from CBW/Alamy Stock Photo (Eichmann); © Apic/Getty Images (Grese); © Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images (Brandt)
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-27570-9V001
www.dva.de
In Erinnerung an John Dixon Walsh (1927–2022), der mich Geschichte lehrte
Inhalt
Vorwort
Prolog Eine Frau vor Gericht
Teil I Der Führer
Einleitung
1 Der Diktator: Adolf Hitler
Teil II Die Paladine
Einleitung
2 Der »Eiserne«: Hermann Göring
3 Der Propagandist: Joseph Goebbels
4 Der Soldat: Ernst Röhm
5 Der Polizist: Heinrich Himmler
6 Der Diplomat: Joachim von Ribbentrop
7 Der Philosoph: Alfred Rosenberg
8 Der Architekt: Albert Speer
Teil III Die Vollstrecker
Einleitung
9 Der Stellvertreter: Rudolf Heß
10 Der Kollaborateur: Franz von Papen
11 Der »Arbeiter«: Robert Ley
12 Der Schulmeister: Julius Streicher
13 Der Henker: Reinhard Heydrich
14 Der Bürokrat: Adolf Eichmann
15 Das Großmaul: Hans Frank
Teil IV Die Werkzeuge
Einleitung
16 Der General: Wilhelm Ritter von Leeb
17 Der Akademiker: Karl Brandt
18 Die Mörder: Paul Zapp und Egon Zill
19 Die »Hexe« und das »Ungeheuer«: Ilse Koch und Irma Grese
20 Die Mutter: Gertrud Scholtz-Klink
21 Der Star: Leni Riefenstahl
22 Die Denunziantin: Luise Solmitz
Schlussbetrachtung
Epilog Die Frau im Zug
Bibliografie
Anmerkungen
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Vorwort
Wer waren die Nazis? Was motivierte die Anführer und Funktionäre der NS-Bewegung und diejenigen, die ihr Projekt verwirklichten? Was war mit ihrem moralischen Kompass passiert? Waren sie in gewisser Weise abartig, gestört oder degeneriert? Waren sie Gangster, die mit krimineller Absicht handelten? Oder waren sie »gewöhnliche Männer« – und einige wenige Frauen – oder, vielleicht genauer gesagt, »gewöhnliche Deutsche«? Stammten sie vom Rand der Gesellschaft, waren sie Außenseiter, oder gehörten sie in mancher Hinsicht zur Mitte der Gesellschaft? Und wie lässt sich Hitlers Drang nach diktatorischer Macht erklären? War er eine Art leerer Hülle ohne persönliche Eigenschaften und persönliches Leben, in welche die Deutschen ihre tiefsten politischen Ambitionen und Wünsche projizierten? Was brachte ansonsten normale Menschen dazu, furchtbare mörderische Gräueltaten gegen wirkliche oder eingebildete Feinde des Nationalsozialismus auszuführen oder zu billigen? Oder waren sie vielleicht gar nicht normal? Warum beteiligten sich darüber hinaus so viele führende Deutsche auf verantwortungsvollen Posten in Schlüsselinstitutionen der Gesellschaft an Diktatur, Krieg und Völkermord? Und was dachten diejenigen, die den Krieg überlebten, über ihr Verhalten im Dritten Reich? Nahmen sie eine moralische Haltung ein, bereuten sie und sahen ein, was sie getan hatten?
Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieses Buchs. In letzter Zeit haben sie neue Dringlichkeit und Bedeutung gewonnen, denn seit Anfang des 21. Jahrhunderts sind in vielen Ländern der Welt demokratische Institutionen in Bedrängnis geraten. Sogenannte starke Männer und Möchtegerndiktatoren sind hervorgetreten und haben sich, häufig mit starker öffentlicher Unterstützung, darangemacht, die Demokratie zu unterminieren, die Medien zu knebeln, die Justiz zu kontrollieren, jede Opposition zu unterdrücken und die grundlegenden Menschenrechte auszuhebeln. Politische Korruption, Lügen, Ehrlosigkeit und Täuschung sind zur neuen Währung der Politik geworden – mit verheerenden Folgen für unsere Grundfreiheiten. Von skrupellosen Politikern geschürt, nehmen der Hass auf Minderheiten und deren Verfolgung zu. Die Zukunft ist eingetrübt, die Aussichten für Freiheit und Demokratie sind ungewiss.
Wie sind der Aufstieg und Triumph von Tyrannen und Scharlatanen zu erklären? Wie kommt es, dass jemand von einem Verlangen nach Macht und Herrschaft ergriffen wird? Warum gelingt es solchen Männern – und es sind fast immer Männer –, Anhänger und Unterstützer um sich zu scharen, die bereit sind, ihre Befehle auszuführen? Ist der gesellschaftliche Moralkodex so schwach oder so verzerrt, dass ihre Bereitschaft, konventionelle Regeln des menschlichen Anstands zu verletzen, grenzenlos ist? In dieser betrüblichen Situation suchen viele Menschen in der Vergangenheit nach Antworten. Paradigmatisch für den Zusammenbruch der Demokratie und den Triumph der Diktatur bleiben nach wie vor das Schicksal der Weimarer Republik und der Aufstieg der Nationalsozialisten. Hitler und sein Kreis sind auf vielerlei Weise interpretiert worden: als Gruppe von Psychopathen, Verbrecherbande, Ansammlung von Außenseitern und sogar als moderne Version der gestörtesten und zerstörerischsten Herrscher des antiken Roms und ihres Hofstaats. Nicht selten wurden sie als geisteskrank oder wenigstens irgendwie psychisch gestört beschrieben. In diesem Buch werden diejenigen, die die fragile Weimarer Republik zu Fall brachten, das Dritte Reich errichteten, es über ein Jahrzehnt aufrechterhielten und in Krieg, Völkermord und Selbstzerstörung führten, genauer unter die Lupe genommen. Nur durch die Untersuchung der individuellen Persönlichkeiten und ihrer jeweiligen Geschichte kann man hoffen, die pervertierte Moral zu verstehen, die das NS-Regime ermöglichte, und daraus vielleicht einige Lehren für unsere eigene unruhige Zeit zu gewinnen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der biografische Ansatz jedoch für ein halbes Jahrhundert verpönt, besonders in Deutschland. Der Grund lag auf der Hand: Im Nationalsozialismus hatte der Kult des »großen Mannes« einen katastrophalen Höhepunkt erlebt und sich als gefährlich undemokratisches Gesellschaftsverständnis herausgestellt. Führende Historiker des Nationalsozialismus wie Hans Mommsen betonten stattdessen die Rolle von strukturellen Faktoren, Institutionen und Verfahren. Mommsen glaubte sogar, dass der Nationalsozialismus und das Dritte Reich leichter zu verstehen seien, wenn man Individuen ganz aus der Geschichte herauslässt.[1] Allgemein scheint man in Deutschland der Ansicht zu sein, dass eine Betonung der Bedeutung Einzelner in der NS-Bewegung und im Dritten Reich von der Rolle ablenke, die deutsche Institutionen und Traditionen und generell die deutsche Bevölkerung selbst in diesem dunkelsten Kapitel der neueren Geschichte gespielt haben. Alles Hitler und seinen unmittelbaren Gefolgsleuten anzulasten, sähe zu sehr wie eine Entschuldigung der großen Masse der Deutschen aus.
In den letzten Jahrzehnten ist eine riesige Zahl von Untersuchungen über die soziale und institutionelle Geschichte Deutschlands und der Deutschen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht worden. Paradoxerweise haben sie die Aufmerksamkeit der Historiker, wenn auch auf andere, differenziertere Weise, erneut auf die Anführer und Gefolgsleute der NS-Bewegung und des NS-Regimes gelenkt, indem sie die Frage aufwarfen, wer und von welcher Art diese Personen waren, wie viel Macht sie besaßen und wie sie bei der Schaffung und Führung des mörderischsten und zerstörerischsten Regimes in der Menschheitsgeschichte zusammenarbeiteten. Immerhin waren sie Individuen, häufig von scharf ausgeprägter Persönlichkeit, deren Denken und Handeln materielle Auswirkungen hatten, insbesondere in einer Diktatur, die ihren Begierden und Wünschen, ihren Ideen und Taten und ihrer Machtgier kaum Grenzen setzte.
Infolgedessen sind in jüngster Zeit sowohl große, gut recherchierte Biografien buchstäblich aller wichtigen NS-Führer als auch zahlreiche Studien über Personen auf den unteren Ebenen der Machthierarchie erschienen. Zudem hat die Veröffentlichung von Tagebüchern, Briefen und Memoiren sowie von kommentierten Ausgaben von Dokumenten und zahlreichen zuvor unzugänglichen Quellen aller Art das Wissen über Männer wie Goebbels, Speer, Himmler, Rosenberg und auch Hitler selbst vertieft. Auch über die gewöhnlichen Deutschen der NS-Ära, einschließlich der untergeordneten Täter, wissen wir heute erheblich mehr, über ihre Motive und die Gründe, aus denen sie dem Regime mit solcher Skrupellosigkeit dienten. Auch auf diesem Gebiet sind Briefe, Tagebücher und Memoiren erschienen, häufig von sehr einfachen Menschen. Dieses ebenso reichhaltige wie komplexe neue Material hat das Verständnis der Probleme, vor denen Menschen in Hitlerdeutschland standen, und der Art, wie sie mit ihnen fertigzuwerden versuchten, vergrößert. Die Vertiefung und Erweiterung des Wissens über die NS-Bewegung und die NS-Diktatur reichen die Skala der Verantwortlichkeit und Komplizenschaft weit hinab, und der biografische Ansatz, der sich häufig auf Material stützt, das in Gerichtsprozessen der Nachkriegszeit vorgelegt wurde, hat sich etwa seit der Jahrhundertwende als ein Eckpfeiler der »Täterforschung« etabliert. Die Grundlagen für eine Beantwortung der am Anfang dieses Buchs gestellten Fragen sind heute in weit größerem Maß zugänglich als vor zwanzig Jahren.[2]
Die hier im Mittelpunkt stehenden Personen stammen aus allen Hierarchiestufen, von Hitler selbst hinunter bis zu den untersten Rängen der NS-Partei und darüber hinaus. Die vorliegende Arbeit nimmt sich bewusst die klassische Studie des deutschen Historikers, Journalisten und Rundfunkautors Joachim C. FestDas Gesicht des Dritten Reiches zum Vorbild. Sie wurde nach ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 1963 sofort zu einem Beststeller und seither zahllose Male neu aufgelegt und in viele Sprachen übersetzt. Auch über sechzig Jahre nach ihrem Erscheinen ist sie immer noch eine lohnende Lektüre, auch wenn sie in vielen Details nicht mehr auf dem Stand der historischen Forschung ist. Darüber hinaus hat sich das Gesamtverständnis des nationalsozialistischen Deutschland seit den 1960er Jahren tiefgreifend verändert. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, der sich damals auf seinem Höhepunkt befand, betrachtete Fest das Dritte Reich als mit Stalins Diktatur in der Sowjetunion vergleichbares »totalitäres« Regime. Das Ende des Kalten Krieges in Europa hat zu einem Perspektivenwechsel geführt, der von Entwicklungen innerhalb des Fachgebiets der Historiografie selbst unterstützt wurde. Das Bild des NS-Regimes ist komplexer geworden, und die Frage, wie Menschen zu »Tätern«, »Zuschauern« oder »Opfern« werden – um Kategorien zu verwenden, die selbst hinterfragt und in nuancierter, differenzierter Weise verwendet werden müssen –, ist in einen weiteren Kontext von Zwang und Zustimmung zu stellen. Die Menschen trafen, anders ausgedrückt, ihre Entscheidungen nicht als moralisch autonome Individuen, die in einem von ihrem historischen Kontext unbeeinflussten Vakuum agierten. Aber sie waren auch keine Automaten ohne jede Urteilskraft, die einfach taten, was ihnen gesagt wurde. Die Gründe für ihre Entscheidungen sind nicht nur in ihrer individuellen psychologischen Verfassung zu suchen, sondern ebenso in ihren Reaktionen auf die Situationen, in die sie gerieten, und in ihren Beziehungen zur sie umgebenden breiteren Gesellschaft.[3]
Vor rund zwei Jahrzehnten versuchte ich, den Nationalsozialismus durch eine groß angelegte historiografische Erzählung über das Dritte Reich zu erklären. Nach dem Erscheinen des dritten und letzten Bandes im Jahr 2008 wandte ich mich anderen Projekten zu.[4] Als ich mich erneut mit NS-Deutschland zu beschäftigen begann, stellte ich fest, dass sich viel verändert hatte: Neue Forschungsergebnisse, neue Archiventdeckungen und neue, zuvor unveröffentlichte Dokumente waren zugänglich geworden, und neue Studien hatten frische Perspektiven eröffnet und Neuinterpretationen zur Diskussion gestellt. Das Aufkommen einer Klasse von skrupellosen populistischen Politikern in unserer eigenen Zeit, die sich nicht darum scheren, ob das, was sie sagen, wahr ist, und das massive Wachstum des Internets und der sozialen Medien haben eine weitverbreitete Unsicherheit in Bezug auf die Wahrheit hervorgerufen, gepaart mit einer Geringschätzung beweisgestützter Aussagen sowie der Arbeit von Wissenschaftlern und Experten. All dies hat bei mir ein Nachdenken über meine frühere Arbeit ausgelöst, und das vorliegende Buch hat mir die Gelegenheit gegeben, mir meine damaligen Schlussfolgerungen vorzunehmen und sie in manchen Fällen zu überdenken. Mich aus einem anderen Blickwinkel – dem biografischen – wieder mit NS-Deutschland zu beschäftigen, war ein faszinierendes, lohnenswertes Unternehmen.
Das Buch teilt sich in vier Teile auf. Der erste beschäftigt sich erneut mit Adolf Hitler, dem »Führer«. Im zweiten Teil wird der engste Kreis seiner Untergebenen in den Blick genommen. Der dritte Teil erzählt die Geschichten von Wegbereitern und Vollstreckern der NS-Ideologie. Der vierte Teil schließlich handelt von einigen untergeordneten Tätern und Werkzeugen des Regimes. Dies ist kein biografisches Lexikon, sondern eine Sammlung miteinander verknüpfter biografischer Essays und Überlegungen über einzelne Persönlichkeiten. Die Auswahl ist notgedrungen mehr oder weniger willkürlich. Joachim C. Fest etwa widmet ein Kapitel Martin Bormann; doch über diese schattenhafte Figur, die weithin hinter den Kulissen agierte und erst gegen Ende des Regimes größere Bedeutung erlangte, ist relativ wenig bekannt. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, ihn wegzulassen. Ferner habe ich anstelle eines Kapitels über »Intellektuelle«, in dem Fest hauptsächlich literarische Figuren behandelte, eines über Akademiker, vor allem Mediziner, aufgenommen. Auch habe ich »gewöhnliche« Täter, die in Fests Studie weder als Gruppe noch als Individuen klar hervortreten, in die Untersuchung einbezogen. Fests Buch enthält ein allgemeines Kapitel über Frauen, das jedoch eines der schwächsten der Studie ist. Ich beschäftige mich stattdessen mit einer Reihe bestimmter Frauen, von fanatischen Anhängerinnen des Regimes bis zu »Trittbrettfahrerinnen« und Profiteurinnen der NS-Herrschaft. Jedes Kapitel kann als einzelne Arbeit gelesen werden, unabhängig davon, was ihm vorangeht; dies machte allerdings einige Wiederholungen erforderlich, die ich jedoch auf ein Minimum zu beschränken versucht habe. Das Eröffnungskapitel über Hitler ist sowohl eine Untersuchung über die Schlüsselfigur der gesamten Geschichte als auch der narrative Hintergrund, vor dem die nachfolgenden Kapitel gelesen werden müssen, sodass ich es, wie ich hoffe, vermieden habe, mich ständig zu wiederholen.
Als ich dieses Buch zu schreiben begann, trieb mich Neugier an: Nach vielen Jahren der Lehre und Forschung über das Dritte Reich hatte ich das Gefühl, weit mehr über die großen historischen Prozesse und die Folgen der NS-Herrschaft zu wissen als über deren individuelle Führungsfiguren und Anhänger, deren Charakter ich, wie ich mir eingestehen musste, in vielen Fällen nicht ganz verstand. Der vorliegende Band ist ein Versuch, die Persönlichkeiten der Täter im Rahmen ihres sozialen und politischen Kontexts zu verstehen. Aber ich hoffe, dass außerdem wenigstens auch einige Muster und Gemeinsamkeiten deutlich werden. Bei meinen Erkundungen haben mich viele Einzelpersonen und Institutionen unterstützt. Ohne die enormen Ressourcen der Bibliothek der Cambridge University, deren Bestände über die deutsche Zeitgeschichte unübertroffen sind, hätte ich dieses Unterfangen nicht einmal beginnen können. Viele Menschen haben mir geduldig zugehört, wenn ich meinen Ansatz zu erklären versuchte, und ich habe enorm von ihren Gegenargumenten profitiert. Eine lehrreiche, lohnende Erfahrung, die mir viel gebracht hat, war die Zusammenarbeit mit Ella Wright, Helen Sage und dem gesamten Team von 72 Films an der Dokumentation Der Aufstieg der Nazis für BBC 2 und auf der anderen Seite des Atlantiks mit Rachael Profiloski, Axel Gerdau und dem Team von Spectacle Films. Eine Reihe von Freunden und Kollegen haben das Manuskript gelesen, und ich bin Joanna Bourke, Niamh Gallagher, Jan Rueger, Rosie Schellenberg und Nik Wachsmann für ihre Ermutigung und Korrekturen zu großem Dank verpflichtet. Simon Winder bei Allen Lane in London und Scott Moyers und Helen Rouner bei Penguin Press in New York waren hervorragende Lektoren, und mit Richard Duguid an der Herstellung dieses Buchs zusammenzuarbeiten, war mir ein großes Vergnügen. Richard Mason war ein aufmerksamer Lektor und Cecilia Mackay eine unermüdliche Bildrechercheurin. Christine L. Corton hat mir sowohl während des gesamten Prozesses aus Recherche, Schreiben und Herstellung stets zur Seite gestanden als auch einen professionellen Blick auf die Fahnen geworfen. Für eventuelle Fehler bin ich, wie immer, allein selbst verantwortlich.
Die Widmung an meinen Tutor in Oxford ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit für eine wundervolle Einführung in das Fachgebiet der Historiografie, deren Wirkung ein Leben lang vorgehalten hat.
Barkway, Hertfordshire, Januar 2024
Prolog
Eine Frau vor Gericht
Die Fotojournalistin Marie-Claude Vaillant-Couturier (1912 – 1996) wurde im Februar 1942 wegen ihrer Tätigkeit aufseiten der Résistance in Frankreich verhaftet und nach Auschwitz geschickt, wo sie interniert war, bis sie im August 1944 ins Konzentrationslager Ravensbrück verlegt wurde. Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess machte sie am 28. Januar 1946 in der Vernehmung durch den französischen Anklagevertreter Charles Dubost folgende Aussage über ihre Erlebnisse in Auschwitz:
VAILLANT-COUTURIER: [… Wir] sahen […], wie die Plomben von den Wagen entfernt und wie Frauen, Männer und Kinder von Soldaten aus den Wagen herausgeholt wurden. Wir wohnten den entsetzlichen Szenen bei, wenn alte Ehepaare voneinander getrennt wurden. Mütter mussten ihre Mädchen verlassen, weil diese in das Lager zu gehen hatten, während die Mütter und [Klein-]Kinder in die Gaskammern gebracht wurden. Alle diese Leute wussten nichts von dem Schicksal, das ihrer wartete. Sie waren nur verwirrt, weil sie voneinander getrennt wurden, aber wussten nicht, dass sie in den Tod gingen.
Um den Empfang angenehmer zu machen, spielte damals, das heißt im Juni und Juli 1944, ein aus Häftlingen gebildetes Orchester, alle hübsch und jung, Mädchen in weißen Blusen und dunkelblauen Röcken, während der bei der Ankunft der Züge getroffenen Auswahl lustige Weisen, wie »Die lustige Witwe«, die Barcarole aus »Hoffmanns Erzählungen« und so weiter. Man sagte ihnen, es sei ein Arbeitslager, und da sie nicht in das Lager hineinkamen, sahen sie nur die kleine grün umrahmte Plattform, wo das Orchester spielte. Sie konnten nicht wissen, was sie erwartete.
Diejenigen, die für die Gaskammern ausgesucht worden waren, das heißt die alten Leute, Kinder und Mütter, wurden in ein rotes Ziegelgebäude geführt.
M. DUBOST: Diese wurden also nicht registriert?
VAILLANT-COUTURIER: Nein.
M. DUBOST: Sie wurden nicht tätowiert?
VAILLANT-COUTURIER: Nein, sie wurden nicht einmal gezählt.
M. DUBOST: Wurden Sie selbst tätowiert?
VAILLANT-COUTURIER: Ja. [Die Zeugin zeigt ihren Arm.] Sie wurden in ein Gebäude aus roten Ziegeln gebracht, auf dem die Inschrift »Bad« stand. Dort hieß man sie sich ausziehen […], bevor sie in das angebliche Duschzimmer geführt wurden. Später, zur Zeit der großen Transporte aus Ungarn, blieb keine Zeit für Tarnungsmaßnahmen mehr übrig. Man zog sie in roher Weise aus, ich weiß von diesen Einzelheiten, weil ich eine kleine Jüdin aus Frankreich gekannt habe, die mit ihrer Familie am Republikplatz wohnte.
M. DUBOST: In Paris?
VAILLANT-COUTURIER: In Paris; sie wurde »die kleine Marie« genannt und war die einzige Überlebende einer neunköpfigen Familie. Ihre Mutter und ihre sieben Schwestern und Brüder waren schon bei der Ankunft vergast worden. Als ich sie kennenlernte, war sie mit der Arbeit beauftragt, die kleinen Kinder zu entkleiden, bevor sie in die Gaskammer kamen. Nachdem die Leute ausgezogen waren, führte man sie in einen Raum, der wie ein Duschzimmer aussah, und durch ein Loch in der Decke wurden die Kapseln in den Raum hinabgeworfen. Durch ein Guckloch beobachtete ein SS-Mann die Wirkung. Nach ungefähr fünf bis sieben Minuten, wenn das Gas sein Werk getan hatte, gab er ein Signal zur Öffnung der Türe. Männer mit Gasmasken, es waren auch wieder Häftlinge, kamen herein und brachten die Leichen heraus. Sie haben uns erzählt, dass die Häftlinge vor ihrem Tod gelitten haben müssen, denn sie waren zu Trauben aneinandergeklammert, sodass es schwer war, sie voneinander zu trennen.
Danach kam eine andere Mannschaft, um ihnen die Goldzähne und Gebisse herauszureißen. Nach der Verbrennung wurden sie aber noch einmal durchgesiebt, um den Versuch zu machen, das Gold zu sammeln.
In Auschwitz waren acht [tatsächlich waren es vier – R. J. E.] Verbrennungsöfen. Diese waren aber ab 1944 nicht mehr ausreichend. Die SS ließ von den Häftlingen große Gruben ausgraben, in denen sie mit Benzin übergossenes Reisig anzündeten. In diese Gruben warfen sie dann die Leichen. Von unserem Block aus sahen wir ungefähr dreiviertel bis eine Stunde nach der Ankunft eines Transportes hohe Flammen aus dem Verbrennungsofen emporschlagen und den Himmel durch die brennenden Gräben leuchten. […]
M. DUBOST: Können Sie, bitte, von den Aussonderungen sprechen, die bei Beginn des Winters gemacht wurden?
VAILLANT-COUTURIER: […] Zu Weihnachten 1943, als wir in Quarantäne lagen, haben wir gesehen, weil wir dem Block 25 gegenüber wohnten, wie nackte Frauen in den Block 25 geführt wurden. Dann ließ man offene Lastwagen kommen, auf denen man diese Frauen zusammenpferchte, so viele, wie die Lastwagen aufnehmen konnten, und jedes Mal, wenn ein Lastwagen abfuhr, lief der berüchtigte Heßler […] dem Lastwagen nach und verprügelte mit seinem Knüppel diese zum Tode fahrenden nackten Frauen. Sie wussten, dass sie in die Gaskammer gebracht wurden, und versuchten zu fliehen. Man massakrierte sie. Sie versuchten aus dem Lastwagen herauszuspringen, und wir in unserem Block sahen die Lastwagen vorbeifahren und hörten die grauenvollen Klagen aller dieser Frauen, die wussten, dass sie zum Vergasen fuhren. Viele von ihnen hätten sehr gut leben können, sie waren bloß unterernährt oder litten auch nur an Krätze. […]
Da man die Jüdinnen mit ihren ganzen Familien unter der Angabe nach Auschwitz schickte, dass sie dort in einer Art Ghetto leben würden und sie deshalb ihre ganze Habe mitnehmen sollten, brachten sie also beträchtliche Reichtümer mit. Ich erinnere mich daran, wie die Jüdinnen aus Saloniki bei ihrer Ankunft Postkarten bekamen, auf denen als Absendeort Waldsee angegeben war. Waldsee, ein Ort, der nicht existierte. Auf der Karte war ein gedruckter Text für die Angehörigen, der lautete: »Es geht uns hier sehr gut, wir haben zu arbeiten und werden gut behandelt, wir warten auf Eure Ankunft.« Ich habe diese Karten selbst gesehen, und die Schreiberinnen, das heißt die Block-Sekretärinnen, erhielten den Befehl, die Postkarten unter die Häftlinge zu verteilen, damit diese sie an ihre Familien schickten. Ich weiß, dass manche Angehörige sich daraufhin meldeten. […]
[Kreuzverhör durch Dr. Hanns Marx, den Verteidiger von Julius Streicher]
DR. MARX: […] Sie sagten auch, das deutsche Volk musste über die Vorgänge in Auschwitz auf dem Laufenden gewesen sein. Worauf basiert diese Behauptung?
VAILLANT-COUTURIER: Ich habe das schon gesagt, einerseits auf der Tatsache, dass die lothringischen Soldaten der Wehrmacht, als wir abfuhren, uns im Zuge sagten: »Wenn ihr wüsstet, wohin ihr fahrt, so würdet ihr es nicht so eilig haben, dort anzukommen.« Andererseits auf der Tatsache, dass die deutschen Frauen, die aus der Quarantäne herauskamen, um in Fabriken zu arbeiten, diese Tatsachen kannten und alle sagten, sie würden es draußen weitererzählen; und drittens auf der Tatsache, dass in allen Fabriken, in denen Häftlinge arbeiteten, diese in Berührung mit deutschen Zivilisten waren; sowie auf der Tatsache, dass die Aufseherinnen in Verbindung mit ihren Familien und Freunden standen und oft damit prahlten, was sie gesehen hatten.
(Der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nürnberg, 14. November 1945 – 1. Oktober 1946, Bd. 6, Vierundvierzigster Tag, Montag, den 28. Januar 1946, Vormittagssitzung, S. 240 – 243, 256)
Teil I
Der Führer
Einleitung
Es ist unmöglich, dieses Buch nicht mit einem biografischen Essay über Hitler zu beginnen. Ohne ihn hätte es kein Drittes Reich, keinen Zweiten Weltkrieg und keinen Holocaust gegeben – wenigstens nicht in der Form, die diese unheilvollen Ereignisse annahmen. Doch Hitler ist häufig als Rätsel dargestellt worden. Dass er ein Diktator war, der den Zweiten Weltkrieg begonnen und die Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden befohlen hat, bevor er sich am 30. April 1945 im Bunker in Berlin das Leben nahm, ist allgemein bekannt. Wenn man genauere Antworten auf Fragen über ihn haben will, kann man in den Biografien nachschlagen, die seit den 1930er Jahren in einzelnen Schüben erschienen sind. Abgesehen von den nach Tausenden zählenden abgeleiteten Machwerken, spekulativen Fantasien, politisch geprägten Narrativen, sensationellen, aber dubiosen »Enthüllungen« und besessen vorgetragenen, aber unbeweisbaren Theorien, die den Buchmarkt, die Presse, das Internet und die Medien überfluten, bleibt immer noch eine Reihe ernsthafter, fundierter und sorgfältig ausgearbeiteter Lebensbeschreibungen des NS-Führers übrig. Die erste hat, noch zu Hitlers Lebzeiten, der liberale deutsche Journalist Konrad Heiden verfasst, der miterlebt hatte, wie Hitler in den 1920er und frühen 1930er Jahren von München aus Bekanntheit erlangte, und nach seiner Flucht aus Deutschland im Januar 1933 eine gut informierte Biografie schrieb, in der er Hitlers Aufstieg zur Macht mit den Wünschen und Ängsten des deutschen Volks in Verbindung setzte.[1]
Ein umfassenderes Lebensbild des NS-Diktators konnte jedoch erst nach dessen Tod und dem Untergang des Dritten Reichs gezeichnet werden. Die erste ernsthafte Nachkriegsbiografie stammt von dem britischen Historiker Alan Bullock, einem prominenten Intellektuellen und Mitglied der Labour Party, der dem britischen Publikum durch seine Beiträge zur BBC-Radiosendung The Brains Trust bekannt war. Er stellte den NS-Führer in seiner Biografie Hitler. Eine Studie über Tyrannei als politischen Opportunisten dar, der nicht von einer Ideologie oder einem Glauben angetrieben wurde, sondern von einem schrankenlosen »Willen zur Macht«. Darin war der Einfluss des desillusionierten deutschen Konservativen Hermann Rauschning zu erkennen, der Hitlers Machtübernahme als eine »Revolution des Nihilismus« betrachtete, um den Titel seiner Tiefenanalyse des Aufstiegs des Nationalsozialismus zu zitieren. Bullocks Auffassung wurde wenig später von seinem Oxforder Kollegen Hugh Trevor-Roper, dem Autor des klassischen investigativen Berichts Hitlers letzte Tage (1947) infrage gestellt, der in seinem Aufsatz »The Mind of Adolf Hitler« die Ansicht vertrat, dass Hitler von einer Reihe zusammenhängender Ziele geleitet wurde.[2]
Trotz des großen Erfolgs von Bullocks Biografie setzte sich schließlich Trevor-Ropers Ansicht durch. 1969, als in Deutschland ernsthafte akademische Forschungsarbeiten über den Nationalsozialismus und seine Ursprünge gerade erst in Gang kamen, veröffentlichte der Stuttgarter Historiker Eberhard Jäckel ein schmales Buch, in dem er ausführte, dass Hitler nicht von Machtlust, sondern von zwei Hauptüberzeugungen beherrscht wurde: dem Antisemitismus, einem exterminatorischen Judenhass, und dem Verlangen nach »Lebensraum«, dem Gedanken, dass Deutschland und die Deutschen, um zu überleben, Ostmittel- und Osteuropa erobern müssten.[3] Angesichts dieser Argumente revidierte Bullock schließlich seine Auffassung und gestand in seinen späteren Schriften der Ideologie in Hitlers geistiger Verfassung eine bedeutende Rolle zu.[4] Tatsächlich haben alle nachfolgenden Biografien Hitler als Ideologen dargestellt. In Bezug auf Herangehensweise und Interpretation unterscheiden sie sich allerdings stark. Der konservative deutsche Journalist Joachim C. Fest, ein versierter, sachkundiger Historiker, trat 1973 als Erster mit einer umfangreichen Biografie auf den Plan.[5] Wie Rauschning sah auch Fest in Hitler einen Revolutionär, allerdings einen, der reaktionäre Elemente in seine Weltsicht integrierte. Am stärksten beeinflusst war Fest jedoch von Albert Speers Hitlerbild; er hatte an den Erinnerungen des ehemaligen Rüstungsministers mitgearbeitet und übernahm viele von dessen häufig irreführenden Interpretationen in seine Biografie. Fest wurde nach deren Erscheinen weithin für seine psychologischen Einblicke in Hitlers Charakter gelobt; heute erscheinen sie indes vielfach als vage und unbegründet. Indem er Hitlers Laufbahn mit dem breiteren historischen Kontext verband, verließ sich Fest zu stark auf psychologische Verallgemeinerungen über das »deutsche Volk«, die »Pathologie« der Zeit und die »Orientierungslosigkeit« gewöhnlicher Deutscher, die angeblich auf die Niederlage von 1918 folgten. Kritiker bemängelten auch, dass Fest die Rolle der konservativen Eliten, die Hitler an die Macht brachten und nach der Machtübernahme unterstützten, herunterspiele.[6]
Fests Biografie wurde jedoch erst Ende der 1990er Jahre von einer anderen, noch umfangreicheren, zwei Bände umfassenden des britischen Historikers Ian Kershaw übertroffen. Ursprünglich Mediävist, hatte sich Kershaw am Münchener Institut für Zeitgeschichte zum Historiker des Nationalsozialismus umschulen lassen. Sein dortiger Mentor war der Institutsleiter Martin Broszat, der sich vor allem mit unpersönlichen Machtstrukturen im Dritten Reich beschäftigte. Max Webers Charismabegriff auf das Leben des NS-Diktators anwendend, interpretierte Kershaw Hitler zum Teil als Produkt einer »charismatischen Gemeinschaft« begeisterter Anhänger, deren Verehrung seinen Glauben an sich selbst in den 1920er Jahren immer stärker werden ließ. Nach anfänglichem Zweifel an seiner Fähigkeit, Deutschland aus dem Chaos der frühen Nachkriegsjahre zu führen, sei er Mitte der 1920er Jahre zu der Überzeugung gelangt, dass er jene historische Mission habe, die ihm seine engen Unterstützer unablässig unterstellten. Er habe also nicht, wie viele Kommentatoren meinten, Menschen dazu verführt, ihm zu folgen; vielmehr sei er von ihnen angeregt worden, sie zu führen. Nach der »Machtergreifung« habe man begonnen, Hitlers ideologischen Antrieb in Politik umzusetzen, wobei seine Untergebenen aufgrund seiner unregelmäßigen Arbeitsweise häufig hätten raten müssen, wie dies geschehen sollte, und »dem Führer entgegenarbeiten«, wie ein hoher NS-Beamter es ausgedrückt hatte. Da sie für gewöhnlich angenommen hätten, dass die von ihm bevorzugte Politik die am meisten »nationalsozialistische« war, das heißt die extremste, folgte daraus ein sich selbst verstärkender Radikalisierungsprozess, dem zuzustimmen Hitler sich im Allgemeinen verpflichtet fühlte.[7]
Den gegenteiligen Standpunkt nahm der deutsche Historiker Peter Longerich ein, der Autor mehrerer bedeutender Biografien führender NS-Größen wie Joseph Goebbels und Heinrich Himmler.[8] Er hielt es für an der Zeit, den Gedanken aufzugeben, Hitler habe »im Schatten seines eigenen Charismas gestanden«, sei ein Produkt »gesellschaftlicher Kräfte und des Bedingungsgefüges des nationalsozialistischen Herrschaftssystems« gewesen.[9] Stattdessen habe Hitler, ob »Außenpolitik und Kriegführung, Terror und Massenmord, Kirchenpolitik, Kulturfragen oder das Alltagsleben der Deutschen – überall […] die Politik des Regimes bis ins Detail hinein« bestimmt.[10] Doch bei der Lektüre von Longerichs Buch zeigt sich an zahlreichen Stellen, dass seine Absicht, alles auf Hitlers Willen zurückzuführen, eher eine Überreaktion auf frühere Interpretationen Hitlers darstellt, die ihn als »schwachen Diktator« zeichneten, als Spielball unpersönlicher struktureller Kräfte, der eher reagierte, als selbst zu gestalten. Und wie der Autor der jüngsten großen Hitler-Biografie, der deutsche Journalist und ausgebildete Historiker Volker Ullrich, der eine Reihe bedeutender Bücher aufzuweisen hat, unterstreicht, ist die Ansicht eines Historikerkollegen, Kershaws Biografie präsentiere dem Leser einen Diktator, der »im Grunde austauschbar, überflüssig, im besten Fall schwach« gewesen sei, unfair.[11] Tatsächlich hat Kershaw die Fallstricke sowohl des »Intentionalismus«, dem zufolge alles aufgrund von Hitlers Willen geschehen sei, als auch des »Funktionalismus«, nach dem alles mehr oder weniger auf unpersönliche, strukturelle Faktoren zurückzuführen sei, vermieden, stattdessen die Wechselwirkung beider untersucht und damit diese seit Langem geführte Debatte transzendiert.[12]
Dieser Linie folgt Ullrich in seiner Biografie des NS-Führers auch selbst.[13] Aber er zeichnet einen menschlicheren Hitler, als es sowohl Kershaw als auch Longerich getan haben. Auffällig ist, dass sich Hitlers Biografen trotz aller Unterschiede ihrer Ansätze darin einig zu sein scheinen, dass er ein Mensch ohne Privatleben und normale menschliche Gefühle gewesen sei, der sich in die Politik gestürzt habe, um seiner inneren Leere zu entkommen. Diese Ansicht hat schon Konrad Heiden vertreten, wenn er feststellt, Hitler habe der »Mut zum Privatleben« gefehlt.[14] Kershaw attestierte Hitler eine »gestörte Sexualität« und verwies auf »sein Zurückweichen vor jedem Körperkontakt, seine Angst vor Frauen, seine Unfähigkeit, echte Freundschaft zu schließen, und seine Leere in den menschlichen Beziehungen«.[15] »Ein privater Hitler jenseits der öffentlichen Rolle existierte nicht«, stellte Longerich fest.[16] Auch Fest befand: »[E]in Privatleben hatte er nicht.«[17] Ullrich sprach ganz ähnlich davon, dass ihm »der innere Gefühlskompass fehlte«.[18] Indem Hitlers Biografen solche Schlussfolgerungen zogen, gaben sie, vielleicht unbewusst, dessen eigenes Selbstbild wieder, denn er hatte mehrfach erklärt, er habe Deutschland sein Privatleben und sein Glück geopfert: Als Alleinstehender ohne Lebenspartnerin – zumindest soweit es die Öffentlichkeit betraf – war er »mit Deutschland verheiratet«. Tatsächlich haben sowohl Ullrich als auch Longerich viele Einzelheiten zusammengetragen über die Freundschaften, die Hitler im Lauf seines Lebens einging, über seine Loyalität gegenüber Mitarbeitern, zu denen er über viele Jahre enge Beziehungen aufbaute, und das Privatleben, das er mit seiner Entourage führte, insbesondere an seinem Rückzugsort auf dem Obersalzberg. Was seine Sexualität angeht, dürfte die durch seine medizinischen Unterlagen belegte Tatsache, dass er ein Sexualstimulans zu sich nahm, wenn er mit Eva Braun zusammen war, Beweis genug für deren Existenz sein.[19] Nicht nur Historikern wird manchmal vorgeworfen, sie würden Hitler »vermenschlichen«, doch, wie Ullrich darlegt, ist genau dies nötig. Hitler war ein Mensch, deshalb werfen sein Leben und seine Laufbahn schwierige, beunruhigende Fragen darüber auf, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.[20]
Im Lauf der Jahre hatten Hitler-Biografen Zugang zu immer mehr Informationen und Dokumenten über ihren Gegenstand. Während Heiden seine zeitgenössische Darstellung auf Zeitungsberichte, Interviews und persönliche Beobachtungen stützte, konnte Bullock die Nachkriegsprotokolle und Dokumente des Nürnberger Prozesses verwenden, und die Veröffentlichung des 1962/63 von dem deutschen Historiker und Publizisten Max Domarus herausgegebenen vierbändigen Kompendiums von Hitlers Reden zwischen 1932 und 1945 sowie der 1980 erschienenen Ausgabe seiner frühen Aufzeichnungen aus den Jahren 1905 bis 1924 stellten wichtige Quellen für die Studien von Fest und Kershaw bereit.[21] Nach 1990 sind eine wissenschaftliche Ausgabe von Hitlers Reden, Schriften und Anordnungen aus den Jahren 1925 bis 1933, eine kommentierte Edition seines autobiografischen Traktats Mein Kampf, die umfangreichen Tagebücher von Propagandaminister Joseph Goebbels, das Diensttagebuch von SS-Chef Heinrich Himmler, das vollständige Tagebuch des NS-Ideologen Alfred Rosenberg und vieles mehr hinzugekommen.[22]
Eine besonders umstrittene Quelle sind die sogenannten »Tischgespräche«, die die Monologe enthalten, mit denen Hitler 1941/42 seine Gäste beim Mittag- und Abendessen traktierte. Im Juli 1941 kam Martin Bormann auf die Idee, sie für die Nachwelt festhalten zu lassen, und betraute seinen Adjutanten Heinrich Heim, einen NS-Anwalt, mit dieser Aufgabe. Hitler führte keine lockere Konversation, sondern gab in Monologen seine Ansichten zu einer Vielzahl von Themen zum Besten, und auf dem Höhepunkt seiner Macht verdienten es diese Weisheiten nach Ansicht seiner Gefolgsleute gewiss, bewahrt zu werden. Heim begleitete Bormann zu diesen Essen und hörte Hitler aufmerksam zu, um das Gehörte unmittelbar nach dem Essen einer Sekretärin zu diktieren und deren Niederschriften manchmal später zu revidieren. Bormann las kurz darauf den fertigen Text und korrigierte und ergänzte ihn aufgrund seiner eigenen Erinnerung an den jeweiligen Monolog. Danach korrigierte Heim noch einmal den maschinengeschriebenen Text, bevor die Endfassung getippt und archiviert wurde. Während einer Pause vom 12. März bis 1. August 1942, als Heim abwesend war, trat Henry Picker, ein weiterer NS-Jurist, an seine Stelle. Anschließend, bis zum 7. September 1942, übernahm wieder Heim die Aufgabe. 1943/44 wurden gelegentlich einige weniger genaue Aufzeichnungen angefertigt, die aber wesentlich uninteressanter sind. Picker war es, der nach dem Krieg eine erste Fassung der von ihm so genannten »Tischgespräche« veröffentlichte, einschließlich der Niederschriften Heims und einiger Zeugenaussagen, die ihre Echtheit bestätigen, sowie von Picker selbst verfasster erklärender Anmerkungen.[23]
Diese Niederschriften beruhten also nicht, wie manchmal angenommen wurde, auf stenografischen Notizen von Hitlers Sekretärinnen, sondern wurden im Nachhinein angefertigt. Wie verlässlich sind sie? Sie sind offensichtlich keine exakten Protokolle, und tatsächlich leitete Heim jede von ihnen mit einer Phrase ein wie »Der Chef sprach sich dem Sinne nach u. a. in folgenden Gedankengängen aus«. Darüber hinaus war Bormann zwar mit Heims Aufzeichnungen zufrieden, nahm Pickers Berichte, die zahlreiche kleinere Fehler und sogar Fehldatierungen und irrtümliche Wiedergaben enthielten, aber erheblich kritischer auf. Dennoch gibt es keinen Beleg dafür, dass irgendjemand, einschließlich Bormann, neues Material oder tendenziöse Ergänzungen eingefügt hat, um den Lesern einen falschen Eindruck von Hitlers Ansichten zu vermitteln. Immerhin wurde Hitler 1941 – nicht zuletzt von seinen Mitarbeitern und von NS-Fanatikern wie Bormann – als eine Art Gott betrachtet, und seine »Tischgespräche« wurden aufgezeichnet, um eine Art heilige Schrift als Leitfaden für eine vermeintliche nationalsozialistische Zukunft herzustellen. Hitlers Ausführungen in irgendwelchen wesentlichen Dingen zu ändern, wäre daher einem Sakrileg gleichgekommen. Natürlich dürfte Hitler kaum erwartet haben, dass seine Zuhörer nicht wiederholten, was er zu anderen gesagt hatte, weshalb seine Worte keinesfalls als privat oder vertraulich gelten konnten. Aber nichts in den »Tischgesprächen« widerspricht seinen bekannten Ansichten, wie er sie in Reden und Anweisungen ausgesprochen hat, und die regelmäßigen Wiederholungen und die ständige Rückkehr zu früher schon behandelten Themen unterstreichen die Beständigkeit dessen, was Hitler in dem betreffenden Zeitraum sagte. Sie fügen dem bereits Bekannten Einzelheiten hinzu, enthalten aber keine sensationellen Enthüllungen.[24] Aus der Tatsache, dass sie aus dem Gedächtnis niedergeschrieben wurden, folgt nicht, dass sie nicht mehr oder weniger getreu wiedergeben, was Hitler gesagt hatte, oder seine Gedanken in ihnen verzerrt oder falsch dargestellt werden.[25]
Viele der führenden Nationalsozialisten, die den Krieg überlebten, und derjenigen, die sie persönlich kannten, veröffentlichten Memoiren, von denen einige erst vor nicht allzu langer Zeit erschienen sind. Alle diese Quellen sind in gewisser Weise problematisch, aber zusammengenommen bilden sie eine unverzichtbare Grundlage für die Beurteilung und Neubewertung von Hitlers Leben und seiner Rolle in der NS-Bewegung und im Dritten Reich. Darüber hinaus ist das Wissen über den Nationalsozialismus und das Dritte Reich in den letzten drei Jahrzehnten und davor durch eine wahre Flut wissenschaftlicher Aufsätze und Monografien vertieft worden. Zudem hinterließen die NS-Bewegung und noch mehr das NS-Regime eine fast unermessliche Menge an bürokratisch fabrizierten Dokumenten, von denen ein großer Teil veröffentlicht worden ist. Es besteht also kein Mangel an Material für die Beschäftigung mit dem NS-Führer. Und doch bleiben trotz alldem die Meinungen unter Historikern und Biografen tief gespalten. Die Frage danach, was Hitler motivierte und warum er eine solche Macht erlangen und eine solche Faszination auf so viele Menschen ausüben konnte, ist für Historiker weiterhin eine echte Herausforderung. Das erste Kapitel dieses Buchs stellt sich dieser Herausforderung und versucht Antworten auf diese schwierige Frage zu geben.
1
Der Diktator: Adolf Hitler
I
In den ersten dreißig Jahren seines Lebens war Adolf Hitler ein Niemand. Er wurde am 20. April 1889 als Sohn eines Zollbeamten in Braunau in Österreich in weitgehend unbekannte Verhältnisse hineingeboren. Der Mangel an Informationen ist durch Spekulationen, die zumeist jeder Grundlage entbehren, wettgemacht worden, aus dem irregeleiteten Verlangen heraus, in einer vermeintlich in frühen Erfahrungen wurzelnden individuellen Pathologie eine Erklärung für seine spätere Laufbahn zu finden.[1] Genauso wenig Verlass ist auf Hitlers eigene Darstellung in seinem autobiografischen politischen Traktat Mein Kampf. Weder wuchs er, wie er behauptet, in Armut auf, noch scheint sein Vater Alois Alkoholiker gewesen zu sein. Allerdings scheint sein Vater ihn in größerem Ausmaß mit Körperstrafen gezüchtigt zu haben, als es im Österreich des späten 19. Jahrhunderts üblich war, und Hitler sagte zweifellos die Wahrheit, wenn er feststellte, er habe seinen Vater mehr gefürchtet als geliebt.[2] Dennoch unterstützte sein Vater ihn, im Gegensatz zu dem Eindruck, den er in Mein Kampf vermittelt, in dem Bestreben, Künstler zu werden. Im Jahr 1900 meldete sein Vater ihn, nachdem er sein Zeichentalent entdeckt hatte, nicht in einem humanistischen Gymnasium an, dessen Besuch ihm eine akademische Laufbahn eröffnet hätte, sondern in einer berufsorientierten Realschule.[3] Während er in der Schule in Linz durch Disziplinlosigkeit auffiel, verbrachte er einen großen Teil seiner Zeit mit Zeichnen und Malen. Trotzdem wurde seine Bewerbung an der Wiener Kunstakademie im Jahr 1907 mit der Begründung, er könne keinen Menschenkopf zeichnen, abschlägig beschieden. Der Direktor riet ihm, Architektur zu studieren, aber Hitler fehlte die dafür nötige Qualifikation. Dennoch betrachtete er sich weiterhin in erster Linie als Künstler.[4]
Zu diesem Zeitpunkt waren Hitlers Eltern bereits verstorben, sein Vater im Jahr 1903 und seine Mutter, Klara, der er näherstand, Ende 1907. Im folgenden Jahr zog Hitler nach Wien, wo er für fünf Jahre blieb. Da er vom mütterlichen Erbe, einer Waisenrente und Zuschüssen von Verwandten leben konnte, sah er keine Notwendigkeit, sich eine Arbeit zu suchen. Stattdessen vertrieb er sich die Zeit damit, zu zeichnen und Baupläne zu skizzieren, zu lesen – neben den Wildwestromanen Karl Mays insbesondere deutsche Sagen mit ihrer seltsamen Atmosphäre aus Untergang, Verfall und Erlösung – und in die Oper zu gehen, vor allem wenn die Musikdramen Richard Wagners aufgeführt wurden, die großenteils auf mittelalterlichen Mythen und Legenden von ritterlichem Heldentum, Liebe und Tod beruhten. Seine spätere Aussage, er sei zu einem glühenden Anhänger des extrem nationalistischen und antisemitischen österreichischen Politikers Georg Ritter von Schönerer geworden, ist ebenso zu bezweifeln wie die in Mein Kampf geäußerte Behauptung, er sei in Wien zu einem radikalen Antisemiten geworden, die durch die Tatsache Lügen gestraft wird, dass er, während er dort lebte, mit einer ganzen Reihe von Juden gut bekannt war.[5] Tatsächlich gibt es keinen stichhaltigen Beleg dafür, dass er sich in dieser Zeit für Politik interessiert hätte oder vom Judenhass infiziert worden wäre. Sein Jugendfreund, der Musikstudent August Kubizek, der später Berufsgeiger und Kapellmeister wurde, hinterließ eine lebendige Darstellung von Hitlers Charakter. So wie er sich an Hitler erinnerte, war er leidenschaftlich, wortgewandt und tatkräftig und redete gern und viel über eine Vielzahl von Themen. Dafür brauchte er jedoch keinen Gesprächspartner, sondern einen Zuhörer. Die beiden Jugendlichen freundeten sich an, weil sie beide regelmäßig in die Linzer Oper gingen, und teilten eine Zeit lang eine Unterkunft. Als ernsthafter junger Mann hatte Hitler laut Kubizek wenig Sinn für Humor, obwohl er sich gern über Bekannte lustig machte. Seine innersten Gefühle behielt er für sich; allerdings berichtet Kubizek davon, dass er sich in ein junges Mädchen namens Stefanie verliebte, aber zu schüchtern war, um darauf Taten folgen zu lassen. Dennoch betont Kubizek, Hitlers Sexualität sei »absolut normal« gewesen. Seine strengen bürgerlichen Moralvorstellungen hielten ihn von Bordellen und Strichmädchen fern, die für viele seiner jungen männlichen Zeitgenossen so anziehend waren. Von Kunst und Architektur besessen, verbrachte er viel Zeit damit, von der Umgestaltung ganzer Städte, insbesondere Linz, zu träumen, eine Passion, der er bis an sein Lebensende nachging.[6]
1908 war das mütterliche Erbe aufgebraucht, und Hitler geriet in ernste finanzielle Nöte, nicht zuletzt deshalb, weil er so viel Geld für Opernbesuche ausgab. Er war gezwungen, viele Monate in einem Männerwohnheim für Obdachlose zu leben. Ein zweiter Versuch, in die Kunstakademie einzutreten, schlug fehl. Doch in der festen Überzeugung, zum großen Künstler bestimmt zu sein, wies er den Gedanken, einen Kompromiss einzugehen und sich in ein gewöhnliches Leben zu fügen, zurück. Auf Vorschlag eines Freundes aus dem Wohnheim fertigte er von Postkarten abgemalte Bilder an, deren Verkauf ihm ein kleines Einkommen einbrachte. Aber es reichte nicht aus, bis er an seinem 24. Geburtstag im April 1913 das beträchtliche Erbe eines Verwandten antreten konnte. Nachdem ein bescheidenes, aber ausreichendes Einkommen gesichert war, zog er am 25. Mai 1913 nach München um und tauschte das multikulturelle Milieu, in dem er in Wien gelebt hatte, gegen ein Deutschland ein, das er unverkennbar bewunderte und zu dem Deutschsprachige, wie er vermutlich glaubte, eigentlich gehörten. Er blieb jedoch österreichischer Staatsbürger und wurde von der bayerischen Polizei aufgefordert, nach Österreich zurückzukehren, um dort seine Wehrpflicht zu erfüllen. Bei seiner Musterung wurde er aber als körperlich »zu schwach« eingestuft, sodass er wieder nach München gehen konnte. Dort setzte er in den Folgemonaten sein zielloses Leben fort und verkaufte in einem Kaffeehaus in Schwabing, einem Stadtviertel, das als Heimat von Künstlern und Bohemiens bekannt war, seine Postkartenkopien. Bis zu diesem Zeitpunkt wies nichts in seinem Leben auf eine künftige politische Karriere hin. Sein Leben war ein Fehlschlag, seine Ambitionen hatten sich nicht erfüllt, und seine soziale Stellung hätte als Kind einer soliden bürgerlichen Familie kaum tiefer abgesunken sein können. Von allen NS-Führungsfiguren war er der am stärksten deklassierte, derjenige, der den steilsten sozialen Abstieg erlebt hatte.
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs Ende Juli 1914 schien alle Probleme Hitlers zu lösen. In Mein Kampf behauptete er, der Krieg sei die beste Zeit seines Lebens gewesen, und es gibt keinen Grund, ihm nicht zu glauben. Auf dem berühmten Foto, das ihn am 2. August 1914 inmitten der Menschenmenge zeigt, die auf dem Münchener Odeonsplatz den deutschen Kriegseintritt bejubelte, spiegelt sich auf seinem Gesicht das überwältigende deutsche Nationalgefühl wider, von dem erfüllt er am 16. August, nachdem er zunächst abgewiesen worden war, ins bayerische Heer eintrat. Im Zuge der chaotischen Massenrekrutierung schien niemandem aufgefallen zu sein, dass er Österreicher und für den Kampfeinsatz nicht wirklich geeignet war. Nach einer rudimentären Ausbildung wurde er mit seinem Regiment an die Westfront geschickt. Er überlebte seine Feuertaufe in einem heftigen Gefecht mit britischen Truppen, wurde zum Gefreiten befördert und überbrachte als Meldegänger Befehle vom Feldbefehlsstand an die Front. Seine Beförderung hatte ihn nicht zum Unteroffizier gemacht; er war also nicht berechtigt, anderen Soldaten Befehle zu erteilen. Dass ihm das Eiserne Kreuz erster Klasse verliehen wurde, nahm man später häufig als Beweis für außerordentliche Tapferkeit. In Wirklichkeit war er als Meldegänger des Regimentsstabs zwar gelegentlich auch Gefahren ausgesetzt, aber überwiegend erfüllte er Aufgaben hinter der Front. Der Dienst beim Regimentsstab brachte Soldaten wie Hitler in engen Kontakt mit Offizieren, die über die Vergabe von Auszeichnungen entschieden, mit der Folge, dass unverhältnismäßig viele von ihnen das Eiserne Kreuz erhielten.[7]
Hitlers Kameraden erinnerten sich an ihn als weder besonders tapfer noch besonders feige. Er habe seine Pflichten ruhig und effizient erfüllt. Einzelgängerisch, wie er war, betrachteten ihn seine Kameraden als einen Sonderling, »den Künstler«, wie sie ihn nannten. Wenn sie plauderten und Witze machten, rauchten, tranken oder ein Bordell besuchten, schloss sich Hitler ihnen nie an, sondern saß abseits und las. Während sie dem Krieg zynisch gegenüberstanden, bekräftigte er wiederholt seinen Glauben an den totalen Sieg, allerdings vorwiegend im Privaten, wie seine erhalten gebliebenen Briefe bezeugen. Als sich Angehörige seines Regiments fußballspielend an dem spontanen »Weihnachtsfrieden« von 1914 beteiligten, hielt er sich fern davon. Wie andere Soldaten verlor er rasch die romantischen, heroischen Illusionen, die ihn dazu bewogen hatten, sich zum Kriegsdienst zu melden. An ihrer Stelle lernte er, hart und rücksichtslos zu sein und Leiden und Tod gleichgültig gegenüberzustehen. Die militärische Rangordnung und Disziplin gaben seinem Leben eine gewisse Ordnung und Struktur, auch wenn er nicht nach weiterer Beförderung strebte oder von seinen Vorgesetzten einer solchen für würdig betrachtet wurde. Am 5. Oktober 1916 wurde er durch einen Granatsplitter am linken Oberschenkel verletzt, doch es war keine lebensgefährliche Verwundung. 1918 nahm er an der letztlich erfolglosen Frühjahrsoffensive an der Westfront teil. Wenige Monate später erblindete er bei einem Senfgasangriff vorübergehend und wurde zur Behandlung und Erholung in ein Lazarett hinter der Front im pommerschen Pasewalk geschickt. Dort erfuhr er am 10. November 1918 von der endgültigen deutschen Niederlage, dem Sturz des Kaisers und dem Ausbruch der Revolution mit Arbeiter- und Soldatenräten an der Spitze.[8]
II
Die Arbeiter- und Soldatenräte wichen bald der etablierten Opposition des Kaiserreichs, der Sozialdemokratischen Partei, welche die Führung des Landes übernahm und mit Unterstützung der Liberalen und der katholischen Zentrumspartei eine neue politische Ordnung einführte, die weit progressiver war als das autoritäre Gemeinwesen unter Bismarck und dem Kaiser. Die republikanische Verfassung, die eine konstitutive Nationalversammlung in dem kulturellen Zentrum Weimar beschloss, der Stadt der klassischen deutschen Dichter Goethe und Schiller, war zutiefst demokratisch. Zum ersten Mal erhielten Frauen das Wahlrecht, und die Regierung wurde der Legislative und den Wählern gegenüber verantwortlich. Die Weimarer Republik, wie sie genannt werden sollte, hatte viele Probleme zu bewältigen. Der Versailler Vertrag, der den alliierten Sieg im Krieg besiegelte, nahm Deutschland im Osten und Westen insgesamt 13 Prozent seines Territoriums und seiner Bevölkerung; außerdem verlor Deutschland seine Kolonien, und seine Armee wurde auf 100 000 Mann beschränkt und durfte weder Kampfflugzeuge noch Kriegsschiffe besitzen. Darüber hinaus musste Deutschland für die Schäden, die seine Truppen während der Besetzung von Belgien und Nordostfrankreich angerichtet hatten, enorme Reparationen zahlen – in Gold. Die politische Stabilität war schwer aufrechtzuerhalten, nicht zuletzt deswegen, weil es nicht weniger als sechs große Parteien gab, die tiefsitzende und seit Langem bestehende Risse zwischen Klassen, Regionen und Religionen widerspiegelten: die Sozialdemokraten, die Kommunisten, das katholische Zentrum, die Deutschnationalen sowie die rechten und die linken Liberalen. Viele nationalkonservative und rechtsextreme Gruppen weigerten sich, die Legitimität der neuen Republik anzuerkennen, und ersehnten die Rückkehr des Kaisers. Auf der Linken verdammten die Kommunisten die Republik als »kapitalistisch« und strebten eine Revolution an, um ein Regime nach sowjetischem Vorbild zu errichten. Nach der neuen Verfassung wurde der Stimmenanteil der Parteien bei Wahlen direkt in den Anteil der gewonnenen Parlamentssitze übertragen. Daher waren alle Regierungen zwangsläufig Koalitionen, was jedoch weniger an der proportionalen Repräsentanz lag als an dem Mehrparteiensystem, das die Republik vom Kaiserreich geerbt hatte.
Hitlers spätere Behauptung, die Revolution von 1918 habe ihn zu dem Entschluss gebracht, in die Politik zu gehen, war eine grobe Vereinfachung. Sein Eintritt in die Welt der Politik erfolgte nach und nach. Es gibt keinen Grund, zu bezweifeln, dass die deutsche Niederlage und die Waffenstillstandsbedingungen ein Schock für ihn waren. Aber erst viele Monate später begann er politisch aktiv zu werden. Zunächst schloss er sich, mangels einer anderen Anstellung, wieder dem Heer an und blieb anfangs untätig, als im Februar 1919 der vom Münchener Arbeiter- und Soldatenrat gewählte erste Ministerpräsident der neuen bayerischen Republik, Kurt Eisner, von einem nationalistischen Fanatiker ermordet wurde, wonach ein kurzlebiges anarchistisches Regime und dann ein Rat aus kommunistischen Hardlinern die Macht in München an sich rissen. Dessen Herrschaft wurde schließlich durch von der gewählten gemäßigten sozialdemokratischen Regierung unter Führung von Johannes Hoffmann entsandte Freikorpstruppen in einem Blutbad beendet. Wie viele Rechte in Bayern sah Hitler in Hoffmann wahrscheinlich die einzige direkte Hoffnung für eine Wiederherstellung der Ordnung; daher seine anfängliche Bereitschaft, die Sozialdemokraten zu unterstützen. Von seinen Kameraden als ihr Vertreter gewählt, beauftragten seine Vorgesetzten ihn zunächst, das Verhalten der Truppe während der revolutionären Ereignisse zu untersuchen, und dann, an konterrevolutionären »Schulungen« für Soldaten mitzuwirken. Durch den »Fanatismus«, den einer seiner Zuhörer konstatierte, und die Tatsache, dass er offensichtlich bei seinem Publikum ankam, erregte er rasch Aufmerksamkeit. Er hatte diese Rolle wahrscheinlich übernommen, um im Heer bleiben zu können, da ihm jede realistische Alternative, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, fehlte, aber das Ergebnis war, dass sein Soldatendasein einem neuen Selbstverständnis als Politiker wich. Gleichwohl behielt er in vielerlei Hinsicht gleichzeitig weiterhin seine Militärpersönlichkeit: Für ihn war Politik Kriegführung mit anderen Mitteln. In seiner Selbstdarstellung hob er für den Rest seines Lebens stets die Jahre als gewöhnlicher Frontsoldat hervor, als Mann des Volkes in Uniform.[9]
Im Mittelpunkt der sich herausbildenden politischen Weltanschauung des mittlerweile 31-jährigen Hitler stand ein scharfer Antisemitismus. Die rechtsextremen Nationalisten, die mit dem Einzug der Freikorps in München triumphierten, betrachteten die Revolution als Werk einer jüdischen Verschwörung und die Räteregime als Schöpfung jüdischer Umstürzler. Einige der Revolutionäre, wie Kurt Eisner, Ernst Toller und Eugen Leviné, waren jüdischer Herkunft, obwohl fast alle von ihnen als radikale Sozialisten ihre jüdische Identität verleugneten. Dennoch gab ihre Beteiligung der Behauptung, die Stadt habe bis zur Ankunft der Freikorps unter »jüdischer Herrschaft« gestanden, eine gewisse Plausibilität. In der ersten Äußerung seines neuen extremen, obsessiven Judenhasses in einem Brief an Adolf Gemlich, einen Teilnehmer seines Schulungskurses, betonte Hitler 1919, die »jüdische Rasse« sei über die Jahrtausende hinweg ihrem inneren Wesen nach durch Umsturz, Kulturzerstörung und materialistische Gier gekennzeichnet. Wirkungsvoller jedoch, als mit gewalttätigen Pogromen darauf zu reagieren, sei ein »Antisemitismus der Vernunft«, das heißt, die Juden auf die eine oder andere Weise aus dem Land zu entfernen. Wichtig sei die Feststellung, dass »das Judentum unbedingt Rasse und nicht Religionsgenossenschaft« sei. Die Juden seien Überträger einer »Rassentuberkulose der Völker«. Alles, was sie wollten, fügte er in Redestichwörtern von 1922 hinzu, seien Geld und Macht. Ihr letztes Ziel sei die »Weltherrschaft«, weshalb sie allein ihrem Wesen nach »international« seien. Die Regierungen, die an die Stelle des Kaisers und der deutschen Fürsten traten, betrachtete er als bloße Werkzeuge der Juden. Ebenso die Presse und die Banken. In den frühen 1920er Jahren wiederholte Hitler in einer Rede nach der anderen wie besessen diese fantastischen Behauptungen. Sie waren nicht besonders originell, zusammengenommen vielmehr bloß eine extreme Version der unter deutschen Nationalisten und Konservativen verbreiteten Einstellung, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg um den Sieg betrogen worden sei und bösartige Kräfte, die hauptsächlich auf der Linken verortet wurden, dafür verantwortlich seien. Ungewöhnlich waren allerdings die Vehemenz und Wirksamkeit, mit denen Hitler jetzt begann, diese Ansicht zu propagieren.[10]
In dem Jahrzehnt nach dem Ende des Ersten Weltkriegs waren politische Kampagnen noch durch Auftritte in Massenversammlungen geprägt, entweder in größeren Räumlichkeiten – in Bayern waren Bierkeller ein beliebter Versammlungsort – oder im Freien. Der Rundfunk befand sich noch in den Kinderschuhen, das Fernsehen gerade einmal in der ersten Entwicklungsphase. Hitler entdeckte bei sich ein demagogisches Talent, mit dem es keine politische Figur seiner Zeit aufnehmen konnte. Bis 1928 sprach er ohne Mikrofon und Lautsprecher. Schon bevor den Nazis staatliche Mittel zur Verfügung standen, sorgten sie dafür, dass Hitlers Reden von verschiedenen Ritualen eingerahmt wurden, wie Musik oder von uniformierten Anhängern getragenen Bannern und Fahnen. Zudem wurde die Erwartung des Publikums gesteigert, indem man es auf Hitler warten ließ, der regelmäßig erst spät seine Rede hielt. Mit tiefer, klangvoller Stimme fing er seine Zuhörer ein, wenn er ruhig und mit langen Pausen zu sprechen begann, damit sie sich auf seine Worte konzentrierten, bevor er seine Ansichten in kurzen, einfachen Sätzen darlegte und zum Redeschluss hin, mit glänzendem Gesicht und sorgfältig einstudierten Gesten, einen Spannungsbogen aufbaute. Am Ende führte er sein Publikum in einer Gefühlsaufwallung in eine quasireligiöse Apotheose. Er reduzierte komplizierte politische Fragen auf eine Reihe von simplen Formeln. Alles war eine Sache von Gut oder Böse, Richtig oder Falsch, alles war absolut, jede Lösung endgültig. Er verstand es, einfache Menschen in ihrer Sprache anzusprechen, und lernte aus der Reaktion des Publikums, was wirkungsvoll war und was nicht. Manchmal benutzte er eine quasireligiöse Sprache, um sich selbst darzustellen, indem er etwa versprach, wenn er an die Macht käme, ein »Reich der Größe und der Kraft und der Herrlichkeit« aufzubauen, oder in pseudochristlichen Worten bekannte: »Jawohl, ich übernehme das Leid meines Volkes.«[11]
Mit Häme machte er von ihm verachtete politische Gegenstände lächerlich: Sein Freund Ernst »Putzi« Hanfstaengl meinte den »Witz Wiener Literatencafé-Diktion« zu verspüren, einen »spöttischen Humor, der zwar traf, ohne jedoch vierschrötig oder rüde zu wirken«.[12]Gleichzeitig entwickelte Hitler in den 1920er Jahren die Fähigkeit, über die Formulierung bloßer Slogans hinaus sein Publikum mit einem bemerkenswerten Detailwissen zu beeindrucken. Er bereitete seine Reden sorgfältig vor und übte sie ein, sprach dann aber ohne Manuskript nur anhand von Stichwörtern, sodass seine Worte spontan aus seinem Inneren zu kommen schienen. Er habe, behauptete er, von der österreichischen sozialdemokratischen Partei gelernt, wie man mit Propaganda die Massen erreiche, die aufgrund begrenzter geistiger Fähigkeiten für eine emotionale Ansprache empfänglich waren. Um sie zu fesseln, musste er einfache Parolen verwenden, die er endlos wiederholte, und durfte die Hauptbotschaft nie einschränken oder von ihr abweichen. Die Massen waren ihrem Wesen nach weiblich und mussten beherrscht werden. Als Hitler begann, öffentliche Reden zu halten, erkannte er bald, welch außergewöhnliches Talent er besaß, und fühlte sich rasch heimisch in der neuen politischen Welt, die er betreten hatte.[13]
Es war die Welt kleiner rechtsgerichteter nationalistischer Gruppen in München, die in den frühen 1920er Jahren in der konterrevolutionären Atmosphäre wie Pilze aus dem Boden schossen. Mit dem Ziel, erfolgreich zu sein, wo der Kaiser versagt hatte, betrachteten sie die Sozialdemokraten und Kommunisten als jüdisch dominierte Feinde Deutschlands und versuchten ihnen mit einer Mischung aus pseudosozialistischen, ultranationalistischen und antisemitischen Zielvorstellungen und Parolen die Arbeiterklasse abspenstig zu machen. Eine dieser Gruppen war die von dem Schlosser Anton Drexler geführte Deutsche Arbeiterpartei (DAP), wobei der Schlüssel zu ihrem rechtsextremen Charakter das Wort »deutsch« war, mit dem sie sich bewusst vom erklärten Internationalismus der Linken abhob. Hitlers Vorgesetzten in der Reichswehr schien sie für ihre konterrevolutionären Ziele anschlussfähig zu sein, und so schickten sie ihn am 12. September 1919 in eine ihrer Versammlungen, um zu erkunden, was möglich war. Da er sich nicht zurückhalten konnte, seine Einwände gegen einige der vorgetragenen Ansichten zu äußern, zog er die Aufmerksamkeit der Parteiführung auf sich, die ihn bald als Sprecher einsetzte. Es dauerte nicht lange, und sein Erfolg versetzte ihn in die Lage, sie an den Rand zu drängen und die DAP aus einer winzigen, konspirativen Sekte in eine breite politische Bewegung mit dem neuen Namen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) zu verwandeln. Dass die Partei sich als »sozialistisch« bezeichne, habe, wie er geflissentlich erklärte, »gar nichts« mit Marxismus zu tun, denn sie schätze das Privateigentum und das Individuelle, der Begriff bedeute lediglich »eine Verpflichtung zum Kampf für die Erhaltung des eigenen Volkstums ohne Rücksicht auf Klassen oder Stände«.[14]
Er entwarf ein Parteiprogramm mit 25 Punkten, das unter anderem forderte, Juden die Staatsbürgerschaft abzuerkennen und »Kriegsgewinne« zu konfiszieren, das heißt sie ökonomisch zu vernichten. Die parlamentarische Demokratie wurde als korrupt verdammt, und die angestrebte »Schaffung einer starken Zentralgewalt« deutete auf die Errichtung einer Diktatur hin. Das Programm wurde für »unabänderlich« erklärt, weil Hitler endlose Debatten, wie in normalen Parteien, vermeiden wollte. Bald darauf wurden die meisten der 25 Punkte auf Eis gelegt, und die Nationalsozialisten – kurz »Nazis«, analog zu »Sozis« für Sozialdemokraten – gaben nie ein Wahlprogramm heraus, wie es andere Parteien üblicherweise taten. Hitler billigte einen Entwurf für die Parteifahne, die geschickt die alten kaiserlichen Farben Schwarz, Weiß und Rot aufnahm, um traditionelle Konservative und Monarchisten anzusprechen, wobei der rote Hintergrund für Sozialismus stand und das schwarze Hakenkreuz in einem weißen Kreis Rassismus, Ultranationalismus und Antisemitismus repräsentierte. Und vom 7. August 1920 an unterstrich Hitler den revolutionären Charakter der Partei, indem er seine Zuhörer nicht mehr traditionell bürgerlich als »Meine Damen und Herren« ansprach, sondern, bewusst auf die von den Linken benutzte Anrede »Genosse« anspielend, als »Volksgenossen und Volksgenossinnen«.[15]
Im Frühjahr 1920 schuf die Bildung einer streng rechtsgerichteten Regierung in Bayern unter Gustav Ritter von Kahr eine für die Nationalsozialisten und andere rechtsextreme Gruppen günstige Atmosphäre. Angesichts eines reaktionären Putschs in Berlin, der durch einen von sozialdemokratischen Gewerkschaften angeführten Generalstreik nur knapp vereitelt wurde, und einer Reihe von Mordanschlägen auf liberale und linke Politiker durch junge Fanatiker der terroristischen Untergrundgruppe »Organisation Consul« schien die Weimarer Republik nicht in der Lage zu sein, die Schwierigkeiten ihrer ersten Monate zu überwinden. Hitlers Selbstvertrauen wuchs mit dem ständigen Wachstum der Zuhörermenge, die er anzog, und als andere Mitglieder der Parteiführung die Fusion mit einer weiteren rechtsextremen Gruppe vorschlugen, trat er aus Protest zurück. Sie wussten jedoch, dass er unentbehrlich war, und so gaben sie nach und holten ihn mit der Zusage diktatorischer Macht über die Partei zurück. Als seine zunehmende Bekanntheit unter Rechtsextremen wuchs, begann sich ein Kreis von Gefolgsleuten um ihn zu bilden, zu dem unter anderen Rudolf Heß, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Ernst Röhm, Alfred Rosenberg und Julius Streicher gehörten, neben einigen seiner ursprünglichen Förderer wie Anton Drexler, Dietrich Eckart und Gottfried Erler. Ihre unverhohlene Bewunderung steigerte sein Selbstvertrauen weiter und brachte ihn schließlich zu der Überzeugung, dass er die Demütigung Deutschlands beenden und es in eine glänzende Zukunft führen werde. Ende 1922 bezeichneten Parteimitglieder ihn als den »Führer« und begannen den Hitlergruß zu benutzen, der 1926 in der Partei zur Pflicht wurde.[16]
Sobald Hitler die Führung der NS-Bewegung übernommen hatte, nahm sie physische Gewalt als neues Element in ihr Repertoire auf. Die Partei setzte bei ihren öffentlichen Veranstaltungen bereits Ordner ein, aber im Lauf des Jahres 1921 wurden sie zu organisierten Einheiten, die informell Sturmabteilungen (SA) genannt wurden, mit Hans Ulrich Klintzsch, einem jungen Ex-Mitglied des rechtsextremen Killerkommandos Organisation Consul, an der Spitze. Sie schlugen bei Hitlerauftritten Protestler zusammen und warfen sie hinaus und bewaffneten sich, von ehemaligen Freikorpsmitgliedern unterstützt, mit Messern, Gummiknüppeln, Schlagringen und sogar Handfeuerwaffen und Granaten, um sich erbitterte Kämpfe mit den paramilitärischen Einheiten anderer Parteien, insbesondere der Sozialdemokraten, zu liefern. Nach einer besonders blutigen Saalschlacht wurden Hitler und andere nationalsozialistische Beteiligte verhaftet, vor Gericht gestellt und zu dreimonatiger Haft wegen Landfriedensbruchs verurteilt. Aber die Nationalsozialisten waren nicht die Einzigen, die organisierte politische Gewalt ausübten. Die Militarisierung der Politik war eine Folge der vier Kriegsjahre, denen in vielen Teilen Europas, von Irland bis Schlesien, eine Phase bewaffneter Konflikte folgte. Zusätzlich radikalisiert wurde der politische Antagonismus durch den Aufschwung des in der Gewalt der bolschewistischen Revolution in Russland geborenen Kommunismus, der entschlossen war, die »bourgeoise« Demokratie und die existierende Gesellschaftsordnung zu stürzen. In Norditalien eroberten faschistischesquadristi unter Führung des ehemaligen Sozialisten Benito Mussolini gewaltsam die Macht in Städten und Gemeinden, bis sie 1922 schließlich zum angedrohten »Marsch auf Rom« aufbrachen, durch den das politische Establishment dazu erpresst wurde, Mussolinis Ernennung zum Ministerpräsidenten zuzustimmen.[17]
Mussolinis Erfolg beeindruckte Hitler und die Nationalsozialisten zutiefst. Sie waren in vielerlei Hinsicht von seinem Stil beeinflusst, was sich unter anderem in der Übernahme des Begriffs »Führer«, dem pseudorömischen Gruß – mit ausgestrecktem rechten Arm, worauf der »Führer« mit erhobenem, aber nach hinten gebogenem Arm mit offener Handfläche erwiderte – und dem Tragen von Standarten bei Paraden äußerte. Der erfolgreiche »Marsch auf Rom