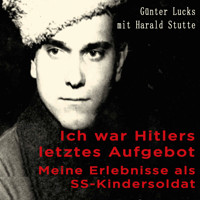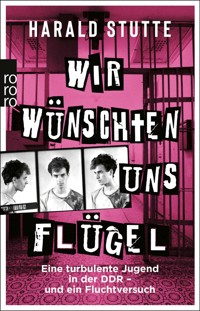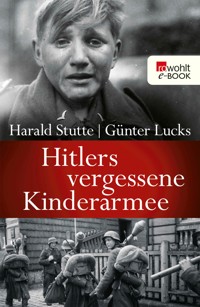
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Frühjahr 1945 wirkten sie als Statisten im letzten Kapitel des untergehenden Nazi-Reiches mit. Sie waren Teil einer «Kinderarmee», Hitlers letzten Aufgebots. In einem «Reichsausbildungslager» (RAL) der Hitlerjugend im südmährischen Bad Luhatschowitz waren die 16- und 17-Jährigen in Schnelllehrgängen zu Soldaten geschliffen worden, zusammen mit über 1000 Gleichaltrigen. Anschließend kassierte die Waffen-SS die Kindersoldaten und verheizte sie in einem Krieg, der zu diesem Zeitpunkt längst verloren war. Im September 1944 ordnete die NS-Führung, ihr nahes Ende vor Augen, die «Erfassung aller zwischen 16 und 66 Jahren» an. Erzogen treu im Glauben an Führer und Vaterland, folgten Tausende diesem Aufruf. In Wahrheit waren diese Kinder jedoch nicht «wehrfähig», geschweige denn «Männer». Acht ihrer Geschichten werden hier erzählt. Zu «Ich war Hitlers letztes Aufgebot»: «Das Verdienst dieses ehrlichen Buches liegt darin, dass es die ganze Komplexität dessen offenbart, was Krieg bedeutet. Es ist sorgfältig, spannend und sachlich erzählt und historisch gut recherchiert.» Welt am Sonntag «Der Text hat mich berührt.» Günter Grass
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Harald Stutte • Günter Lucks
Hitlers vergessene Kinderarmee
Über dieses Buch
Im Frühjahr 1945 wirkten sie als Statisten im letzten Kapitel des untergehenden Nazi-Reiches mit. Sie waren Teil einer «Kinderarmee», Hitlers letzten Aufgebots. In einem «Reichsausbildungslager» (RAL) der Hitlerjugend im südmährischen Bad Luhatschowitz waren die 16- und 17-Jährigen in Schnelllehrgängen zu Soldaten geschliffen worden, zusammen mit über 1000 Gleichaltrigen. Anschließend kassierte die Waffen-SS die Kindersoldaten und verheizte sie in einem Krieg, der zu diesem Zeitpunkt längst verloren war. Im September 1944 ordnete die NS-Führung, ihr nahes Ende vor Augen, die «Erfassung aller zwischen 16 und 66 Jahren» an. Erzogen treu im Glauben an Führer und Vaterland, folgten Tausende diesem Aufruf. In Wahrheit waren diese Kinder jedoch nicht «wehrfähig», geschweige denn «Männer». Acht ihrer Geschichten werden hier erzählt.
Zu «Ich war Hitlers letztes Aufgebot»: «Das Verdienst dieses ehrlichen Buches liegt darin, dass es die ganze Komplexität dessen offenbart, was Krieg bedeutet. Es ist sorgfältig, spannend und sachlich erzählt und historisch gut recherchiert.» Welt am Sonntag
«Der Text hat mich berührt.» Günter Grass
Vita
Harald Stutte ist Historiker, Journalist und Autor. Er wurde mit dem Reportagepreis der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten ausgezeichnet. Er lebt und arbeitet in Hamburg.
Günter Lucks, Jahrgang 1928, war nach einer Ausbildung bei der Post bis zur Rente in der Druckerei und bei der Poststelle des Axel Springer Verlags beschäftigt. Eine Einladung der Bundeswehr in Gründung, ihr als Offizier beizutreten, hatte er abgelehnt.
Beide Autoren gemeinsam haben 2010 bei Rowohlt den Bestseller «Ich war Hitlers letztes Aufgebot. Meine Erlebnisse als SS-Kindersoldat» publiziert.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2014
Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Frank Strickstrock
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
(Abbildung: Getty Images/Hulton Archives/John Florea; bpk/Benno Wundshammer)
ISBN 978-3-644-50701-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Vorwort
Ein Schuh am Dorfteich
Der Soldat-Darsteller
Ein langer Marsch zurück nach Hause
Gefangen auf der «Brücke von Remagen»
Der Sound der freien Welt
Kein einziger Schuss «für Führer und Vaterland»
Das Kainsmal am Oberarm
Der Tag, an dem das Lachen starb
Der Tod im Nacken
Das letzte Aufgebot der Waffen-SS
Ein Treffen in Leipzig
Danksagung
Bildnachweis
Vorwort
Kindersoldaten sind nach der Definition von UNICEF, Terre des hommes und Amnesty International «alle Kämpfer und deren Helfer, die unter 18 Jahre alt sind». Deutschland setzte im 2. Weltkrieg, besonders am Ende, massiv auf den Einsatz von Kindersoldaten. In ihrer Lage der militärischen Ausweglosigkeit war die NS-Führung bereit, die Jugend und damit Deutschlands Zukunft auf dem Schlachtfeld zu opfern.
Der deutsche Publizist Günter Gaus (und nicht der ehemalige Kanzler Helmut Kohl, der ihn in anderem Zusammenhang übernahm) prägte einst den schönen Satz von der «Gnade der späten Geburt». Und beschrieb damit das Glück seiner Generation, des Jahrgangs 1929, zu spät geboren zu sein, um noch im Dienste der NS-Herrscher im Krieg verheizt worden zu sein. Übersehen wurde dabei, dass diese Gnade nur einem Teil dieser Generation zuteil wurde. Denn schätzungsweise 60000 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, der von 1927 bis 1929 geborenen Jungen also, fielen allein in den Kämpfen der letzten Kriegswochen. Überwiegend waren sie von Herbst 1944 bis Kriegsende Mai 1945 einberufen worden.
Die Militarisierung der Jüngsten begann im nationalsozialistischen Deutschland früh, wurde aber erst mit der Ausrufung des «totalen Krieges» nach der Niederlage von Stalingrad Anfang 1943 für die Jugend zum tödlichen Ernst. Bis zu 200000 Jungen der Jahrgänge 1926 und 1927 – der damals 15- und 16-Jährigen also, später kam noch der Jahrgang 1928 hinzu – wurden im Reich als Luftwaffen- und Marinehelfer eingesetzt, einer früheren Idee des Reichsluftfahrtministeriums aus dem Jahr 1942 folgend. Vor allem als Luftwaffenhelfer (LWH) sollten sie die deutschen Städte vor den alliierten Bombenattacken schützen, weil die zuvor in den Fliegerabwehrstellungen dienenden Männer an der Front gebraucht wurden. Der Einsatz der Schüler und Teilzeit-Kanoniere erfolgte überwiegend in unmittelbarer Umgebung ihrer Schulstandorte oder Heimatorte, nur teilweise wurden sie kaserniert, überwiegend konnten sie zu Hause wohnen. Sie waren allerdings keine Soldaten, wurden auch nicht vereidigt, trugen aber Uniformen.
Doch schon bald wurden auch reguläre Verbände jugendlicher Kämpfer gebildet. Nach einer Idee des Reichsjugendführers Artur Axmann, der dem «Führer» zum Geburtstag eine militärische Einheit aus Hitlerjungen «schenken» wollte, wurde im Juli 1943 auf Freiwilligen-Basis die Panzerdivision «Hitlerjugend» aufgestellt. Anderen Quellen zufolge geht der Plan, eine nur aus Jugendlichen zusammengesetzte SS-Division zu bilden, auf eine Idee des SS-Gruppenführers Gottlob Berger zurück, die sein Chef, Reichsführer SS Heinrich Himmler, begeistert aufgriff. Dabei soll Himmler von Zustand und Motivation der deutschen Jugend gar nicht viel gehalten haben. In einem internen Schreiben an Martin Bormann, den Chef der Reichskanzlei, beschwerte sich Himmler über die «körperliche Verfassung» der Jugend, die «im Durchschnitt schlechter als vor dem Krieg» sei. Himmler: «Die körperliche und rassische Auslese ließ von vorne herein einen nicht unerheblichen Prozentsatz (40 Prozent) für die Werbung ausscheiden.»
Zudem machte es diese Generation, obwohl sie im Nationalsozialismus aufgewachsen, sozialisiert und durch ihn indoktriniert worden war, den Werbern schwer. So beklagte Himmler die «geistige Haltung (sei) schlecht. Unverkennbare Einflüsse durch das Elternhaus, Kirche usw. machen sich bemerkbar …» So kam es immer wieder vor, dass «die Gemusterten weinten und sich andererseits freuten, wenn sie nicht kV (kriegsverwendungsfähig) geschrieben werden konnten.»
Die im Juli 1943 aus 16- bis 18-jährigen Hitlerjungen gebildete «Jugendarmee» wurde zunächst in Belgien stationiert und später in 12. SS-Panzer-Division «Hitlerjugend» umbenannt. Im Juni 1944 wurde die Division in Caen in der Normandie in ihre «Feuertaufe» geschickt. Die von den Alliierten «Babydivision» genannte Truppe erlitt schon nach kurzer Zeit mit 4000 Toten enorme Verluste. Als sie im Herbst 1944 kämpfend auf das Reichsgebiet zurückwich, hatte sich ihre Mannschaftsstärke bereits halbiert. Für den Historiker Peter Lieb war das der «am stärksten nationalsozialistisch indoktrinierte Verband der gesamten deutschen Streitkräfte».
Nach den schweren Verlusten des Jahres 1944 forcierte die NS-Führung die Bemühungen, den Jahrgang 1928, also die 16-Jährigen, für den Dienst in Waffen-SS und Wehrmacht zu gewinnen – immer noch auf der Basis von Freiwilligkeit. Doch der Druck auf die jungen Menschen war enorm, regelmäßig traten NSDAP-Funktionäre und Offiziere der Wehrmacht und der SS vor den Jugendlichen auf. Vor teilweise bizarrem Hintergrund: So berichtete Adolf Roos aus dem unterfränkischen Esselbach, in der Turnhalle der Kreisstadt Marktheidenfeld, in der sich der 15-Jährige im Juni 1944 anwerben ließ, habe ein überdimensionales Transparent mit folgendem Spruch gehangen: «Stalin jetzt wird’s ranzig – es kommt der Jahrgang 28!» Ob durch solch plumpe Parolen oder durch den erhöhten Anwerbedruck – tatsächlich schaffte es die NS-Führung, dass sich bis Herbst 1944 70 Prozent des Jahrgangs 1928 freiwillig zum Kriegsdienst meldeten.
Am 25. September 1944 folgte der Erlass Hitlers zur Bildung des Volkssturms, das Prinzip Freiwilligkeit wurde aufgegeben. Die nunmehr 16-jährigen Jugendlichen des Jahrgangs 1928 galten ab sofort als «letzte Blutreserve», wie es in einem internen Schreiben der Partei-Kanzlei hieß. Ziel war es, aus diesem Jahrgang bis Ende März 1945 300000 Kämpfer für Waffen-SS und Wehrmacht zu gewinnen. Hitler sagte am 8. Oktober 1944: «Die Jugend unserer nationalsozialistischen Bewegung hat an der Front und in der Heimat erfüllt, was die Nation von ihr erwartet. Vorbildlich haben eure Kriegsfreiwilligen in den Divisionen ‹Hitlerjugend›, ‹Großdeutschland›, in den Volksgrenadierdivisionen und als Einzelkämpfer in allen Wehrmachtsteilen ihre Treue, ihre Härte und ihren unerschütterlichen Siegeswillen durch die Tat bewiesen …»
1945, das drohende Ende vor Augen, ging die NS-Führung noch einen Schritt weiter. Selbst die 14- und 15-Jährigen wurden bei HJ-Kampftrupps und den Panzerabwehr-Kommandos verheizt. In einem Aufruf des Reichsjugendführers Artur Axmann heißt es: «Ich weiß, dass der Jahrgang 1929 dem Jahrgang 1928 in seiner Entschlossenheit, für die Freiheit und eine glückliche Zukunft zu kämpfen, in nichts nachstehen wird. Der Feind steht in der Heimat und bedroht unmittelbar unser Leben. Bevor wir uns vernichten oder knechten lassen, wollen wir zäh und beharrlich bis zum endlichen Siege kämpfen.»
Anlässlich der Aufnahme des Geburtenjahrgangs 1935 in die Hitlerjugend erklärte Axmann am 26. März 1945: «Der Sinn der diesjährigen Verpflichtung liegt darin, die Jugend Adolf Hitlers muss das Zentrum des nationalen Widerstandes sein. Leidenschaftlich bekennt die Jugend, wir kapitulieren nie. Dieser Vernichtungskrieg lässt keine bürgerlichen Maßstäbe mehr zu …» Mit der irrsinnigen Konsequenz, dass zwischen 1939 und 1945 an den Fronten des Krieges über eineinhalb Millionen junge Deutsche der Jahrgänge 1920 bis 1929, die das 19. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, ihr Leben ließen.
In diesem Buch schildern acht Betroffene ihre Erlebnisse als Kämpfer in «Hitlers vergessener Kinderarmee», in Gefangenschaft und in der Nachkriegszeit. Es ist die letzte, noch lebende und lange Zeit vergessene Generation von Kriegsteilnehmern, gedacht als Kanonenfutter und Auffüllreserve der Waffen-SS, die jetzt ihr Schweigen bricht.
Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet jene Generation, die als «letzte Blutreserve» des Nazi-Reiches dem Untergang geweiht zu sein schien – die Jahrgänge 1928 und 1929 also –, später zu den maßgeblichen Trägern des deutschen Nachkriegsgeistes wurde. Walter Kempowski, Heiner Müller, Christa Wolf, Günter Gaus, Karlheinz Böhm, Hardy Krüger, Oswalt Kolle, der Entertainer Harald Juhnke, die Kirchentagsikone Dorothee Sölle, ja im erweiterten Sinne auch die Literaten Günter Grass und Martin Walser (beide Jahrgang 1927) – sie alle und noch mehr gehörten dieser «verlorenen Generation» an. Und prägten doch das vom Ungeist der NS-Ideologie sich befreiende Nachkriegsdeutschland maßgeblich.
Ein Schuh am Dorfteich
Auf Spurensuche in Tschechien und Österreich
Es gibt eine Region, da wirkt die Alpenrepublik Österreich so platt wie die Tafel eines riesigen Tisches. Das Weinviertel Niederösterreichs im nordöstlichen Winkel des Landes wird geprägt von den Niederungen der Flüsse Thaya, March, Donau und ähnelt über weite Strecken den waldlosen Tiefebenen der Magdeburger Börde oder Nordwestsachsens. Ihren Namen verdankt die Region der Tatsache, dass sich hier Mitteleuropas größtes Weinanbaugebiet befindet. Weniger bekannt sein dürfte, dass unter dem fruchtbaren Lössboden Mitteleuropas größte Erdölvorkommen schlummern, die hier seit der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts abgebaut werden.
Das Dreiländereck zwischen Tschechien, der Slowakei und Österreich ist eine von den Verkehrs-, Waren- und Touristenströmen bislang nur wenig frequentierte Region an der Peripherie der EU. In den 70er Jahren und im Schatten des Eisernen Vorhangs war es der vielleicht entlegenste Winkel der freien Welt. Gleich oberhalb der Kellergasse am Dorfrand der Grenzgemeinde Katzelsdorf begann der Ostblock – in Gestalt der mit Stacheldraht, beleuchteten Grenzstreifen und auf langen Holzbeinen thronenden Wachtürmen gesicherten Staatsgrenze zur damals kommunistisch regierten Tschechoslowakei. Kellergassen heißen Wege in den Dörfern des Weinviertels, in denen sich ein unterirdischer Weinkeller an den anderen reiht – für Ortsfremde sehen sie aus wie normale Wohnhäuser, auch wenn die großen Holztore eher an Garageneinfahrten erinnern.
Für den hier aufgewachsenen Gerhard Hofmeister war hinter Katzelsdorf schlicht die Welt zu Ende. Das Land hinter dem Stacheldraht schien so fern und unerreichbar wie der Mond. Manchmal warfen die Buben Dinge über den «Eisernen Vorhang», die man nicht mehr brauchte – ein paar alte Schuhe, einen kaputten Fußball oder die Mütze des Jungen, der stets geärgert wurde. Doch vor solchen Streichen warnten die Erwachsenen im Dorf stets, denn hinter der Grenze, da herrschte eine unbekannte, etwas unheimliche, ganz sicher aber unberechenbare Macht, vor der selbst die Eltern einen mit Angst gemischten Respekt pflegten. Dafür konnten sich die Kinder sicher sein, dass die Dinge, die über den Grenzzaun flogen, auf Nimmerwiedersehen verschwanden, ihr irdisches Dasein sich de facto auflöste. Ab und zu wagten die Buben einen Blick in diese fremde Welt, mit dem Fernglas beobachteten sie die tschechischen Soldaten auf den Hochständen, die nur unwesentlich älter waren als sie selbst. Oder die tschechischen Bauern auf ihren rückständig aussehenden Traktoren, die ihre Felder bestellten. Als Mutprobe galt, ein paar Schritte hinter die Grenzpfähle in Richtung Zaun zu laufen – und schnell wieder zurück.
An einem milden Maitag des Jahres 1980 beobachtete der damals zwölfjährige Gerhard mit seinem zweieinhalb Jahre jüngeren Bruder Michael Arbeiter bei Ausschachtungsarbeiten an der «Lacke». Kleine Auffangteiche für das alljährliche Abfischen sollten so entstehen. Denn die «Lacke», das ist ein fußballfeldgroßer Dorfteich, der von einem zweiten ebenfalls fußballfeldgroßen Dorfteich nur durch einen schmalen Damm getrennt wird. Beim alljährlichen Abfischen im Herbst wird die «Lacke» durch Aufbrechen des Damms einfach abgelassen, die Fische können dann mit Köchern «geerntet» werden.
Als die Arbeiten in der Mittagszeit ruhten, spielten die Kinder in der freigelegten Grube – und stießen im morastigen Untergrund auf einen schwarzen Schuh, einem groben Arbeitsschuh ähnlich. Die Schuhspitze ragte etwas aus der Erde. Die Neugier packte sie, wer träumt in diesem Alter nicht von Schätzen, ungelösten Kriminalfällen, verschwiegenen Räuberverstecken?
Ein eiskalter Schauer bemächtigte sich ihrer, als sie die Schuhspitze nach oben klappten und sich ihnen ein Zehenknochen entgegenstreckte. Beim weiteren Graben stießen sie auf einen zweiten Schuh. Beim Versuch, diesen aus der Erde zu ziehen, entdeckten sie einen mächtigen Knochen, der im Schuh mündete, umhüllt von vermoderten, schmutzig grauen Stofffetzen. Viel Phantasie war nicht nötig, um sich auszumalen, dass es sich nur um menschliche Gebeine handeln konnte. Als Michael auf eine Schädeldecke stieß, gab es keinen Zweifel mehr daran, dass hier ein toter Mensch lag. Gerhard Hofmeister war sich in diesem Moment sicher, einem Kriminalfall auf die Spur gekommen zu sein. In seiner Phantasie sah er bereits die künftigen Schlagzeilen: «Mord in Katzelsdorf». Die Kinder fanden in unmittelbarer Umgebung der menschlichen Überreste einen schmutzigen, aber noch intakten Füller, eine Silbermünze im Wert von fünf Reichsmark aus dem Jahr 1940, darauf abgebildet die Potsdamer Garnisonkirche. Weiter eine verrostete Mundharmonika und eine blecherne Erkennungsmarke. Die damals neunjährige Hedwig Kreuzwegerer, die mit ihrem Fahrrad die Stelle passierte, erinnert sich auch an einen Goldzahn, der im Kiefer des Schädels steckte.
Sie alarmierten die Bauarbeiter. Und ab sofort ruhten die Baggerarbeiten. Die Kinder wurden umgehend von der Grabungsstelle ferngehalten. Katzelsdorf, die Gemeinde im Schatten des Eisernen Vorhangs an der Peripherie der freien Welt, hatte für Tage ein Dorfgespräch. Und ganz allmählich kehrten bei den älteren Katzelsdorfern die Erinnerungen an eine Zeit zurück, über die zuvor im Dorf wenig oder gar nicht gesprochen worden war. Die Spuren, auf die die Buben da gestoßen waren, führten über 35 Jahre in die letzten Tage des 2. Weltkriegs zurück. Denn das beschauliche Niederösterreich, das den Krieg bis zum April 1945 relativ unbeschadet im «toten Winkel» der großen europäischen Tragödie überstanden hatte, war damals für zwei Wochen zu einem heftig umkämpften Schauplatz im Todeskampf des untergehenden «Dritten Reiches» geworden.
1) Einschusslöcher in der Giebelmauer eines Weinkellers in Altlichtenwarth: Gerhard Hofmeister auf den Spuren der letzten Kriegswochen.
Gepackt von Schauder und Neugier, begann Gerhard Hofmeister zu forschen. Denn das, was er mit seinem Fund angestoßen hatte, war nicht zu vergleichen mit dem langweiligen Pauken historischer Jahreszahlen im Geschichtsunterricht der Volksschule. Das war Geschichte, ausgeschmückt mit Geschichten, Schicksalen und Tragödien. Augenzeugen erzählten ihm, dass der junge Mann, dessen Gebeine die Jungen gefunden hatten, im April 1945, also kurz vor Ende des Krieges, in Katzelsdorf erschossen worden war. Mit einem Schuss in die Stirn, wie die Jungen anhand des Schädels bereits rekonstruiert hatten. Damals hatten in der Region heftige Kämpfe mit der Roten Armee getobt, die, mit großer Geschwindigkeit einer Feuerwalze gleich aus der südöstlich angrenzenden Slowakei kommend, Niederösterreich überrollte.
Es waren jedoch nicht Sowjetsoldaten, die das Leben dieses jungen Deutschen ausgelöscht hatten. Er war zusammen mit zwei weiteren Kameraden erschossen worden, weil er, die Sinnlosigkeit dieses Krieges vor Augen, auf seine innere Stimme gehört hatte. Und die hatte wohl einfach nur Heimweh und war kriegsmüde. Für die letzten Fanatiker in Hitlers Armee war dieser Mann ein Deserteur. Heute weiß Gerhard Hofmeister, dass der junge Mann, dessen Soldatenmarke sie am Hals fanden, Reinhold Götze hieß und aus Dresden stammte. Noch zu Zeiten der Teilung Europas nahm Hofmeister zu der in der damaligen DDR lebenden Witwe des erschossenen Soldaten Kontakt auf. Die alte Frau, die längst wieder verheiratet war, war gerührt, endlich über das Schicksal ihres als verschollen geltenden einstigen Lebensgefährten Auskunft zu erhalten. Erst jüngst hat Gerhard Hofmeister erfahren, dass ein weiterer der am Dorfteich erschossenen Soldaten Albrecht Manys hieß und am Tag seiner Hinrichtung 18 Jahre jung war.
Katzelsdorf, Anfang April 1945. Noch war es ruhig in Niederösterreich. Nur aus der Ferne, aus den Westkarpaten, die am östlichen Horizont das slowakische Kernland säumen, war ein tiefes Grollen zu hören, einem Gewitter ähnlich. Mit jedem Tag schwoll dieses Grollen an, gelegentlich unterbrochen von Stunden oder gar Tagen der Ruhe, bevor es umso heftiger wieder einsetzte und davon kündete, dass das unvermeidliche Ende des «1000-jährigen Reiches» bevorstand. Der Krieg sollte da nur noch einen Monat dauern. Am 7. April hatten die sowjetischen Truppen bei Hohenau, heute direkt im tschechisch-slowakisch-österreichischen Ländereck gelegen, die March überquert. Eine Woche später fiel Hohenau. Ein Triumph für die sowjetischen Strategen, denn vor ihnen lag das an Bergen und Wäldern arme Weinviertel, kaum ein natürliches Hindernis blockierte den Weg nach Wien, Prag oder Pilsen. Gleichzeitig eine schier unlösbare Aufgabe für die Verteidiger, die sich in dieser baum- und hügellosen Landschaft der sowjetischen Walze entgegenstellten. Es war die Zeit, in der sich der Hauptstoß der Roten Armee in Mitteleuropa von der Oder kommend auf Berlin konzentrierte. Hier in Niederösterreich, einem Nebenkriegsschauplatz, schickten die bereits arg dezimierten deutschen und verbündeten Verbände auch Kindersoldaten in die Schlacht, 15- bis 16-jährige Knaben, die man eben noch in Schnelllehrgängen im mährischen Bad Luhatschowitz das Einmaleins des Kriegshandwerks gelehrt hatte – schießen, ducken, laufen. Das hatte sie aber längst nicht zu vollwertigen Soldaten werden lassen. Großspurig hatte man diese Knaben dennoch der Waffen-SS eingegliedert, als Teil der «Kampfgruppe Böhmen und Mähren» der SS-Panzergrenadierdivision «Hitlerjugend». Einst war der Waffen-SS der Ruf als Hitlers soldatische Elite vorausgeeilt, nun aber, 1945, war sie längst zu einem Auffangbecken von Hilfssoldaten geworden – mit Halbwüchsigen und ausländischen Überläufern.
In jenen Apriltagen 1945 spielte die damals zehnjährige «Anni» Anna Hofmeister mit ihren Freundinnen auf der Straße, es waren die ersten warmen Tage nach einem hier in Niederösterreich oft harten, eisigen und langen Winter. Sie scherzte mit den Soldaten, die nur ein paar Jahre älter waren als sie und die seit Tagen im Dorf aus und ein gingen. Die Soldaten waren freundlich, sprachen fremde deutsche Dialekte, sächsisch zum Beispiel, die Kinder fanden das lustig. Die Jungen in den viel zu großen Uniformen bedienten sich aus den reichlichen Weinvorräten, die die Dorfbewohner seit Generationen in ihren Kellern lagerten. Die Keller befinden sich in der Regel acht bis 30 Meter unter der Erde, wo Sommer wie Winter stets dieselbe Temperatur herrscht, etwa elf Grad.
Doch an einem dieser Apriltage kamen der kleinen Anni und ihren Freundinnen Soldaten entgegen, die sahen weder freundlich noch beschwipst aus, sondern ernst. Drei unbewaffnete Soldaten wurden von zwei anderen Uniformierten eskortiert. Die Begleitsoldaten trugen je ein von einer großen Kette gehaltenes Metallschild um den Hals, einem Latz ähnlich. «Feldgendarmerie» stand darauf, wie die Kinder lasen. Die Uniformen der eskortierten Soldaten hatte man ihrer Hoheitszeichen beraubt, sie selbst trugen keine Waffen und schauten zu Tode betrübt drein. «Wo geht ihr denn hin?», fragte eines der Mädchen. «Zum Sterben», antwortete eine tränenerstickte Knabenstimme, unterbrochen vom Befehlston eines Feldgendarmen: «Halt’s Maul!»
Anschließend schickten die grimmig dreinblickenden Bewacher, im Volksmund wurden diese Militärpolizisten «Kettenhunde» genannt, die Kinder barsch von der Straße. «Macht, dass ihr wegkommt. Na wird’s bald.» Die Kinder rannten nach Hause, spürten sie doch, dass da etwas Schreckliches vor sich ging. Sie erzählten ihren Eltern, was sie soeben gesehen hatten. Die Straßen leerten sich, die Katzelsdorfer waren keine Helden. Zudem war es nicht die Angst vor den eigenen Leuten, die wie ein drohendes Unwetter über dem Dorf lag, sondern vor dem, was da aus Richtung Osten auf sie zu rollte.
Im Wein liegt Wahrheit, und manchmal ist die Wahrheit ganz simpel: zum Beispiel, dass Jugendliche in den Uniformen einer Armee, die einen begonnenen Krieg längst verloren hat, nur Angst haben und nach Hause wollen. Vielleicht lag es am «Grünen Veltliner» und am «Welschriesling», dem die jungen Soldaten so reichlich zusprachen, dass immer mehr der jungen Soldaten verschwanden. Sie zogen ihre Uniformen aus, warfen die viel zu großen Helme in die Weinberge, beschafften sich bei den Bauern Zivilklamotten und ergriffen über Nacht die Flucht. «Was machen wir hier eigentlich?», war eine der meistgestellten Fragen unter den Teenagern, erinnert sich der Hamburger Günter Lucks. Der damals 16-jährige Lucks war Teil dieser Kinderarmee, die es nach Niederösterreich verschlagen hatte. «Unter uns gab es keinen, der fanatisch an den Endsieg glaubte», so Lucks. Die SS-Offiziere brüllten: «Die Russen da drüben sind ein feiger Haufen. Ihre Mäntel haben sie mit Stricken zusammengebunden, sie wollen nur Beute machen und laufen beim ersten Schuss panikartig davon.» Doch solche Versuche, in den angsterfüllten Kindern den Kampfgeist zu wecken, verpufften wirkungslos. Ohne Feindberührung schmolz die Kampfstärke der «Kampfgruppe Böhmen und Mähren» wie Eis in der Frühlingssonne. Ein großer Teil der jungen Männer hatte wohl längst begriffen, dass sie Schachfiguren, Bauernopfer in einem Vernichtungskrieg waren. Und dass es sich nicht mehr um die Geländespiele der Hitlerjugend handelte, nach denen man im Zweifel die Sachen packen und nach Hause gehen konnte.
An jenem Morgen hatten die Feldjäger in Katzelsdorf fünf Heimkehrwillige erwischt. Zwei von ihnen hatten sich in einem letzten verzweifelten Versuch noch losreißen können und waren in einer der verwinkelten Hohlgassen des Dorfes verschwunden. Dafür sollten die drei Aufgegriffenen die ganze Härte des deutschen Standgerichts zu spüren bekommen – auch wenn die Feldjäger geahnt haben mussten, dass der Krieg nur noch Tage dauern konnte. Auf dem Damm zwischen den Dorfteichen mussten sich die Delinquenten hinknien. Katzelsdorfer erzählten später, eines der Opfer habe auf Knien noch um Gnade gefleht – dann seien die Schüsse gefallen. Erstmals in diesem Krieg, der fast schon ausgestanden war, hielten die Katzelsdorfer für einen Moment den Atem an. Der damals zwölfjährige Eduard Hofmeister sah später in unmittelbarer Nähe des Hofes seiner Großeltern einen Leiterwagen stehen, darauf lagen die Leichen toter junger Soldaten.
Es waren nicht die ersten Kriegstoten im Weinviertel. Der damals neunjährige Heinrich Rebel aus dem Katzelsdorfer Nachbarort Altlichtenwarth beobachtete im Frühjahr 1945 aus einem Versteck, wie der polnische Zwangsarbeiter Ladislaus an einem Kirschbaum am Silberberg kurz hinter der Kellergasse gehängt wurde. Alle im Dorf kannten Ladislaus, der im Kaufhaus Pribizier als Verkäufer arbeitete. Ihm wurde zur Last gelegt, ein Verhältnis mit einer Altlichtenwartherin gehabt zu haben. Heinrich Rebel hat bis heute nicht vergessen, wie er das Genick seines polnischen Freundes aus seinem Versteck in fünfzig Metern Entfernung knacken hörte. Der Frieden im Weinviertel war nur ein schöner Schein.
Szenenwechsel: Hundert Kilometer nordöstlich von Katzelsdorf, der mährische Kurort Lázně Luhačovice an einem sonnigen Morgen im Spätsommer 2012. Von der mit bunten Sommerblumen durchwebten Waldwiese in einer Lichtung inmitten der dichten mährischen Mischwälder aus gesehen, bietet das kleine Städtchen im Tal den Anblick eines Postkartenidylls. Harmonisch schmiegen sich elegante Gründerzeitvillen an einen sanften Hang, der den Ort im Nordwesten begrenzt. Ihre versetzte Lage ist kein Zufall, denn so werden die Terrassen der Häuser von morgens an bis weit in die Nachmittage hinein von der Sonne beschienen. Ein kleiner Bach, die Stavnice, durchschneidet den Ort, von kleinen Brücken überspannt. Etwas weiter östlich im Zentrum Lázně Luhačovices strahlt seit über hundert Jahren das imperiale Palace-Hotel Noblesse aus, markiert selbstbewusst das Herz des kleinen Ortes rund um den zentral gelegenen «Platz des 28. Oktober», benannt nach dem Gründungstag der Tschechoslowakei 1918 aus der Erbmasse der untergegangenen Donaumonarchie Österreich-Ungarn.
Vor 68 Jahren – um die Jahreswende 1944/45, der 2. Weltkrieg näherte sich dem Ende – ist Bad Luhatschowitz zum Schicksal dieser jugendlichen Soldaten geworden, die später in Niederösterreich ihr Leben ließen, in Gefangenschaft gerieten oder mit viel Glück entkamen. Denn hier begann ihre Odyssee. Damals sah es in Bad Luhatschowitz ähnlich friedlich aus wie heute, zumindest auf den ersten Blick. Die Jugendstilvillen säumten auch damals schon das Tal an der überwiegend gefrorenen Stavnice, der Krieg hatte diesen Ort bis zu jenem Zeitpunkt verschont. Nur wer genau hinhörte, der konnte aus Richtung Südwesten, wo jenseits der slowakischen Grenze die Karpaten beginnen, jenes leise Grollen der unaufhaltsam näher rückenden Front vernehmen, das allmählich ein anderes Grollen ablöste – den im Herbst 1944 niedergeschlagenen Aufstand gegen das Regime von Jozef Tiso, des slowakischen Verbündeten Hitler-Deutschlands.
2) Blick auf den tschechischen Kurort Lázně Luhačovice; im Hintergrund vor dem Wald das Palace-Hotel.
Im Ort wurde damals viel deutsch gesprochen. Tausende Jugendliche aus dem gesamten Reichsgebiet hatte man hier zusammengezogen. Bereits nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, der Einverleibung der überwiegend von Deutschen besiedelten Gebiete und der Besetzungen des tschechischen Teils durch die deutsche Wehrmacht war Bad Luhatschowitz im Herbst 1944 de facto von der Hitlerjugend übernommen worden. In einem sogenannten Reichsausbildungslager (RAL) sollte der Unterführernachwuchs herangezüchtet werden. Damals wimmelte es in der nur etwa 5000 Einwohner zählenden Kleinstadt von uniformierten Kindern und Jugendlichen. Im großen Palasthotel waren der Stab und auch einige Einheiten untergebracht. Die prächtigen Jugendstilvillen, zumeist gebaut in der Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, waren beschlagnahmt worden. Die Eigentümer mussten sich nach Ersatzunterkünften umsehen. Das sorgte natürlich für Frustration und Wut unter den Bewohnern des Kurortes, das Verhältnis zu den Besatzern und den jugendlichen Gästen war entsprechend gespannt.
Der damals 16-jährige Günter Lucks aus Hamburg, der zuvor ein Jahr lang in Brünn gewohnt hatte und sehr gut tschechisch sprach, erinnert sich an keine Kontakte zu Einheimischen – außer man war auf der Suche nach etwas Tauschbarem. Eines Tages sprachen ihn zwei Tschechen an, in einem wienerisch gefärbten Deutsch. Sie boten ihm einige Schachteln Zigaretten an, begehrte Vorkriegsware mit der Aufschrift «Österreichische Tabaksregie!», garantiert von guter Qualität. Doch er hatte kein Geld. Und während er überlegte, wie man anderweitig ins Geschäft kommen konnte, hörte er die beiden Männer auf Tschechisch tuscheln. «Hlupák» (Blödmann) verstand er, womit ganz sicher er gemeint war, dem könnte man doch etwas «zum Pusten» («nečo za foukat») abknöpfen. Sie reagierten beinahe panisch, als Lucks sie fragte: «Za střelitne vid?» (Meint ihr etwas zum Schießen?) Schleunigst suchten sie das Weite. Vermutlich waren es Schieber, die den tschechischen Untergrund mit Waffen versorgten.
Bad Luhatschowitz begegnete den jungen deutschen Besatzern unterkühlt bis frostig, und das nicht nur der winterlichen Temperaturen wegen. Das empfand auch Willi Witte aus Westerland auf Sylt so, der damals, ebenfalls 16-jährig, im Ort ausgebildet wurde: «Die jungen Tschechen verhielten sich uns gegenüber absolut distanziert. Wir hätten natürlich gerne mal mit den hübschen Mädchen geflirtet. Aber die waren uns gegenüber eiskalt. Nicht einmal die zehn- oder zwölfjährige Tochter unserer Hauswirtin ließ sich ansprechen.» Dem damals 15-jährigen Karl-Heinz Gülland aus dem nordthüringischen Kyffhäuserkreis ist vor allem die Eiseskälte des mährischen Winters in Erinnerung geblieben: «Es war ein eisiger Januar, ich hatte mir den linken Fuß erfroren …» Jeden Tag mussten sie im tiefen Schnee durch die umliegenden Wälder laufen, robben, springen, «abends hatten wir nasse Klamotten, die in der Nacht stocksteif froren, da unsere Unterkünfte nicht beheizt wurden».
Abgesehen von den Strapazen der jugendlichen «Soldaten-Azubis» glich Bad Luhatschowitz damals einer Insel der Ruhe inmitten einer aus dem Ruder gelaufenen Welt. Der Ort lag im sogenannten «Reichsprotektorat», einem vom Deutschen Reich direkt verwalteten und regierten Landstrich, der nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei übrig geblieben war. Warum die Leitung der Hitlerjugend sich bei der Suche nach einem geeigneten Ort für ein sogenanntes «Reichsausbildungslager» (abgekürzt RAL) ausgerechnet für Bad Luhatschowitz entschied, ist nicht dokumentiert. Vermutlich spielte aber eine Rolle, dass die Jugendlichen hier sehr weit weg von daheim waren, was die Gefahr bannte, dass sich jemand, von Heimweh übermannt, spontan zur Heimreise entschloss. Nicht nur die Distanz war ein Handicap, auch hätte sich der Heimkehrer ohne Sprachkenntnisse durchschlagen müssen, in einem nicht gerade freundlich gesinnten Umfeld. Zudem war von Vorteil, dass in Bad Luhatschowitz keine Bombenattacken drohten, weil die Alliierten die tschechische Zivilbevölkerung, die ja auch NS-Opfer war, schonte.
Die Einrichtung der «Reichsausbildungslager» geht auf eine Idee des Reichsjugendführers Artur Axmann zurück, der am 20. März 1941 das erste Lager dieser Art im anhaltinischen Dessau besuchte. Ziel war es, Hitlerjungen, also Jugendliche und Kinder, für den gehobenen militärischen Dienst auszubilden. «Lehrgang für Wehrertüchtigung» nannte Axmann das im Erlass I J 2160 vom 22. Mai 1942. «Betrieben wurden die über das Reich verstreuten Lager zunächst von Reichsjugendführung und Wehrmacht», wie der Historiker Dr. René Rohrkamp erklärt. «Später übernahm die Waffen-SS die Kontrolle der Reichsausbildungslager. Dort wurden die Unterführerbewerber von SS-Ausbildern betreut», so Rohrkamp. Die Verschiebung der Machtverhältnisse hatte auch etwas mit dem Attentat auf Hitler von 1944 zu tun, in dessen Folge der Reichsführer SS, Heinrich Himmler, Chef des Ersatzheeres wurde. Rohrkamp: «Mit der Kontrolle über die Reichsausbildungslager hatte die SS direkten Zugriff auf den Nachwuchs und begann, frisches Personal in die Waffen-SS zu holen – in alter Konkurrenz zur Wehrmacht.»
Das RAL Bad Luhatschowitz wurde im Dezember 1944 gegründet. In einem «Führererlass» vom 25. September 1944 hieß es, alle «waffenfähigen Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren» hätten den Heimatboden zu verteidigen. Erzogen im Glauben an Führer und Vaterland, folgten Tausende diesem Aufruf. Doch in Wahrheit waren diese Kinder weder «waffenfähig», noch waren es «Männer». In Schnelllehrgängen wurden sie auf den Krieg vorbereitet. In Bad Luhatschowitz entschied sich das Schicksal Tausender Jugendlicher. Zwischen dem 8. Dezember 1944 und 5. März 1945 wurden in den drei Lehrgängen des neu eingerichteten RAL 7/35, so die offizielle Bezeichnung des Reichsausbildungslagers, rund 1400 junge Männer zu Soldaten gedrillt.
Hier begann ihre Odyssee, die in den meisten Fällen direkt in den Krieg führte, in den Kämpfen um die Reichshauptstadt, im Osten Österreichs oder auf dem Balkan gegen Titos Partisanen. Wer nach Bad Luhatschowitz geschickt wurde, war eigentlich für eine «Karriere» als «Unterführer des Heeres» vorbestimmt. Doch in den letzten Kriegswochen spielte das keine Rolle mehr.
Der eigentliche «Lageralltag» spielte sich im Ort ab – zwischen den Villen, die den Jugendlichen als Quartiere dienten, und dem Palace-Hotel, wo die Schulungsräume eingerichtet worden waren. In diesen Schulungsräumen wurden die Jugendlichen an den Vormittagen unterrichtet. Nach dem Mittagessen schlossen sich Übungen im Gelände an, der militärische Teil des Tages begann. Es wurde marschiert, gerannt, gerobbt, gesprungen, sich versteckt, angegriffen, sich verteidigt. Das alles glich den Geländespielen, die die Jungen von Jungvolk und Hitlerjugend kannten, als mit Fahrtenmessern die Armbinden der jeweiligen Gegnermannschaft erobert werden mussten.
Die Jugendlichen, denen ursprünglich nach Beendigung des Kurzlehrgangs die vorübergehende Heimkehr versprochen worden war, wurden kurz entschlossen an die näher rückende Front abkommandiert – kassiert als Auffüllreserve der Waffen-SS. Als leicht zu begeisterndes Kanonenfutter. Man steckte sie in Uniformen, die, falls überhaupt vollständig, oft zu groß waren. Nur einem Teil der Jungen wurde das Blutgruppenzeichen in den linken Oberarm tätowiert – untrügliches Zeichen der Zugehörigkeit zur Waffen-SS. Wer von den Jugendlichen das verräterische Zeichen aufwies, musste später den ganzen Hass der Sieger fürchten. Der Preis, den Hitlers Kinderarmee bezahlte, war immens. In militärischen Belangen vollends unerfahren, zudem hin- und hergerissen zwischen jugendlichem Fanatismus und Todesangst, entrichtete sie einen enorm hohen Blutzoll. Wer den Krieg überlebte, schlug sich allein in Richtung Heimat durch oder begab sich direkt in Gefangenschaft. Gerieten die Jugendlichen in die Hände tschechischer Partisanen, drohte ihnen kurzer Prozess, sobald ihre SS-Mitgliedschaft herauskam. Wer nicht das Glück hatte, aufgrund seines jugendlichen Aussehens von den Russen direkt nach Hause geschickt zu werden, auf den wartete eine lange, quälende Gefangenschaft mit körperlicher Schwerstarbeit, Krankheit, Schikanen durch die Sieger und vielen Entbehrungen.
Viele der jungen Menschen ließen es gar nicht erst so weit kommen, sondern desertierten. Sie organisierten sich zivile Sachen, strebten heimwärts – und landeten zu oft, wie der schaurige Fund in Niederösterreich verdeutlicht, in den Händen der Feldpolizei.
Zurück ins niederösterreichische Katzelsdorf: Für die Katzelsdorfer waren die Schüsse der Exekution im April 1945 die Vorboten einer schweren Zeit. In den folgenden Tagen kam es im Weinviertel zu schweren, verlustreichen Kämpfen. Vor allem im Nachbarort der Katzelsdorfer, in der damals etwa 1200 Einwohner zählenden Gemeinde Altlichtenwarth, gab es blutige, sich über mehrere Tage hinziehende Kämpfe. So stand am 17. April 1945 Eduard Hofmeister auf dem Weinberg, der ans elterliche Wohnhaus grenzt, welches damals wie heute auf der höchsten Katzelsdorfer Erhebung liegt. Ihm bot sich wie stets ein weiter Blick über die Ebene des Weinviertels, lediglich aufgehalten von den damals noch zahlreichen Bohrtürmen zur Erdölförderung sowie dem Hutsaulberg im sechs Kilometer entfernten Altlichtenwarth. Trotz seiner bescheidenen 274 Meter bildet der Altlichtenwarther Hutsaulberg einen der wenigen geographischen Orientierungspunkte in dieser Region. Genau dort sah der junge Eduard Granaten einschlagen, er hörte es knallen, krachen, donnern, sah Lichtblitze und Leuchtspurmunition wie Sternschnuppen durch die Dämmerung eilen. Aus dem östlich beziehungsweise südöstlich gelegenen Rabensburg und Hohenau kommend, hatten die Russen Altlichtenwarth am 17. April überrollt.