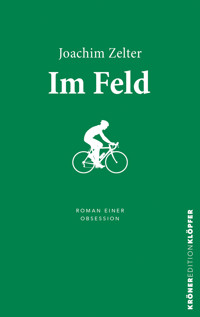17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: KrönerEditionKlöpfer
- Sprache: Deutsch
Ein Autounfall irgendwo in Deutschland. Schwer verletzt findet sich Jeremy Ash aus England in einem Krankenhaus wieder und kann – frisch operiert – nicht einmal die Klinikrechnung bezahlen. Damit beginnt der aberwitzige Aufenthalt in einer fremden Stadt, einem Absurdistan kafkaesker Ordnungen, ein Reigen der Panikbrücken und windgepeitschten Seilbahnen, der Begrüßungsdramen und nächtlichen Verfolgungsjagden – wo der Oberbürgermeister stets hinter der nächsten Ecke lauern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u.a. Der Ministerpräsident (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie Im Feld (2018). Zuletzt: Die Verabschiebung (2021), Professor Lear (2022) und Staffellauf (2024). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Preis der LiteraTour Nord. Er ist Mitglied im Deutschen PEN.
www.joachim-zelter.de
Joachim Zelter
Hoch Oben
roman
KRÖNEREDITIONKLÖPFER
Joachim Zelter
Hoch Oben
Roman
1. Auflage
in der KrönerEditionKlöpfer
Stuttgart, Kröner 2025
isbn druck: 978-3-520-75203-1
isbn e-book: 978-3-520-75293-2
Umschlaggestaltung Denis Krnjaić
unter Verwendung eines Fotos von Yan Ots, unsplash.com
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2025 Alfred Kröner Verlag, Lenzhalde 20, 70192 Stuttgart, [email protected], www.kroener-verlag.de · Alle Rechte vorbehalten
E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Für Hubert Klöpfer
I describe not men, but manners; not an individual, but a species.
henry fielding, Joseph Andrews
Vorbemerkung
Dieser Roman ist eine Fiktion. Was sonst könnte oder sollte ein Roman sein? Nichts als ein Haufen Lügen, wie der Bischof von Dublin über Gullivers Reisen einmal bemerkt hat. So auch hier. Karlsberg ist eine frei erfundene Stadt. Die darin handelnden Figuren sind fiktiv. Kurzum: Es handelt sich um einen Roman.
Von Birmingham über London nach Dover. Dort nahm ich die Autofähre nach Ostende. Die White Cliffs der englischen Südküste flimmerten noch im Dunst des grauen Wassers. Allmählich verschwanden sie im Meer. Ab Ostende fuhr ich auf der Autobahn weiter nach Deutschland. Bei Aachen ein erster Stopp. An der Raststätte sah ich eine bildschöne, mir zulächelnde Frau. Ihr ungekämmtes Haar wirkte auf mich wie ein nachlässig gebundener Federschmuck. Als wäre sie soeben aufgestanden oder würde demnächst wieder zu Bett gehen. Warum auch immer sie so betörend lächelte. Am Ende meinte sie womöglich gar nicht mich, sondern jemand ganz anderen. Nach einigen Minuten saß ich wieder am Steuer und folgte den Schildern Richtung Süden. Immer mehr Verkehr und endlose Staus. Für Stunden steckte ich zwischen zwei Baustellen fest, bewegte mich nur noch meterweise vorwärts. Das Radio vermeldete weitere Staus, kaum zu glaubende Kilometerzahlen, die sich zu einem endlosen, nahezu landesweiten Stillstand auftürmten. Jedes ernsthafte Vorankommen schien in weite Ferne zu rücken. Irgendwann beschloss ich, die Autobahn zu verlassen und es auf Nebenstrecken zu versuchen. Endlich wieder so etwas wie Bewegung, obgleich ich kaum mehr wusste, wo ich mich überhaupt befand. Zunehmende Dunkelheit. Ich fuhr auf obskuren Landstraßen, auf denen ich besser nicht hätte fahren sollen. Das Navigationssystem hatte mich in eine völlig entlegene Gegend geführt, an die letzten Ausläufer des Schwarzwaldes. So viel war noch zu erkennen. Die Dörfer wiederholten sich nun, nicht nur ihr Erscheinungsbild (graue Scheunen, verfallene Gasthöfe, verlassene Häuser), sondern auch ihre kaum noch zu unterscheidenden Namen. Sie endeten alle mit der Doppelsilbe ingen. Von welcher Richtung ich auf ein Dorf auch zufuhr, manchmal zum wiederholten Male – es handelte sich ausnahmslos um irgendein undefinierbares Ingen. Selbst das fügte sich nun in die Monotonie der immer dunkler werdenden Landschaft: Wilfingen, Wolpertingen, Vollmaringen … Wer immer sich derlei Namen einfallen lässt. Grüningen, Gründingen, Möggingen, Mötzingen … Als wäre kein Wort der Welt ohne eine solche Endung mehr denkbar. Ingen wie Zwingen. Ein ständiger Klingel- oder Begleitton einer nun fast schon panisch werdenden Orientierungslosigkeit.
Und dann plötzlich das reinste Nichts, nicht einmal mehr ein Ingen, sondern nur noch vereinzelte Gehöfte, immer grauer und abweisender werdend. Links und rechts das Dunkel dicht stehender Fichten und Tannen. Gelegentliche Bildstöcke. Auch sie führten zu keiner ernstzunehmenden Straße mehr. Stattdessen folgte nun, wie eine Draufgabe, eine Reihe von Umleitungen, ohne Sinn und Verstand. Sie bauten aufeinander auf oder gingen ineinander über, führten mich allesamt im Kreis, einmal und noch einmal und noch ein drittes Mal. Als wäre ich der einzige Mensch weit und breit, der es nicht schafft, eine Umleitung richtig zu deuten. So saß ich am Steuer: entnervt, resigniert, am Ende meiner Kraft. Dazu der ermüdende Rechtsverkehr, zunehmender Nebel und Regen, dann Graupel, die Ortsschilder waren kaum noch zu erkennen …
Mehrere Male überschlug ich mich: einen Abhang hinab, wie in Zeitlupe. Schließlich krachte der Wagen gegen einen Baum. Glassplitter. Der Motor lief noch. Eine Dampffontäne zischte durch die Ränder der Motorhaube. Womöglich war ich tatsächlich ein wenig zu schnell gefahren. Irgendwann ging der Motor aus. Stille. Als würde ich in einem Hotelzimmer liegen und endlich schlafen. Bis irgendwann ein Sanitäter gegen die Tür klopfte. Flankiert von Lichtkegeln. Ein Gemisch aus Blau- und Scheinwerferlichtern. Es war die falsche Tür, gegen die er klopfte, nicht die Fahrer-, sondern die Beifahrertür. Ich versuchte ihm das zu verdeutlichen. Ein englischer Wagen. Das Steuer auf der rechten Seite. Doch er verstand das nicht. Ich bemerkte nun einen zweiten Sanitäter, der ebenfalls unablässig klopfte. Dieses Mal war es die richtige Tür. Man schien zu begreifen, dass hier alles seitenverkehrt war. Links war rechts, rechts war links. Eine Endlosigkeit, bis die Tür endlich geöffnet war, mit mehreren aufeinanderfolgenden Tritten und Schlägen – und dann mit zerrenden Händen. Man trug mich einen Hang hinauf, hob die Trage, auf der ich angeschnallt lag, über Buschwerk und eine verbogene Leitplanke hinweg, hievte mich schließlich in einen Krankenwagen hinein. Dort legte man mir einen Zugang. Durch die geöffnete Tür sah ich noch die Wipfel einiger Tannen. Wie ein Postkartenbild sah das aus. Greetings from an accident in Germany. Irgendwann wurde die Tür des Krankenwagens geschlossen. Zum ersten Mal Schmerzen. Der Rettungssanitäter stellte mir einige Fragen, doch von dem, was er zu mir sagte, verstand ich so gut wie nichts. Obgleich ich eigentlich passabel Deutsch spreche. Wir fuhren bereits, langsam und bedächtig. Später sprach der Rettungssanitäter ein paar Worte Englisch mit mir. Ich verstand immer noch nichts. Entweder lag das an meinen Schmerzen oder an seinem Englisch. Über mir schaukelte eine Infusionsflasche. Irgendwann entfaltete das Schmerzmittel seine ganze Wirkung.
Als ich erwachte, war ich bereits operiert worden. Der rechte Arm lag wie unbeteiligt neben mir: bandagiert. Heller Vormittag. Die Sonne schien. Eine halb verborgene Drainage am Bettrand sammelte Sekrete und Blut. Eine Pflegerin kam an mein Bett: Ob ich Schmerzen habe? Weniger, als ich das erwartet hatte, so meine Antwort. Sie wechselte die Infusionsflasche und ging. Eine andere Pflegerin: Ob ich Deutsch spräche? Ich nickte. Ich sprach es die ganze Zeit. Wenn auch mit englischem Akzent.
Ein Mitpatient auf der anderen Zimmerseite: Amerikaner?
Nein, Engländer.
Engländer?
Ja.
Autounfall?
Offenbar ja.
Schuldig?
Was für eine Frage.
Für ihn war es die alles entscheidende Frage. Auf seinem Bett lagen zahlreiche juristische Abhandlungen und Gesetzestexte. Also schuldig oder nicht schuldig?
Ich hatte keine Ahnung.
Eigentlich war es mir egal.
Ihm dagegen war es nicht egal. Ihm schien es alles andere als egal zu sein. Bis er irgendwann abwinkte und sich zum Schlafen zur Seite drehte.
Ein Arzt kam herein. Er blickte auf die Infusionsflaschen und dann auf den bandagierten Arm. Fraktur des Ellenbogens. Olekranonfraktur. Man habe das mittels einer winkelstabilen Platte nachts noch fixiert. Der Arzt sagte das mit einer gewissen Genugtuung, in einem geradezu verständlichen Deutsch. Man reichte mir eine Art Frühstück, das ich mit der linken Hand zu mir nahm. Ich wollte aufstehen, doch der stechende Schmerz in meinem Bein machte jede weitere Bewegung zunichte. Auch das Bein war bandagiert. Man hatte es zudem noch geschient. Unterschenkelfraktur, so der Arzt. Man werde das gegebenenfalls noch operieren.
Operieren?
Ja.
Wann?
In den nächsten Tagen.
In einer Schublade fand ich mein Smartphone und andere Habseligkeiten. Mehr Gegenstände, als ich erwartet hatte. Ich richtete mich auf und schickte an meine Frau in England eine erste SMS. Kleiner Unfall. Little accident. Ihre Antwort: What do you mean by little? Ich schrieb zurück: Nothing to worry about. Call you later. Dabei beließen wir es erst einmal. Dann schrieb ich eine SMS an meine Schwester. Schon seit Stunden erwartete sie mich. Zahllose SMS-Nachrichten von ihr stauten sich auf meinem Smartphone: Wo ich sei? Warum ich mich nicht melde? Seit einigen Jahren lebt sie in Deutschland – sie ist sogar mit einem Deutschen verheiratet. Ihre Antwort war eine Mischung aus Entsetzen und Erleichterung: My goodness. Gefolgt von der Frage: Where are you?
I haven’t the faintest idea.
Bei meinem Mitpatienten erkundigte ich mich nach der Adresse der Klinik. Er antwortete in ausufernden Sätzen. Als wären es gleich drei Städte, in denen ich mich befand. Offenbar in Karlsberg.
Karlsberg?
Jawohl, Karlsberg.
Kein Ingen?
Nein, kein Ingen.
Wenigstens das.
Soweit ich ihn verstehen konnte, handelte es sich um eine altehrwürdige Stadt, eine Universitätsstadt. Weinberge und verwinkelte Gassen. Eine berühmte Bibliothek. Die Stadt anscheinend eine Art Oxford für Schwaben, so später auch meine Schwester. Als wollte sie mich (oder sich selbst) damit ein wenig beruhigen. Die mich behandelnde Klinik, so mein Mitpatient, sei die beste weit und breit. Wie um das zu unterstreichen, hörte man die Rotoren eines nahenden Rettungshubschraubers. Er landete – seinen eigenen Lärm weithin aufwirbelnd – auf dem Dach des Klinikums.
Ein Polizist trat ins Zimmer und befragte mich zum Unfallhergang.
Auf welcher Straßenseite ich gefahren sei.
Natürlich auf der Rechten.
Sind Sie sicher?
Ja.
Für ihn schien es eher die Linke gewesen zu sein. Allein schon aufgrund der Bremsspuren. Er zeigte mir Fotos: Sehen Sie. Als könnte ein Engländer gar nicht anders, als früher oder später auf der linken Seite zu fahren.
Meine Verwirrung wegen der ständigen Ortsnamen mit der Endung Ingen ließ er nicht gelten. Damit müsse selbst ein Ausländer umgehen lernen.
Müsse er das?
Jawohl.
In jedem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit. So der Polizist. Man werde das noch überprüfen lassen. Seitens eines Unfallsachverständigen. Der Wagen sei gute fünfzig Meter von der Straße entfernt an einem Waldrand aufgefunden worden. Totalschaden. Er sei nicht mehr zu reparieren. Man könne ihn nur noch verschrotten.
Verschrotten?
Jawohl.
Es war nicht mein Wagen, sondern der Wagen meiner Frau.
Der Polizist: Das tue ihm leid.
Mir tat es ebenfalls leid.
Und meiner Frau wahrscheinlich noch viel mehr.
Ein anderer Arzt, den ich bislang noch nicht gesehen hatte, trat an mein Bett und erkundigte sich nach meiner Krankenversicherung. Ein leicht sorgenvoller, wenn nicht gar mahnender Blick. An seinem Kittel war ein Schild zu sehen: Stabsstelle Finanzen. Ich reichte ihm sämtliche Karten, die sich in meinem Geldbeutel befanden: Private Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, Unfalltransportversicherung, Visa Card. Langsam hellte sich sein Gesicht auf. Das sei ja durchaus vielverheißend.
Mit einem Rollstuhl wurde ich zum Röntgen gefahren: sowohl zur Überprüfung des operierten Ellenbogens als auch im Hinblick auf die weitere Behandlung des gebrochenen Beins: ob konservativ oder operativ? Und wenn Operation, dann die Frage: wann und wie?
Meine Schwester kam mich besuchen. Sie brachte Kuchen und einige Kleider. Sie war erleichtert, dass ich nicht ganz so schlimm aussah, wie sie das befürchtet hatte, zeigte sich sogar angetan von der Klinik, von den großzügigen Zimmern, den modernen Glasfronten und den freundlichen Pflegern. Besser als die meisten Krankenhäuser des NHS, des Nationalen Gesundheitsdienstes in Großbritannien, was keine allzu große Kunst ist. Sie half mir in einen Rollstuhl und fuhr mich auf eine Terrasse. Von dort aus eröffnete sich uns ein spektakulärer Blick auf die Stadt, auf den Fluss, auf einige Weinberge und auf die altehrwürdige Karlsburg. Ich machte Fotos. Sie wirkten auf mich wie die Ansichten einer Urlaubsreise.
Später brachte die Polizei mein gesamtes im Auto verteiltes Gepäck. Nebst Fahrzeugpapieren und einem Bericht des Unfallsachverständigen. Zu hohe Geschwindigkeit. Gutachterlich nach allen Regeln der Kunst beschieden. Ich unterschrieb zahlreiche Formulare, meldete den Unfall telefonisch bei meinen Versicherungen …
Ich schlief. Träumte noch den Satz: Man könne ja nicht damit anfangen, die Orte einer ganzen Region für ein paar wenige Touristen umzubenennen. Immer noch ging es um das Thema Ingen …
Mit einem Windstoß öffnete sich die Tür. Eine Pflegerin setzte mich in einen hereingefahrenen Rollstuhl und legte sämtliche zu mir gehörenden Infusionsflaschen auf meinen Schoß. Mein schlafender Mitpatient wurde ebenfalls geweckt und schneller als sonst in seinen Rollstuhl gehievt. Gemeinsam wurden wir auf den Flur geschoben. Dort befand sich bereits eine ziemliche Ansammlung von Patienten: in Rollstühlen oder auf Krücken Richtung Aufzug humpelnd, von den Pflegern und einem herbeieilenden Arzt geradezu angetrieben, mit der Bitte um Beeilung. Ein Feueralarm oder sonstiger Alarm? Niemand hatte eine Ahnung. Ein gewaltiger Aufzug, in den wir geschoben wurden. Man hätte ein Auto in ihm transportieren können. Auf der Anzeige sah man die Stockwerke (OP, Handchirurgie, Intensiv), an denen wir vorbeifuhren. Die Tür öffnete sich und wir waren auf dem Dach des Klinikums. Wieder der spektakuläre Blick. Etwa dreißig bis vierzig Patienten hatten sich dort versammelt, stehend oder in Rollstühlen sitzend, begleitet von Pflegerinnen und Pflegern. Noch immer dachte ich an einen Feueralarm. Doch von einem Feuer war nichts zu sehen. Auch nirgendwo ein Feuerwehrwagen. Dafür zwei Polizisten, die uns gegenüberstanden, sowie eine Blaskapelle, flankiert von einer Reihe von Offiziellen, offenbar nicht zur Klinik gehörend. In ihrer Mitte stand ein Mann, ein wenig größer als die anderen. Er trug eine Mischung aus Regen- und Försterjacke und hielt ein Megafon in der Hand. Man schien ihn zu kennen oder wiederzuerkennen. Ein Patient neben mir richtete sich trotz Schmerzen unmerklich auf. Als würde er Haltung annehmen oder sich von innen aufpumpen. Das ist … Wer auch immer. Anscheinend der Oberbürgermeister der hiesigen Stadt, sagte eine bandagierte Frau. Offenbar handelte es sich um einen offiziellen Besuch oder um einen Empfang. Diejenigen unter uns, die noch stehen konnten, standen feierlich. Man sah sogar ein Fernsehteam.
Der Oberbürgermeister begann zu sprechen. Hinter mir hörte ich einen Namen: Thorwald Burger. Ich hörte den Namen zwischen Rollstühlen und aufgestützten Patienten: geflüstert, gesprochen oder geseufzt. Das ist Thorwald Burger, der Oberbürgermeister. Er sprach bereits: anlässlich der feierlichen Eröffnung einer neuen Aufzugsanlage, jener Aufzüge, mit denen wir soeben nach oben gefahren worden waren. Mit einer einzigen Unterschrift habe er all das veranlasst und werde noch Weiteres veranlassen, die Klinik in den nächsten Jahren kontinuierlich erneuern und vergrößern, sie zu einem Leuchtturm ausbauen der modernsten und allermodernsten Medizin …
All die Patienten, die mit ihren Verbänden, Drainagen, Fixateuren und Infusionsflaschen auf dem Klinikdach aufgereiht standen, oder in Rollstühlen saßen; sie vermittelten den Besuchern wohl einen Eindruck von den vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der Klinik. Ein herbeigerufener Arzt bestätigte das. Und zugleich verdeutlichte unsere Anwesenheit auch, wie viele Patienten man in kürzester Zeit mit der neuen Aufzugsanlage auf das Dach der Klinik transportieren konnte: an die vierzig Patienten in nur fünf Minuten. Doch dies nur nebenbei. Schon nach wenigen Sätzen nutzte der Bürgermeister seine Anwesenheit zur Verkündung ganz anderer, viel weitreichenderer Vorhaben: seien es nun neue Landeplätze für Rettungshubschrauber oder neuartige Solaranlagen oder geradezu futuristische Operationssäle … Und er sprach schon gar nicht mehr nur über die Klinik, sondern über die Stadt Karlsberg ganz allgemein: eine offenbar in jeder Hinsicht vorbildliche und gelungene Stadt, altehrwürdig und zugleich bahnbrechend neu. Er ging nun auf und ab und listete die Neuerungen auf: neuartige Busse, neue Stadtviertel, neue Energiequellen, ein schwimmendes Studentenwohnheim oder eine spektakuläre Fahrradbrücke, die sich mehr als hundert Meter hoch über das Tal spannte. Ihre letzten Ausläufer waren vom Klinikdach aus noch zu sehen.
Die Offiziellen an seiner Seite schauten und nickten, obgleich die ersten Patienten bereits sichtbar gekrümmt standen. Ein Arzt gab dem Oberbürgermeister ein Zeichen, dass einige der Patienten tatsächlich ein wenig müde seien. Er erklärte ihm: Wir seien alle Verunfallte. Überwiegend Auto- und Motorradunfälle. Zum Teil erst vor wenigen Tagen operiert worden. Daher noch etwas wackelig auf den Beinen. Er möge das bitte berücksichtigen.
Bitte berücksichtigen.
Ich sah mich – in Zeitlupe – in meinem sich überschlagenden Wagen sitzen. Die Airbags öffneten sich, einer nach dem anderen, und ich hörte die Schläge, immer weitere Schläge, wie Hammerschläge oder unerbittliche Ratschläge, die mit jedem Überschlag das Auto ein wenig mehr zertrümmerten, bis es irgendwann auf dem Dach zum Liegen kam.
Ich schloss die Augen.
Und hatte immer noch Schmerzen.
Motorrad- und Autounfälle.
Der Oberbürgermeister betonte diese beiden Wörter. Wie ein Apropos. Motorrad- und Autounfälle. Als hätte er diese Wörter längst erwartet. Er räusperte sich. Aus dem Stegreif präsentierte er nun Unfallstatistiken …
Während ich immer noch in dem zertrümmerten Wagen lag und sich in mir all die Schläge ausbreiteten, die auf mich und das Auto eingegangen waren. Und dieser Schlag und jener Schlag und noch ein Schlag …
Und der Oberbürgermeister weiterhin Unfallstatistiken präsentierte (Unfallzahlen, Zugangszahlen, Fallzahlen, Genesungszahlen), und nicht nur Unfallstatistiken, sondern bei dieser Gelegenheit auch einige ganz allgemeine Zahlen, insbesondere Verkehrszahlen. Wie ein Lehrer an einer Tafel verdeutlichte er die Kosten von all dem: Unfallkosten, Heilbehandlungskosten, Pflegekosten und sonstige Kosten …
Ob das wirklich nötig sei.
So hörte sich das an.
Ob das wirklich nötig sei.
Manche auf Krücken gestützte Patienten begannen zu wanken. Wie Schiffe auf hoher See. Die Rede des Oberbürgermeisters ging jetzt schon über zehn Minuten. Vorsichtiger fahren, umsichtiger fahren oder noch besser überhaupt nicht mehr fahren. Er präsentierte Busfahrpläne. Gefolgt von weiteren Verkehrsstatistiken. Und einigen philosophischen Bemerkungen zu den Worten Zufall und Unfall. Unfall nicht gleich Zufall. Zufall nicht gleich Unfall …
Während ich noch einige letzte dumpfe Schläge spürte, wie Nachschläge oder beiläufige Nackenschläge, bis sich das endlos lang sich überschlagende Auto endgültig beruhigt hatte.
Ein Arzt – offenbar ein Oberarzt – gab dem Oberbürgermeister jetzt zu verstehen, dass es genug sei: an Zahlen, Formeln und Statistiken. Dies sei eine Klinik und kein Verkehrsseminar. Doch der Oberbürgermeister hörte das kaum. Er schien nun im Innersten seiner Gedanken, sprach von Nahverkehrstaktungen. Als wäre das ein Ausweg. Nahverkehrstaktungen. Seine Stimme klang in diesem Moment ungewöhnlich leise, fast mit einer gewissen Anteilnahme, wie ein Klinikseelsorger, um dann plötzlich wieder geradezu aufbrausend eine weitere Zahlenfolge zu zitieren …
Der Oberarzt machte nun ein sehr deutliches Zeichen zur sofortigen Beendigung der Veranstaltung. Es reicht! Anscheinend waren wir entgegen seinem dringenden Rat auf das Dach der Klinik gebracht worden. Es ist jetzt wirklich genug!