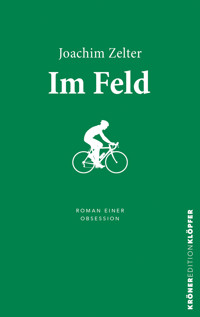14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfred Kröner Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Klöpfer
- Sprache: Deutsch
Wie sind wir geworden, der wir sind? Oder: Wie sind wir nicht geworden, der wir sind – oder gerne sein wollten? Joachim Zelters autofiktionaler Roman beschreibt Lebenswege, Abwege und Notausgänge. Er erzählt vom Werden und vom Gewordensein, von Müttern, Vätern und Kindern, von Heiratsanträgen, Höhenflügen, Niederlagen, Seitensprüngen, Lebenslügen, Lebenssprüngen. Er erinnert, erfindet und ordnet neu. Er erzählt wie noch nie. Er schreibt wie um sein Leben. Der Versuch eines Lebenslaufs – oder auch Staffellaufs. Ein wahrlich existentieller Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u.a. Der Ministerpräsident (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie Im Feld (2018). Zuletzt: Die Verabschiebung (2021) und Professor Lear (2022). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Preis der LiteraTour Nord. Er ist Mitglied im Deutschen PEN. www.joachim-zelter.de
Joachim Zelter
STAFFELLAUF
ROMAN
KRÖNER EDITION KLÖPFER
Joachim Zelter
Staffellauf
Roman
1. Auflage
in der KrönerEditionKlöpfer
Stuttgart, Kröner 2024
ISBN DRUCK: 978-3-520-76609-0
ISBN DRUCK: 978-3-520-76699-1
Umschlaggestaltung Denis Krnjaić
unter Verwendung von Koloman Moser, Villa Schüler, um 1910.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© 2024 Alfred Kröner Verlag Stuttgart • Alle Rechte vorbehalten E-Book-Konvertierung: Zeilenwert GmbH Rudolstadt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorbemerkung
I
II
Dank
Du kannst den Teufel aus deinem Garten vertreiben, doch im Garten deines Sohnes findest du ihn wieder.
Johann Heinrich Pestalozzi
Vorbemerkung
Am Ende schreibt ein Autor in all seinen Büchern immer an demselben Buch. Dieses Buch ist ein solches. Es handelt sich um eine Art Lebenslauf (oder eben Staffellauf) anhand von Erinnerungen und Büchern: seien es nun frühere Bücher oder Bücher, die noch gar nicht geschrieben worden sind. Folgende Werke sind hier eingegangen: Die Würde des Lügens (2000), Die Lieb-Haberin (2002), Das Gesicht (2003), Schule der Arbeitslosen (2006), How are you, Mister Angst? (2008), untertan (2012), Im Feld (2018), Die Verabschiebung (2021), Professor Lear (2022) sowie die noch unveröffentlichten Texte Opus Eroticum, Mein Vermögen und die Notizen über das Schreiben.
I
Hin und wieder kamen Besucher in ihr Atelier. Sie lebte davon. Manchmal freute sie sich sogar darüber. Es hatte geklopft, sie hatte Herein gerufen, und er war eingetreten. So wie andere Besucher auch. Er trug einen Anzug und hatte eine Zeitung bei sich. Ihre Schlagzeilen kreisten um den Bau der Berliner Mauer. Es ging um weitere Grenzsicherungsmaßnahmen und um die neuesten Fluchtversuche. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Dieser Satz klang ihr noch im Ohr. Doch all das war weit weg. Die Mauer stand am anderen Ende des Landes. Ihr Atelier dagegen war zeitlos schön – hell und weiß. In einer Ecke befanden sich eine Kochplatte und einige wenige Teller. Mehr Haushalt gab es nicht. Ansonsten drehte sich alles um die Kunst.
Er habe sich bei verschiedenen Stellen nach erfolgversprechenden Nachwuchskünstlern erkundigt, und ihr Name sei dabei wiederholt gefallen.
Mein Name?
Jawohl.
Man habe ihm mitgeteilt, dass da eine Malerin an der Akademie sei, jung, vielverheißend, begabt, die schon an einigen Ausstellungen beteiligt gewesen sei. Das habe ihn neugierig gemacht.
Er legte die Zeitung auf einen Tisch und begann mit einem Rundgang durch ihr Atelier, ging von Bild zu Bild, beugte sich hin und wieder nach vorne, musterte Rahmen und Farben, dann ging er weiter zum nächsten Bild. Er lobte in den allgemeinsten Formulierungen, gebrauchte Wörter wie apart, anmutig oder kraftvoll. Sie wusste kaum etwas damit anzufangen, doch womöglich wollte er tatsächlich eines ihrer Bilder kaufen. Mit welchen Worten auch immer. Sie war eine der wenigen Studenten an der Akademie, die bereits Bilder verkauft hatten – und das machte ihr Mut, und den anderen Studenten auch. Er belobigte das eine oder andere Bild. Dieses erinnere an Chagall, jenes an Picasso. Er schien sich auszukennen, obgleich die Bilder nicht im Geringsten etwas mit Chagall oder Picasso gemein hatten. Doch sie beließ ihn in seiner Einschätzung. Er erwähnte auch einige andere, weniger bekannte Maler, die er (oder seine Familie) persönlich kannte. Und das schien ihm wichtig, dass er Maler persönlich kannte. Offenbar hatte er eine Schwäche für die Kunst. Obwohl er in seinem steifarmigen Anzug kaum so aussah. Eher wie das Gegenteil aller Kunst. Er wirkte unbeholfen, und sie auch, während er unendlich langsam von Bild zu Bild ging, so, als würde dieser Nachmittag nie zu Ende gehen.
Als er schließlich gegangen war, hatte er kein Bild gekauft. Es gab noch nicht einmal eines, das ihm besonders gefallen hätte. Sie hatten ihm alle auf die eine oder andere Art irgendwie gefallen. Aber auch nicht mehr. Er hatte ihr überwiegend technische Fragen gestellt: welche Farben, welche Grundierungen, welches Material? Auch hatte er wissen wollen, welcher Malschule sie angehöre oder welcher Stilrichtung. Darauf hatte sie keine Antwort. Eigentlich war ihr das egal. Sie malte Bilder. Nur das war ihr wichtig.
Um ihn zufriedenzustellen, hatte sie geantwortet: Klassische Moderne. Ihre Arbeiten tendierten zur Klassischen Moderne. Das klang überzeugend. Er behandelte es wie eine bombastische Wahrheit: Klassische Moderne. Als könnte er dies bei nächster Gelegenheit feierlich verkünden: Ich kenne eine Malerin. Sie ist eine Vertreterin der Klassischen Moderne.
Als er sie das nächste Mal aufsuchte, war von Bildern kaum mehr die Rede. Er stand nun einfach in ihrem Atelier. Ohne einen direkten Grund. Sie machte Andeutungen, dass sie noch den ganzen Nachmittag malen werde, eine Auftragsarbeit, die sie dringend fertigstellen müsse, was ihn nicht störte. Also malte sie trotz seiner Anwesenheit weiter. Er stand eine Ewigkeit, wie ein Ausstellungsbesucher. Oder selbst wie eine Art Ausstellungsstück.
Später saß er in ihrem Sessel und holte aus seiner Aktentasche eine Zeitung hervor. Er las sie von der ersten bis zur letzten Seite, von den politischen Schlagzeilen bis zu den Todesanzeigen. Seine Augen bewegten sich in den Linien eines Rasenmähers, der einen endlosen Rasen mäht, von links nach rechts, hoch und wieder runter, bis irgendwann jeder einzelne Grashalm geschnitten ist. Nachdem er die Zeitung gelesen hatte, steckte er sie wieder in die Aktentasche und zog einige Schreibmaschinenseiten hervor. Dass er hin und wieder literarische Werke verfasse, erklärte er.
Literarische Werke?
Ja.
Ob sie sich womöglich dafür interessiere.
Nein, sie interessierte sich eigentlich nicht.
Er hielt bereits die ersten Blätter in der Hand.
Sie schaute weg.
Er las einige Sätze, mehr für sich selbst als für sie, doch dann immer offener und lauter. Er deutete ihr Schweigen als Zustimmung. Seine Stimme war nun im ganzen Atelier zu vernehmen. Sie hörte kaum zu. Die Sätze klangen gewunden und bemüht. Wie ein nicht enden wollender Zeitungsartikel. Irgendwann war er fertig damit und fragte: Und?
Und was?
Wie hat Ihnen mein Essay gefallen?
Es handelte sich offenbar um einen Essay.
Sie war ratlos.
Ihre Freundin Pia kam herein. Genau im richtigen Moment. Auch sie studierte an der Akademie. Sie wunderte sich über den seltsamen Besucher. Er saß mit seinen Blättern auf dem Schoß in dem Sessel und wirkte auf sie wie ein Versicherungsvertreter. Bernadette wusste nicht, wie sie ihn vorstellen sollte. Sie stellte ihn als einen Interessenten ihrer Arbeiten vor.
Er erhob sich.
Karl Staffelstein.
Mit einer leichten Verbeugung hatte er seinen Namen gesprochen. Bernadette stand an der Staffelei und malte, während Pia sich nun mit dem Gast unterhielt. Die beiden sprachen lebhafter, als sie sich mit ihm bislang unterhalten hatte. Eine Weile sprachen sie über die Kunst, dann über andere Dinge: über das Wetter, über die Politik und über seinen Beruf. Er arbeitete als Referendar am Verwaltungsgericht. Pia fand das interessant. Sie stellte ihm allerlei Fragen. Er sprach mit ihr sogar einige Worte Französisch, da man bei Gericht hin und wieder auch mit französischen Anwälten und Richtern zu tun hatte. Das beeindruckte sie.
Als er gegangen war, da war er für Pia weniger ein Interessent an Bernadettes Bildern als vielmehr ein Interessent an ihrer Freundin. Bernadette nahm das nicht ernst.
Die beiden öffneten eine Flasche Wein. Als wollten sie alle weiteren Gedanken an Männer vertreiben. Manchmal tranken sie auch zur Feier eines verkauften Bildes. Dann saßen sie stundenlang zusammen: feiernd, essend oder malend. Nichts und niemand konnte sie aus dem Takt bringen. Ihre Ateliers lagen nebeneinander. Dort übernachteten sie auch, entweder auf einem Sofa oder auf einer Matratze. Im Sommer stiegen sie nachmittags auf ihre Räder und fuhren bis nach Breisach zum Rhein. Sie schwammen in einem See oder in einem Seitenarm des Flusses. Dann sonnten sie sich. Oder fuhren mit ihren Rädern weiter und immer weiter, den Rhein aufwärts, bis nach Basel, wo Pias Eltern lebten. Sie wohnten in einem Haus direkt am Rhein, mit eigenem Steg und Blick aufs Münster. Dort übernachteten sie. Vor dem Abendessen oder vor dem Frühstück schwammen sie noch. Der Fluss trug sie kilometerweit, bis zu den letzten Häusern der Stadt. Es waren Bernadettes erste Auslandsreisen: nur mit einem Badeanzug und einem Fahrrad.
Die beiden zählten ihre jeweiligen Besucher, wer wen wie oft in ihrem Atelier besuchen kam. Meist ging es dabei um Bilder. Wer verkaufte wie viele Bilder. Doch manchmal ging es nicht nur um Bilder, sondern tatsächlich auch um die Besucher. Pia und Bernadette kochten dann ein Essen. Sie knieten vor ihren provisorischen Kochplatten und rührten eine Suppe an oder ein anderes notdürftiges Gericht. An den Tellerrändern sah man noch die Spuren von Ölfarben. Manche Besucher schienen darüber belustigt, andere waren entsetzt. Je entsetzter ein Gast, desto mehr kosteten die beiden dieses Entsetzen aus, schoben mit den Füßen das gebrauchte Geschirr unter einen Schrank, warfen Essensreste aus dem Fenster oder spülten Töpfe in einer ausrangierten Waschmaschine. Jeden, den sie damit vertreiben konnten – er war für sie ein Triumph.
Karl Staffelstein kam nun regelmäßig. Trotz verrosteter Kochplatten und nichtgespültem Geschirr. Wenn Pia in Bernadettes Atelier kam, dann saß er in seinem Anzug im Sessel. Manchmal hatte er seine Blätter dabei und las wieder etwas vor. Oder er saß einfach nur da. Das Verwaltungsgericht lag ganz in der Nähe. Als wäre das bereits ein zwingender Grund, hier zu sein. Das Essen in der Kantine sei unsäglich schlecht, so ihr Gast, also verbrachte er die Mittagspause lieber in Bernadettes Atelier. Irgendwann hatte er die Kochplatte auf dem Boden entdeckt und sie gefragt, ob das eine Kochplatte sei.
Ja.
Ob sie darauf koche.
Gelegentlich.
Was das heiße.
Wenn sie Hunger habe.
Und wann habe sie Hunger?
Selten.
Ob sie denn nicht zu Mittag esse.
Sie verneinte.
Er fand das kolossal, nicht zu Mittag zu essen.
Für sie war das völlig normal.
Sie wollte ihre Zeit lieber mit dem Malen verbringen.
Sie hörte seine Sätze kaum, war ganz in ihre Arbeit versunken. Wenn sie malte, sah sie sich als einsames Schiff, das sämtliche Segel setzt und jeden sich bietenden Wind nutzt, bis ein Bild irgendwann abgeschlossen war.
Aus dem Augenwinkel sah sie Kierkegaards Tagebuch des Verführers. Es stand in einem Bücherregal ganz in ihrer Nähe. Ihr Blick klammerte sich an dieses Buch, ihr Lieblingsbuch, in dem sie letzte Nacht wieder gelesen hatte – während ihr Gast in einer weiteren Zeitung blätterte. Zürnen Sie nicht, gnädiges Fräulein, eine Ähnlichkeit zwischen Ihren Zügen und einem Wesen, das ich von ganzem Herzen liebe, das aber fern von mir lebt, ist so auffallend, dass Sie mir mein sonderbares Betragen verzeihen werden. Diesen Satz hatte sie nachts in dem Buch gelesen. Sie hatte ihn sogar dick angestrichen und sich an seiner Schönheit erfreut. Auch wenn sie kein Wort davon glaubte.
Ihr Gast saß immer noch da.
Jetzt die Todesanzeigen studierend.
Irgendwann hatte sie dann doch Hunger und kochte eine Suppe. Ihm schmeckte diese Suppe ausgesprochen gut. Besser als die Suppen in der Kantine. Er bat sogar um einen Nachschlag.
Während sie miteinander aßen, fragte sie ihn, wo er wohne. Eine andere Frage fiel ihr nicht ein, und sie wusste ansonsten nicht, was sie hätte sagen oder ihn fragen sollen. Also fragte sie: Wo wohnen Sie eigentlich? Das Wort eigentlich war unhöflich, doch das war ihr egal. Sturzbachartig fing er zu erzählen an, vielleicht auch deshalb, weil dies die erste Frage gewesen war, die sie in all den Wochen überhaupt an ihn gerichtet hatte. Darüber freute er sich. Vielleicht erzählte er aber auch deshalb so ausführlich, weil er ihr ohnehin bei nächster Gelegenheit berichten wollte, wo genau er wohnte: in einem Haus, gelegen an den letzten Ausläufern des Schwarzwaldes, hoch über der Stadt, mit einem weiten Blick in die Rheinebene, bis zu den Vogesen, entworfen von einem berühmten Architekten, gebaut vor nur wenigen Jahren, die Fassaden in einer goldgelben Farbe, mehr zitronenals goldgelb, wie in Andalusien oder Italien, mit einem gewaltigen Panoramafenster, um den Ausblick vom Wohnzimmer aus den ganzen Tag genießen zu können.
Noch nie hatte er so lange und ausführlich gesprochen. Gerne würde er ihr das Haus einmal zeigen … Vielleicht irgendwann in den Abendstunden, wenn seine Eltern außer Haus seien.
Außer Haus seien.
Als Bernadette das Gebäude sah, konnte sie sich vage daran erinnern, es schon einmal gesehen zu haben, sei es nun in der Zeitung oder auf einem Spaziergang, als sie sich gefragt hatte, welche Menschen wohl in einem solchen Haus leben könnten. Jetzt führte er sie dort hinein, mit einem Flüsterton, als wäre er ein Fremder oder ein Einbrecher, bat sie, die Schuhe auszuziehen und die Perserteppiche nicht zu betreten, führte sie ins Wohnzimmer und deutete zuallererst feierlich auf das Gemälde über dem Sofa: Das ist er.
Wer?
Der berühmte Vorfahre.
Vorfahre?
Sein Urururgroßvater.
Ja?
Ein Studienfreund Schillers.
Studienfreund Schillers?
In der Tat.
Dass sein Vorfahre es gewesen war, Georg Jakob Staffelstein, der den weltberühmten Dichter zum Freund gehabt hatte.
Zum Freund?
Jawohl.
Die ganze Familie war stolz darauf.
Bis zum heutigen Tag.
Als Bernadette wieder in ihrem Atelier war, musste sie über all das lachen. Karl Staffelstein aber saß schon in der nächsten Mittagspause wieder bei ihr und fragte, wie ihr das Haus gefallen habe. Als handele es sich dabei um eine Erzählung oder einen Roman. Sie wusste kaum etwas zu sagen, außer sich beeindruckt zu zeigen von dem nächtlichen Meer an Lichtern, das von der nächstgelegenen Straßenlaterne vor dem Haus weit über die Stadt hinaus bis zu den Gebirgszügen der Vogesen reichte.
Immerhin das.
Wenn Pia in Bernadettes Atelier kam und Karl Staffelstein in dem Sessel sitzen sah, wie festgezurrt, dann zog sie sich wieder zurück, um nicht zu stören – dabei störte sie gar nicht. Im Gegenteil. Bitte bleib! Pia konnte sich mit ihm viel flüssiger unterhalten als sie selbst. Sie sprachen über Immobilienpreise und über Schweizer Schokolade. Bernadette dagegen wusste nicht, worüber sie überhaupt mit ihm sprechen könnte. Wenn sie nicht an der Staffelei gestanden und in einem fort gemalt hätte, wäre dieser Umstand allzu offensichtlich gewesen.
So aber wirkte die Szenerie fast anmutig. Als wäre ihr ein Hund zugelaufen. Pias Worte. Manchmal blieb sie ein oder zwei Stunden an Bernadettes Seite. Die anderen Studenten an der Akademie aber begannen immer mehr, das Atelier zu meiden. Als hätte sich ihr Dauergast bereits herumgesprochen und als wollte man nicht stören. Am liebsten hätte sie die Tür aufgerissen und gerufen: Ihr stört doch nicht!
Nicht einmal Aaron störte mehr. Schon seit Wochen kam er nicht mehr zu ihr. Wenn sie an ihn dachte, dann musste sie einräumen, dass seine Arbeiten ihr mit Abstand am besten gefielen. Vielleicht war es auch umgekehrt so. Manche der Studenten sagten: Wenn es jemand an dieser Akademie schaffen könnte, dann er – gefolgt von ihr. Oder: Wenn zwei Menschen irgendwie zusammengehören, dann die beiden. Wenigstens als Künstler. Sobald er in ein Atelier trat, hörte man auf zu malen. Man stand für seine Beurteilungen bereit, nicht nur wegen seiner ungewöhnlichen Bilder, sondern aufgrund seiner Bereitschaft, über die Bilder anderer überhaupt zu sprechen. Er sprach ohne Umschweife. Manchmal zuckte sie ob der Härte seiner Urteile zusammen. Er urteilte, bis nichts mehr von einem Bild übrig war, sprach von gekünstelt, bemüht, gekrümmt, verkrampft, getüncht, gestreckt, gepanscht, gequält, verfehlt …
Über seine eigenen Bilder urteilte er nicht anders als über die Bilder anderer. Schonungslos. Sie wusste nicht, ob er seine Bilder nur deshalb kritisierte, um dann die Arbeiten anderer umso heftiger angehen zu können. Oder ob es umgekehrt war. Er war gnadenlos offen: egal ob es sich um das Bild eines namenlosen Malers oder um ein Picasso-Gemälde handelte. Er machte keine Unterschiede. Und das gefiel ihr.
Manche Menschen werden zu Tode gelobt. Das war sein Leitsatz. Wenn jemand eine Arbeit von ihm zu sehr lobte, dann freute er sich nicht darüber, sondern sprach diesen Satz. Er sprach ihn wie eine Warnung. Jedes falsche Lob war für ihn ein weiterer Meter eines lebenslangen Irrwegs.
Zu Tode gelobt.
Oder zu Tode kritisiert.
Darüber stritten sie.
Nächtelang.
Als ginge es um Leben und Tod.
Sie: Man kann niemanden zu Tode loben. Wie soll das gehen? Vielmehr kann man jemanden zu Tode betrüben oder zu Tode kritisieren. Bis nichts mehr von ihm übrig ist. Kein Hauch von Leben mehr.
Er fand das nicht.
Sie fand das schon.
Sie: Woher er seine Gewissheiten beziehe.
Er: Aus der Kunst. Aus jedem einzelnen Bild.
Sie: Es gibt keine Gewissheiten. Es gibt keine Wahrheiten. Schon gar nicht in der Malerei. Es gibt nur das Für und Wider von Entscheidungen …
Er: Natürlich gibt es Gewissheiten und erst recht Wahrheiten. In der Kunst mehr als irgendwo sonst. Die Kunst ist eine Ausnahme und keine Regel. Sie ist ein ständiges Scheitern. Nur in ganz wenigen Momenten ist die Kunst tatsächlich Kunst. Und diese Momente gilt es auszusprechen.
Manchmal lobte er aber auch. Aus dem Nichts. Wie eine plötzliche Umarmung. Über ein Bild von Bernadette hatte er einmal gesagt: Das ist Kunst!
Daran musste sie denken, während Karl Staffelstein immer noch in ihrem Sessel saß. Ein Wartender in einem Bahnhof. So saß er da. In einer stoischen Unverrückbarkeit. Manchmal wirkte der Anblick so befremdlich, dass sie kurz davor war, ihn zu fragen: Was machen Sie eigentlich hier?
Man hatte sie gewarnt. All die Studentinnen, die abends vor Aarons Tür standen. Es waren weit mehr Studentinnen als Studenten. Sie kamen zu ihm, nicht weil er sie eingeladen hatte, sondern weil sie das so nicht stehenlassen wollten, all die von ihm kritisierten Bilder. Heerscharen von Malerinnen und von verkannten Bildern. Manche Besucherin blieb stundenlang. Er war der einzige Mann, den sie kannte, der niemals Einladungen aussprach und dennoch immer Besuch bekam. Nicht zu Tode gelobt als vielmehr zu immer neuen Besuchen angestachelt. Das war seine Kunst.
Irgendwo hatte sie den Satz gelesen: Der Verführer kennt viele Worte, aber eines ist die Grundlage seines Handelns – Geist, Geist und nochmals Geist, nicht der akademische Geist (der ist so träge, dass er schon wieder Körper ist), sondern der Witz, die Schlag fertigkeit, die Kunst der Rede, vor allem aber Offenheit. Nicht Anbetung, nicht Schmeichelei, sondern schonungslose Offenheit. Erster Hauptsatz der Verführung.
Die Kunst der Verführung, nicht Belagerung, sondern Verführung. Sie bedachte diesen Unterschied Tag und Nacht.
Sie malte. Obgleich sie den Eindruck gewann, dass ihr die neueren Arbeiten zunehmend misslangen. Doch sie malte weiter. Unentwegt. Wenn ein Bild abgeschlossen war, dann erhob sich ihr Dauergast umständlich und ging zur Staffelei, um sich das Bild anzuschauen. Dann sagte er so etwas Ähnliches wie: so, so. Oder: aha. Lobte in vagen Formulierungen und setzte sich wieder. Als wäre das nun geschafft.
Sie mied ihr Atelier jetzt, malte oder zeichnete an anderen Orten, suchte nach einem besseren Licht, hoffte darauf, dass Karl Staffelstein irgendwann die Lust verlieren würde, fast täglich vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Sobald sie sich das vorstellte, tat er ihr wiederum leid. Sie dachte an Pias Wort von dem zugelaufenen Hund. Wenn sie dann doch irgendwann wieder ins Atelier zurückkehrte, und sei es nur, um eine Farbtube zu holen, stand er bereits an der Tür. Als wäre ihre Abwesenheit nicht der Rede wert gewesen und alles in bester Ordnung.
Sie kochte dann ein Mittagessen und sie aßen. Dann malte sie wieder. Was immer ein Mensch wie Aaron dazu auch sagen würde. Ich male! Warum immer er sich auch in besonderer Weise dazu berufen fühlte, ständig über andere Bilder zu urteilen. Wie ein Kleptomane nicht anders kann als Aschenbecher aus Restaurants zu entwenden. Ich urteile. Ich sage. Ich bestimme. Als wäre er eine Art Gott.
Am nächsten Morgen ging sie spazieren. Nur wenige Zentimeter hinter ihr krachte der tonnendicke Ast einer maroden Eiche auf die Straße. Sie hätte auf der Stelle tot sein können. Oder schwerverletzt. Sie erlebte das wie ein Apropos oder Nebenbei. Eine Art Vorwort oder Nachwort. Oder eine letzte Warnung. Für einige Momente glaubte sie sich bereits tot.
Sie ging ins Münster und zündete Kerzen an: für sich, ihre Brüder und ihre verstorbenen Eltern. Sie wollte auch beichten, wusste aber nicht, was sie hätte beichten können oder beichten sollen, außer vielleicht die Werke Søren Kierkegaards.
Als sie abends ins Atelier kam, hatte sie Fieber, das am nächsten Morgen nicht sank, sondern bis zum Mittag auf über vierzig Grad angestiegen war. Zum ersten Mal saß Karl nicht in seinem Sessel, sondern ging im Atelier auf und ab, wie auf einem Bahnsteig. Er wollte einen Arzt rufen.
Ihre Antwort: Es geht auch ohne Arzt.
Sie konnte ihn davon überzeugen, dass sie allein sein wollte.
Wirklich?
Ja.
Als könnte er das kaum glauben.
Irgendwann ging er. Sie lag in einer Art Delirium und träumte. Dass die Malklasse kommen und sich ihre neuesten Bilder anschauen würde und fassungslos wäre: über den Niedergang. Nicht nur über ihren Niedergang, sondern auch über ihre Selbsttäuschung. Wie man sich nur so sehr über sich selbst täuschen könne. Über sich selbst und über die eigenen Bilder. Ihre Arbeiten nichts anderes als überblähte Selbsttäuschungen. Wahngebilde. Hörte sie die Malklasse sagen. In immer neuen Worten. Und die Frage: Was ist passiert? Was nur ist mit ihr passiert? Als wäre sie verunglückt. Oder würde soeben aus einem Koma erwachen. Und inmitten der allgemeinen Ratlosigkeit, als wollte man sie oder ihre neuesten Arbeiten noch einmal neu erklären, hörte sie den Satz von Oscar Wilde, dass ein Künstler niemals von seinem Podest steigen dürfe. Nicht einmal andeutungsweise. Man darf sich von seiner Konzentration, seiner Hingabe und seinem innersten Wesen niemals abbringen lassen. Von keinem Menschen der Welt. Nicht einmal von sich selbst.
So träumte oder sprach sie. Man hörte es im ganzen Zimmer. Ich bin allein, das Kunstwerk ist allein, der Betrachter des Kunstwerks ist allein. Wir alle sind allein. Doch in manchen Momenten finden wir zusammen