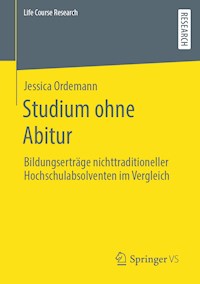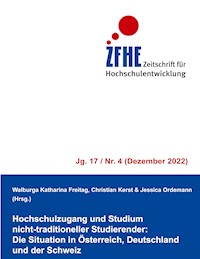
Hochschulzugang und Studium nicht-traditioneller Studierender: Die Situation in Österreich, Deutschland und der Schweiz E-Book
Jessica Ordemann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Zeitschrift für Hochschulentwicklung Jg. 17
- Sprache: Deutsch
Die strukturelle Durchlässigkeit in ein Hochschulstudium und Schaffung von Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen sind wichtige Ziele des Europäischen Hochschulraums. In den D-A-C-H-Ländern sind sowohl Absolvent:innen der beruflichen Bildung ohne Matura/Abitur als auch Erwerbs- und Familientätige sowie "learners in later life" wichtige Zielgruppen des Konstrukts "nicht-traditionelle Studierende". Aus diversitäts- und ungleichheitstheoretischen Perspektiven untersuchen die Beiträge - auf Grundlage aktueller Daten - Regelungen des Hochschulzugangs, das Zeitbudget Studierender, die Effekte von Pflegeverantwortung sowie den Studienabbruch, u. a. während der Covid-19-Pandemie. Thematisiert werden ein Lernort auf See ebenso wie neue Wege in ein Studium zum Lehramt an beruflichen Schulen. Die Beiträge repräsentieren Tiefenbohrungen auf nach wie vor kleinem Terrain.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Editorial: Hochschulzugang und Studium nicht-traditioneller Studierender – Die Situation in Österreich, Deutschland und der Schweiz
Walburga Katharina Freitag, Christian Kerst & Jessica Ordemann
Studieren ohne Matura: Der dritte Bildungsweg an Österreichs Hochschulen
Magdalena Fellner
Der dritte Bildungsweg an Schweizer Fachhochschulen. Eine Bestandsaufnahme
Nathalie Graber
Evaluation des Modellversuchs zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte in Hessen
Annika Greinert, Larissa Weber, Jan Hense & Joachim Stiensmeier-Pelster
Studium ohne Abitur – Bildungsentscheidungen und biografische Übergänge
Frank Kotterer, Andrea Broens, Juhyeok Lee, Sylke Bartmann, Detlef Garz & Olaf Zawacki-Richter
Warum brechen nicht-traditionelle Studierende häufiger ihr Studium ab? Eine Dekompositionsanalyse
Gunther Dahm
Abbruchgründe nicht-traditioneller Studierender – Identifikation von Clustern mittels Data Mining
Lisa Herrmann
Besonders belastet und kurz vor dem Abbruch? Nicht-traditionelle Studierende zu Beginn der COVID-19-Pandemie
Karsten Becker & Tobias Brändle
Unterschiede im Zeitbudget von Studierenden mit nicht-traditionellen und traditionellen Hochschulzugängen
Bianca Thaler, Judith Engleder & Martin Unger
Vergleichende Untersuchung von „nicht-traditionellen“ Studierenden auf See und an Land
Nicolas Nause
Invisible caregivers: The ‘hidden lives’ of German university students with care responsibilities
Karla Wazinski, Lea Knopf, Anna Wanka & Moritz Heß
Senior:innenstudierende als nicht-traditionelle Zielgruppe der Hochschulbildung
Annika Felix, Birgit Schneider & Tobias Schmohl
Übergänge stärken. Zur Gewinnung beruflich qualifizierter Personengruppen für das Studium zum Lehramt an berufsbildenden Schulen
Laura Kupke, Dietmar Frommberger & Thomas Südbeck
Erfolgreicher Studieneinstieg beruflich Qualifizierter im dualen Studium des technischen Lehramts
Dirk Wohlrabe, Nadine Matthes & Rolf Koerber
Freie Beiträge
Hochschuldidaktische Weiterbildungsangebote in der Lehrerbildung – Ein heterogenes Feld
Marlies Matischek-Jauk, Claudia Stöckl, Cornelia Binder & Elisabeth Amtmann
Vorwort
Als wissenschaftliches Publikationsorgan des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria kommt der Zeitschrift für Hochschulentwicklung besondere Bedeutung zu. Zum einen, weil sie aktuelle Themen der Hochschulentwicklung in den Bereichen Studien und Lehre aufgreift und somit als deutschsprachige, vor allem aber auch österreichische Plattform zum Austausch für Wissenschafter:innen, Praktiker:innen, Hochschulentwickler:innen und Hochschuldidaktiker:innen dient. Zum anderen, weil die ZFHE als Open-Access-Zeitschrift konzipiert und daher für alle Interessierten als elektronische Publikation frei und kostenlos verfügbar ist.
Ca. 3.000 Besucher:innen schauen sich im Monat die Inhalte der Zeitschrift an. Das zeigt die hohe Beliebtheit und Qualität der Zeitschrift sowie auch die große Reichweite im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig hat sich die Zeitschrift mittlerweile einen fixen Platz unter den gern gelesenen deutschsprachigen Wissenschaftspublikationen gesichert.
Dieser Erfolg ist einerseits dem international besetzten Editorial Board sowie den wechselnden Herausgeberinnen und Herausgebern zu verdanken, die mit viel Engagement dafür sorgen, dass jährlich mindestens vier Ausgaben erscheinen. Andererseits gewährleistet das österreichische Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft durch seine kontinuierliche Förderung das langfristige Bestehen der Zeitschrift. Im Wissen, dass es die Zeitschrift ohne diese finanzielle Unterstützung nicht gäbe, möchten wir uns dafür besonders herzlich bedanken.
Zur Ausgabe:
Die strukturelle Durchlässigkeit in ein Hochschulstudium und Schaffung von Rahmenbedingungen für lebenslanges Lernen sind wichtige Ziele des Europäischen Hochschulraums. In den D-A-CH-Ländern sind sowohl Absolvent:innen der beruflichen Bildung ohne Matura/Abitur als auch Erwerbs- und Familientätige sowie „learners in later life“ wichtige Zielgruppen des Konstrukts „nicht-traditionelle Studierende“. Aus diversitäts- und ungleichheitstheoretischen Perspektiven untersuchen die Beiträge – auf Grundlage aktueller Daten – Regelungen des Hochschulzugangs, das Zeitbudget Studierender, die Effekte von Pflegeverantwortung sowie den Studienabbruch, u. a. während der Covid-19-Pandemie. Thematisiert werden ein Lernort auf See ebenso wie neue Wege in ein Studium zum Lehramt an beruflichen Schulen. Die Beiträge repräsentieren Tiefenbohrungen auf nach wie vor kleinem Terrain.
Seit der Ausgabe 9/3 ist die ZFHE auch in gedruckter Form erhältlich und beispielsweise über Amazon beziehbar. Als Verein Forum Neue Medien in der Lehre Austria freuen wir uns, das Thema „Hochschulentwicklung“ durch diese gelungene Ergänzung zur elektronischen Publikation noch breiter in der wissenschaftlichen Community verankern zu können.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen viel Freude bei der Lektüre der vorliegenden Ausgabe!
Martin Ebner und Hans-Peter Steinbacher
Präsidenten des Vereins Forum Neue Medien in der Lehre Austria
Walburga Katharina FREITAG, Christian KERST & Jessica ORDEMANN (Hannover)1
Editorial: Hochschulzugang und Studium nichttraditioneller Studierender – Die Situation in Österreich, Deutschland und der Schweiz
Die Institutionen hochschulischer Bildung sind – nicht zuletzt aufgrund von Anforderungen des Europäischen Hochschulraums – seit vielen Jahren vor die Herausforderung gestellt, die Durchlässigkeit in die Hochschule und das lebenslange Lernen für verschiedene Zielgruppen zu ermöglichen. Zu den Zielgruppen gehören in der Beruflichen Bildung Qualifizierte ebenso wie Erwachsene in verschiedenen Lebensaltern sowie Erwerbs- und Familientätige, die eine Vereinbarkeit mit einem Studium anstreben. Für die Zielgruppe der in der Beruflichen Bildung Qualifizierten spielen Möglichkeiten des Zugangs zu einem Studium, die auf ihren beruflich und informell erworbenen Kompetenzen beruhen, eine Rolle. Diejenigen, die zu einem späteren Zeitpunkt der Biografie an einer Hochschule studieren, möchten oft in zeitlich und räumlich anderer Form studieren, als es Studierende traditionell praktizieren. Für diese Gruppen wird in Anlehnung an den angelsächsischen Begriff der „non-traditional students“ auch im deutschen Sprachraum der Begriff der „nicht-traditionellen Studierenden“ verwendet.
Mit dem Themenheft zielen die Herausgeber:innen darauf ab, Forschungsbeiträge und Werkstattberichte zu veröffentlichen, die sich Fragen des Hochschulzugangs und der Studiensituation von nicht-traditionellen Studieninteressierten in Österreich, Deutschland und der Schweiz („D-A-CH-Länder“) widmen. Die Beiträge thematisieren verschiedene Studierendengruppen sowie verschiedene Dimensionen des Studiums von nicht-traditionellen Studierenden. Im Rahmen dieses Heftes sind
DOI: 10.3217/zfhe-17-04/01 die ersten sieben Beiträge dem Studium ohne Abitur oder Matura gewidmet, das im Call eine zentrale Rolle spielte. Sie verwenden für die Kennzeichnung der Gruppe in Analogie zum ersten und zweiten Bildungsweg teilweise den Begriff des „dritten Bildungswegs“, unter dem die Beiträge hier auch rubriziert werden. Die drei Beiträge zu Beginn der Ausgabe beschäftigen sich mit den Zugangsregelungen zu den Hochschulen in den drei Ländern, gefolgt von einem Beitrag zur biografischen Bedeutung eines erfolgreich absolvierten dritten Bildungswegs sowie wiederum drei Beiträgen zum Studienerfolg und Studienabbruch von Studierenden des dritten Bildungswegs. Die darauffolgenden sechs Beiträge thematisieren nicht-traditionelle Studierende, die biografisch zu einem späteren Zeitpunkt ein Studium aufnehmen, andere Formen des Studierens (z. B. berufsbegleitend) wählen oder durch besondere Lebenssituationen, wie die Pflege Angehöriger, gekennzeichnet sind.
Dritter Bildungsweg: Hochschulzugangsberechtigung für Studieninteressierte ohne Abitur oder Matura
Den D-A-CH-Ländern ist gemeinsam, dass die Studierenden des dritten Bildungswegs eine kleine, um nicht zu sagen marginale Gruppe bilden. Aus diversitäts-, gerechtigkeits- oder ungleichheitstheoretischer Perspektive werden die in den Ländern unterschiedlich geregelten Optionen dennoch als hoch relevant eingeordnet. Nichtsdestotrotz scheint sich die Forschung über die Studierenden des dritten Bildungswegs in der Schweiz und Österreich in einer anderen Phase zu befinden als in Deutschland. Erstmals werden für Österreich die vorhandenen dritten Bildungswege systematisiert, um sie weiterer Forschung zugänglich zu machen. Ähnliches gilt für die Forschungssituation zum dritten Bildungsweg an Schweizer Hochschulen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen sowohl an den Schweizer als auch an den österreichischen Hochschulen gegenwärtig wandeln. Neue Hochschulgesetze wurden erlassen, die in der Schweiz die Möglichkeiten des dritten Bildungswegs in die Fachhochschulen einschränken, in Österreich hingegen den Weg an die Universitäten erweitern. Anzumerken ist, dass die Analyse der rechtlichen Regelungen zum Zugang und der Zulassung zu weiterbildenden bzw. außerordentlichen Studienangeboten ein Desiderat in diesem Themenheft darstellt. In ihrem Beitrag „Studieren ohne Matura: Der dritte Bildungsweg an Österreichs Hochschulen“ argumentiert Magdalena Fellner, dass, obgleich mit Unterzeichnung des London Communiqués im Jahr 2007 eine Repräsentation der Gesamtbevölkerung in der jeweiligen landesspezifischen Zusammensetzung der Studierendenpopulation angestrebt wird, Österreich von diesem Ziel u. a. bei Personen, die aus nicht-akademischen Elternhäusern kommen, noch weit entfernt ist. Frühe Bildungswegentscheidungen, so ein wichtiges Ergebnis bisheriger Forschung, auf die die Autorin hinweist, wirken sich maßgeblich auf die Option, ein Hochschulstudium aufzunehmen, aus. Vor diesem Hintergrund weist Fellner den Möglichkeiten des Hochschulzugangs ohne Abitur, als dritter Bildungsweg bezeichnet, eine kompensatorische Funktion zu. Um eine Grundlage für die entsprechenden Regelungen zu erhalten, nimmt die Autorin erstmalig eine Bestandsaufnahme vorhandener rechtlicher Regelungen des Hochschulzugangs ohne Reifeprüfung für die vier Sektoren des österreichischen Hochschulsystems – Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen sowie Privathochschulen – sowohl für den ordentlichen als auch für den weiterbildenden Studienbereich vor. Auf Grundlage bislang unveröffentlichter Daten der österreichischen Studierenden Sozialerhebung für das Jahr 2019 zeigt Fellner, dass der dritte Bildungsweg bei den Studierenden der „ordentlichen Studien“ mit einen Gesamtanteil von 1 Prozent aller Hochschulzulassungen statistisch von marginaler Bedeutung ist. Da bislang nur der Zugang zum Fachhochschulsektor, den Pädagogischen Hochschulen sowie den Privaten Hochschulen geregelt war, verweist Fellner auf eine im Jahr 2021 neu geschaffene Möglichkeit der Zulassung zu einem ordentlichen Studium an einer Universität. Den Universitäten ist es auf Grundlage des Gesetzes selbst überlassen, Eignungsprüfungen zur Zulassung von Studieninteressierten ohne schulische Reifeprüfung einzuführen. Die von Fellner vorgenommene Auswertung von Daten von STATISTIK AUSTRIA für den überwiegend privat zu finanzierenden weiterbildenden Studienbereich zeigt, dass 28 Prozent der Studierenden in Universitätslehrgängen im Studienjahr 2020 ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung studieren. Die Autorin vertritt die These, dass in diesem Bereich die rechtlichen Möglichkeiten stärker ausgeschöpft wurden.
Im Mittelpunkt des Beitrags von Nathalie Graber, „Der dritte Bildungsweg an Schweizer Fachhochschulen. Eine Bestandsaufnahme“, steht die These, dass aufgrund langwieriger und aufwändiger Anforderungen der Hochschulzulassung auf dem dritten Bildungsweg an Schweizer Fachhochschulen dieser wenig attraktiv ist, und potenzielle Studierende bevorzugt den zweiten Bildungsweg wählen. Graber verwendet zur Begründung ihrer These das Risikowahlmodell von Atkinson. Ergebnisse einer durchgeführten Dokumentenanalyse weisen zudem darauf hin, dass vonseiten des Schweizerischen Hochschulrats an der Berufsmaturität, einer parallel zur Berufsausbildung oder nachgelagert absolvierten Fachhochschulreife, als bildungspolitischem Goldstandard festgehalten und Fachhochschulen geraten wird, mit dem Angebot hochschuleigener Aufnahmeprüfungen zurückhaltend zu verfahren. Schließlich scheinen die Möglichkeiten, ohne (Berufs-)Matura an einer Fachhochschule zu studieren, aufgrund einer Reform der Zulassungsverordnung für Fachschulen im Jahr 2021 im Wandel begriffen zu sein. Nach Einschätzung der Autorin müssen die von der Schweizerischen Hochschulkonferenz veröffentlichten Auslegungen der Neuregelungen als Verschlechterung von bereits zuvor unattraktiven Zugangsbedingungen interpretiert werden.
In Deutschland hingegen ist die Zugangsberechtigung zur Hochschule über den dritten Bildungsweg bereits mit dem 2009 verabschiedeten Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ohne schulische Studienberechtigung geöffnet worden. Bei der Umsetzung in Länderrecht haben mehrere Bundesländer landeseigene Zugangsregelungen erlassen, die über die Vorgaben der KMK hinausgehen (vgl. FREITAG et al., 2022). So können in Hessen seit dem Wintersemester 2016/17 beruflich Qualifizierte direkt nach dem beruflichen Abschluss ohne mehrjährige Berufserfahrung ein Studium in allen Fachrichtungen an allen Hochschulen aufnehmen, wenn die Abschlussnote der Ausbildung mindestens 2,5 beträgt und sie im ersten Studienjahr eine Mindestzahl an ECTS-Punkten erwerben. In den ersten fünf Studienjahren begannen 737 Studierende im Rahmen eines Modellversuchs auf diesem Weg mit dem Studium. Annika Greinert, Larissa Weber, Jan Hense und Joachim Stiensmeier-Pelster stellen im Beitrag „Evaluation des Modellversuchs zum Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte in Hessen“ die Ergebnisse der Evaluation des Modellversuchs vor, dessen Regelungen 2021 auf Dauer gestellt wurden. Die Studierenden des Modellversuchs wiesen deutlich überdurchschnittliche Abschlussnoten auf, entschieden sich überwiegend für eine Fachhochschule und studierten zu drei Vierteln fachlich affin zum Ausbildungsberuf. Wie in anderen Studien über Studierende des dritten Bildungswegs in Deutschland zeigen auch die Daten des Modellversuchs in Hessen, dass der Zugang für Studierende ohne schulische Studienberechtigung zur sozialen Öffnung der Hochschulen beiträgt. Für den Studienerfolg bzw. den Studienabbruch als zentrale Evaluationsdimensionen spielen die Hochschulart, die Abschlussnoten und die Affinität zwischen Ausbildungsberuf und Studienfach eine wichtige Rolle. Beim Vergleich mit den traditionellen Studierenden zeigt sich nach einem Jahr keine höhere Abbruchquote der nicht-traditionellen Studierenden.
Werden im Beitrag von Annika Greinert, Larissa Weber, Jan Hense und Joachim Stiensmeier-Pelster die Evaluationsergebnisse einer aktuell eingeführten und weitreichenden Öffnung der Hochschulen auf dem dritten Bildungsweg beschrieben, so handelt es sich bei dem Beitrag „Studium ohne Abitur – Bildungsentscheidungen und biografische Übergänge“ von Frank Kotterer, Andrea Broens, Juhyeok Lee, Sylke Bartmann, Detlef Garz und Olaf Zawacki-Richter um die Analyse von Bildungsentscheidungen und biografischen Übergängen, die auf den ältesten rechtlichen Regelungen eines Hochschulzugangs ohne Abitur in Deutschland basieren. Das Bundesland Niedersachsen führte bereits 1949 Regelungen ein, die ein Studium ohne Abitur an Pädagogischen Hochschulen auf Grundlage einer sogenannten Immaturenprüfung ermöglichten; in den 1970er-Jahren wurde an allen Hochschulen in Niedersachsen eine Zulassungsprüfung eingeführt (FREITAG, 2012, S. 63). Die Autor:innen präsentieren Ergebnisse aus einem laufenden Forschungsprojekt, das sich auf Grundlage eines qualitativ-rekonstruktiven Zugangs zu Bildungs- und Berufsbiografien ehemaliger Studierender mit Zulassungsprüfung widmet. Im Beitrag werden zwei Fälle präsentiert, die auf narrativ-biografischen Erzählungen (nach Schütze), die einer ca. 60-jährigen Frau und eines ca. 50-jährigen Mannes, und Analysen auf Grundlage der objektiven Hermeneutik (nach Oevermann) basieren. Die beiden Fälle, beide gleichermaßen als Erfolgsgeschichte eingeordnet, wurden ausgewählt, da sie im Gesamtsample von zwölf Interviews am stärksten hinsichtlich bildungs- und berufsbiografischer Motive und Antriebe, Werthaltungen, Strategien sowie damit verknüpfter Zielvorstellungen kontrastieren. Um auch bildungs- und berufsbiografisch späte Entwicklungs- und Bildungsdynamiken zu ermöglichen, plädieren die Autor:innen für ein biografisch notwendiges Offenhalten von Bildungsoptionen durch entsprechende Bildungsangebote. Metaphorisch kennzeichnen sie die Optionen als Möglichkeiten des Aufstiegs „auf rauen Pfaden“.
Dritter Bildungsweg: Studienerfolg und Studienabbruch
Hochschulische Bildungsoptionen trotz diesbezüglich nicht-traditioneller Bildungsund Lebensbiografien zu nutzen, birgt nach allgemeiner Einschätzung höhere Risiken für den individuellen Studienerfolg, als wenn der traditionelle Weg vom „Kindergarten in die Universität“ gegangen wird. Denn nicht-traditionelle Studierende verfügen teilweise über andere Ressourcen als ihre Kommiliton:innen. Die folgenden drei Beiträge thematisieren alle das Thema Studienabbruch als zentrales Risiko für nicht-traditionelle Studierende. Während sich die ersten beiden Beiträge auf der Grundlage eines Datensatzes aus Deutschland – dem Nationalen Bildungspanel (NEPS) – und zwei sehr unterschiedlichen methodischen Zugängen dem Thema „Studienabbruch“ nähern, betrachtet der dritte Beitrag die Situation für nicht-traditionelle Studierende in Zeiten der Corona-Pandemie.
Gunther Dahm fokussiert in seinem Beitrag „Warum brechen nicht-traditionelle Studierende häufiger ihr Studium ab? Eine Dekompositionsanalyse“ die Beziehung zwischen aus der Literatur bekannten möglichen Prädiktoren von Studienabbruch und dem vollzogenen Austritt aus dem Hochschulsystem. Es ist das Ziel des Autors, diese Beziehung mit Daten der Studierendenkohorte des Nationalen Bildungspanels (NEPS) möglichst umfassend zu erklären. Hierfür legt er das Modell rationaler Bildungsentscheidungen zugrunde und betrachtet neben den theoretisch verankerten Erwartungen zu Studienerfolg, Kosten und Erträgen auch die soziodemografische Komposition, die Lebensumstände sowie den Hochschul- und Studienkontext. Dahm rekurriert auf binäre logistische Regressionen, um Informationen über die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, die diese Prädiktoren für den Studienabbruch haben, und ermittelt dann mit einer Dekompositionsanalyse, welcher Anteil ihnen zugeschrieben werden kann. Der Autor zeigt über diesen Zugang, dass insbesondere das höhere Alter und die mit der beruflichen Einbindung der nicht-traditionellen Studierenden verbundene häufigere Immatrikulation in ein Fernstudium den Studienabbruch bedingen. Mit diesem Vorgehen können fast 90 Prozent der betrachteten endgültigen Studienabbrüche erklärt werden.
Lisa Hermann widmet sich in ihrem Beitrag „Abbruchgründe nicht-traditioneller Studierender – Identifikation von Clustern mittels Data Mining“ mit dem gleichen Datensatz ebenfalls dem Phänomen „Studienabbruch“ von nicht-traditionellen Studierenden. Obwohl nicht-traditionelle Studierende oftmals bessere Studienleistungen erreichen als traditionelle Studierende, denken sie häufiger über den Abbruch ihres Studiums nach oder beenden dies häufiger. Der Studienabbruch ist für Studierende ohne Hochschulzugangsberechtigung jedoch oftmals nicht mit nur einem Faktor zu erklären. An dieser Stelle setzt Hermann an und fragt nach erkennbaren Mustern in der Komplexität der bekannten Abbruchgründe. Die Autorin identifiziert Muster und Auffälligkeiten bei den Abbruchgründen der nicht-traditionellen Studierenden mit der explorativen und computergesteuerten Methode des „educational data mining“. Sie findet über diesen Zugang sechs unterschiedliche Abbruchgruppen, die gemeinsame Charakteristika aufweisen. Von besonderer Bedeutung für den Abbruch eines Studiums zeigt sich über diesen Zugang die Relevanz von Familie, Leistung und Finanzen. Die Autorin schlägt abschließend von ihren Ergebnissen die Brücke zu der Arbeit in den Hochschulen vor Ort. Sie weist darauf hin, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, um den Studienabbruch nicht-traditioneller Studierender zu verhindern, und skizziert insbesondere weiteren Forschungsbedarf in Bezug auf „weiche“ Faktoren wie Zufriedenheit mit dem Studium.
Die Umstellung auf Online-Lehre in der Covid-19-Pandemie und der Wegfall sozialer Kontakte im Studium hat bei vielen Studierenden zu einem erhöhten Belastungsempfinden und zu Problemen in der Studienfinanzierung geführt. Karsten Becker und Tobias Brändle fragen in ihrem Beitrag „Besonders belastet und kurz vor dem Abbruch? Nicht-traditionelle Studierende zu Beginn der Covid-19-Pandemie“ danach, ob und wie sich die wahrgenommenen psychischen und finanziellen Belastungen zu Beginn der Pandemie auf die Studienabbruchintention auswirken. Genutzt werden dazu Daten einer Studierendenbefragung aus dem Sommer 2020 mit etwa 24.000 Studierenden von 23 staatlichen Hochschulen in Deutschland. Besonders interessiert die Autoren, ob sich die Abbruchintention nach der Art des Hochschulzugangs unterscheidet. Sie erwarten bei nicht-traditionellen Studierenden aufgrund der Lebens- und Studiensituation dieser Gruppe bei deskriptiver Betrachtung eine stärkere Belastung und eine höhere Abbruchneigung im Vergleich zu traditionellen Studierenden mit Abitur oder mit einer Fachhochschulreife, die sich jedoch nur teilweise bestätigt. Es zeigen sich in einem Strukturgleichungsmodell in der Abbruchintention nur geringe Unterschiede zwischen den drei Vergleichsgruppen; größer sind die Einflüsse des Belastungsempfindens, das jedoch nicht direkt mit dem Zugangsweg zur Hochschule verbunden ist, und der finanziellen Situation, die sich insbesondere für Studierende mit Fachhochschulreife in der Pandemie verschlechtert hat. Der besondere Zugangsweg nicht-traditioneller Studierender an die Hochschule wirkt zu Beginn der Covid-19-Pandemie also nicht problemverschärfend. Im Gegenteil lassen sich die Ergebnisse als vorsichtige Hinweise auf eine höhere Resilienz nicht-traditioneller Studierender lesen.
Nicht-traditionelle Studierende: Zeitbudget, Studiensituation und lebenslanges Lernen
Was unter nicht-traditionellen Studierenden verstanden wird, ist nicht eindeutig definiert. In international vergleichenden Studien wurden verschiedene Definitionen und Abgrenzungen nicht-traditioneller Studierender verwendet, die Merkmale der (Bildungs-)Biografie, der Art des Hochschulzugangs und der Studienformate jeweils unterschiedlich gewichten und als Kriterien heranziehen (SLOWEY & SCHUETZE, 2012). Im Call für dieses Heft wurde eine enge Abgrenzung gewählt, die auf die Art des Hochschulzugangs abstellt und Studierende mit einem Hochschulzugang ohne schulische Studienberechtigung auf der Grundlage beruflicher Qualifikationen als nicht-traditionell definiert. Es ist angesichts der vielfältigen Perspektiven auf nicht-traditionelle Studierende und nicht-traditionelles Studieren nicht überraschend, dass auch Beiträge eingereicht wurden, die über die für den Call gewählte enge Abgrenzung nicht-traditioneller Studierender hinausgehen. Diese Beiträge lösen sich vom Fokus auf die Hochschulzugangsberechtigung und verbinden das Nicht-traditionelle mit der Lebenszeit, den Orten des Lernens oder der verfügbaren Zeit für Lernen. Sie sind im dritten Teil dieser Ausgabe versammelt.
Bianca Thaler, Judith Engleder und Martin Unger analysieren im Beitrag „Unterschiede im Zeitbudget von Studierenden mit nicht-traditionellen und traditionellen Hochschulzugängen“ das Zeitbudget von Studierenden mit traditionellem und nichttraditionellem Studienzugang in Österreich. Als nicht-traditioneller Zugang werden der zweite Bildungsweg oder eine mehr als zwei Jahre verzögerte Studienaufnahme mit Matura im Vergleich zu Maturant:innen mit unmittelbarem Studienzugang betrachtet. Die Studierenden mit nicht-traditionellem Zugang sind erwartungsgemäß älter und haben häufiger bereits Kinder, sie kommen öfter aus einem nicht-akademischen Elternhaus, sind in größerem Umfang studienbegleitend erwerbstätig und fühlen sich schlechter auf die Studienanforderungen vorbereitet. Deskriptiv betrachtet wenden nicht-traditionelle Studierende wöchentlich 2,5 bis 3,5 Stunden weniger für das Studium auf. Dieser Unterschied verschwindet aber in multivariaten Modellen, wenn Einflussfaktoren wie Fachrichtung, Alter, Erwerbstätigkeit, Pflegeverpflichtungen, Studienmotivation und Studienwahlmotive kontrolliert werden. Die Autor:innen schlussfolgern, dass eine gute Vereinbarkeit zwischen Studium und Erwerbstätigkeit und/oder Betreuungspflichten und die Berücksichtigung der heterogenen Lebens- und Studiensituation zu einem erfolgreichen Studienabschluss beitragen kann, und dies nicht nur nach einem nicht-traditionellen Zugang.
In einer besonderen Situation der Vereinbarkeit von Lebens- und Studienkontext befinden sich die nebenberuflich studierenden Nautiker:innen in dem Beitrag von Nicolas Nause unter dem Titel „Vergleichende Untersuchung von ‚nicht-traditionellen‘ Studierenden auf See und an Land“. Im Gegensatz zu der (fehlenden) Hochschulzugangsberechtigung als abgrenzendes Merkmal der nicht-traditionellen Studierenden stellen hier der Studienort auf dem Schiff und die besonderen Lebens- und Arbeitsbedingungen während der Zeit an Land die definitorische Grundlage. Der Autor geht den Unterschieden, aber auch den Gemeinsamkeiten zwischen den Nautiker:innen auf See und an Land bezüglich ihrer Lebens- und Arbeitskontexte nach. Ihn interessieren vor dem Hintergrund der Boundary-Theorie die Strategien, die diese Zielgruppe für die Vereinbarkeit zwischen den einzelnen Lebensbereichen entwickeln. Mittels seiner Fallstudie kann der Autor für die Nautiker:innen auf See herausarbeiten, dass sie im Gegensatz zu ihren Kolleg:innen an Land aufgrund der Einschränkungen, die der Arbeitsort Schiff und damit verbundener Wechsel zwischen „Segmentation“ und „Integration“, in besonderer Weise herausgefordert sind. Nause wirft auf der Grundlage seiner Erkenntnisse Fragen für weitere Forschung auf, zu denen u. a. die Konsequenzen der unterschiedlichen Strategien der Vereinbarkeit von Lebens- und Studienkontext für das (erfolgreiche) Studium gehören.
Ebenfalls als nicht-traditionell einzuordnen sind Studierendengruppen, die aufgrund des demografischen Wandels zukünftig vermehrt in den Fokus der Hochschulforschung rücken könnten. Hierzu zählt das bislang wenig untersuchte Studium von Senior:innen, die das Potenzial haben, eine wichtige Zielgruppe für die Hochschulen zu werden – oder es oftmals bereits sind. Aber auch Studierende mit zeitintensiver Pflegeverantwortung für Angehörige könnten im Zuge der Alterung der Gesellschaft vermehrt in die Aufmerksamkeit der Forschung gelangen. Die beiden folgenden Beiträge rücken Fragen über die Vereinbarkeit eines Studiums mit der Pflege von Angehörigen sowie die Zielgruppe der älteren Studierenden in den Mittelpunkt.
Der Beitrag von Karla Wazinski, Lea Knopf, Anna Wanka und Moritz Heß „Invisible caregivers: The ‘hidden lives’ of German university students with care responsibilities“ fokussiert auf ein bislang wenig beforschtes Thema. Unterschiedlichen Alters und in verschiedenen Arrangements pflegen manche Studierende – neben einem Studium – über einen längeren Zeitraum Familienangehörige und tragen dafür Verantwortung. Die Daten basieren auf acht problemzentrierten und theoretisch gesampelten Interviews (nach Witzel) mit sieben weiblichen und einem männlichen Studierenden, die an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland immatrikuliert sind und sich selbst als Studierende mit Pflegeverantwortung eingeordnet haben. Wichtige Ergebnisse der Studie sind, dass die pflegenden Studierenden in mehrfacher Hinsicht (u. a. physisch, psychisch und finanziell) belastet sein können, ihre Pflegearbeit im hochschulischen Raum verbergen und darüber hinaus vom Studentenleben weitgehend ausgeschlossen bleiben. So wie bei anderen nicht-traditionellen Studierenden steht ihr Leben im Widerspruch zum idealisierten studentischen Lebensstil. Die Autor:innen plädieren dafür, dem bislang wenig beachteten Thema unter den Hochschullehrenden Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und zudem die Rahmenbedingungen des Studiums zu flexibilisieren.
Im Beitrag „Senior:innenstudierende als nicht-traditionelle Zielgruppe der Hochschulbildung“ widmen sich Annika Felix, Birgit Schneider und Tobias Schmohl mittels einer quantitativ angelegten Fallstudie an den in Deutschland gelegenen Universitäten Magdeburg und Hannover den Fragen von Selbstwirksamkeit und Sinn für lebenslanges Lernen von Senior:innenstudierenden. Die Autor:innen können darlegen, dass Senior:innenstudierende eine sehr vielfältige Gruppe darstellen. In den Daten zeigt sich die Sinnstiftung als wichtiges Motiv für die Teilnahme an der akademischen Weiterbildung, das insbesondere bei weiblichen sowie nicht akademisch qualifizierten Senior:innenstudierenden zu finden ist – wenngleich das Motiv über die Zeit an Bedeutung verliert. Dennoch deuten sich auch Unterschiede zwischen den beiden Standorten an. Während Senior:innenstudierende in Magdeburg häufiger aufgrund von sinnstiftenden Motiven die Weiterbildung aufnehmen, motiviert die Befragten in Hannover vorwiegend der Grund, Bildung nachzuholen. Die Autor:innen diskutieren abschließend die Hintergründe ihrer Befunde und stellen hierüber Anknüpfungspunkte für die Arbeit vor Ort an den Hochschulen her.
Nicht-traditionelle Studierende als Fachkräftepotenzial? Zwei Werkstattberichte
Als eine Begründung (und Hoffnung), die mit der Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte ohne schulische Studienberechtigung verbunden war, wird die Gewinnung von akademisch qualifizierten Fachkräften angeführt (WOLTER, 2022, S. 49f.). Zwar sind nicht-traditionelle Studierende in Bereichen mit einem besonders hohen Fachkräftebedarf, wie etwa in den MINT-Fächern, deutlich unterrepräsentiert und tragen hier nur wenig zusätzliches Fachkräfteangebot bei (KERST & WOLTER, 2022; NICKEL & THIELE, 2022). Aber auch in Teilarbeitsmärkten, die nicht so im Blickfeld stehen, können nicht-traditionelle Studierende wohl nur einen kleinen Beitrag zur Minderung einer Fachkräftelücke leisten. Darauf weisen die abschließenden beiden Beiträge am Beispiel des Lehramts für berufliche Schulen hin.
Als Werkstattberichte zeigen sie, wie in Niedersachsen und Sachsen versucht wird, beruflich qualifizierte Personen, größtenteils ohne schulische Studienberechtigung, für ein Studium zum Lehramt an beruflichen Schulen zu gewinnen. In diesem Bereich herrscht seit Langem ein Mangel an Lehrkräften. Laura Kupke, Dietmar Frommberger und Thomas Südbeck berichten in „Übergänge stärken. Zur Gewinnung beruflich qualifizierter Personengruppen für das Studium zum Lehramt an berufsbildenden Schulen“ über die Evaluation eines Projekts, in dem potenzielle Lehrkräfte ohne Studienberechtigung, vielfach mit mehrjährigen Erfahrungen als betriebliche Ausbilder:innen, über ein kooperativ organisiertes Weiterbildungsangebot von Einrichtungen der Erwachsenenbildung und der Universität Osnabrück an das Hochschulstudium herangeführt werden. Während sich dieses Projekt im Vorfeld eines Studiums bewegt, wurde in einem Projekt der TU Dresden ein duales Studium für das technische Lehramt realisiert. Die Praxisphasen in diesem Studium finden an beruflichen Schulen statt, in denen die Studierenden als „Schulassistent:innen in Qualifizierung“ angestellt sind und nach erfolgreichem Abschluss und einem verkürzten Vorbereitungsdienst als Lehrkräfte verbleiben können. Welche Studierenden sich in den ersten drei Jahrgängen für dieses Angebot immatrikuliert haben, welche Unterstützungsbedarfe die Studierenden haben und wie sich das Begleitkonzept zum Studiengang an der Hochschule bewährt hat, stellen Dirk Wohlrabe, Nadine Matthes und Rolf Koerber in ihrem Beitrag „Erfolgreicher Studieneinstieg beruflich Qualifizierter im dualen Studium des technischen Lehramts“ dar.
Literaturverzeichnis
Freitag, W. K. (2012). Zweiter und Dritter Bildungsweg in die Hochschule. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.
Freitag, W. K., Danzeglocke, E.-M., & Berndt, L. (2022). Hidden Mechanism? Die Regulierung der Studienoptionen von Studieninteressierten des Dritten Bildungswegs. In H. Bremer & A. Lange-Vester (Hrsg.), Entwicklungen im Feld der Hochschule. Grundlegende Perspektiven, Steuerungen, Übergänge und Ungleichheiten (S. 77–93). Weinheim: Beltz Juventa.
Kerst, C., & Wolter, A. (2022). Statistisch marginal trotz bildungspolitischer Öffnung? Die Studiennachfrage nicht-traditioneller Studierender. In C. Kerst & A. Wolter (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung. Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 83–109). Wiesbaden: Springer Fachmedien
Nickel, S., & Thiele, A.-L. (2022). Update 2022: Studieren ohne Abitur in Deutschland Überblick über aktuelle Entwicklungen, CHE-Impulse Nr. 9. Gütersloh: CHE.
Slowey, M., & Schuetze, H. (2012). All change – no change? Lifelong learners and higher education revisited. In M. Slowey & H. Schuetze (Hrsg.), Global Perspectives on Higher Education and Lifelong Learners (S. 3–21). London und New York: Routledge.
Wolter, A. (2022). Hochschulzugang für nicht-traditionelle Studierende: Ursprünge, Wandel, aktuelle Dynamiken. In C. Kerst & A. Wolter (Hrsg.), Studierfähigkeit beruflich Qualifizierter ohne schulische Studienberechtigung Studienvoraussetzungen, Studienverläufe und Studienerfolg (S. 25–66). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
Autor:innen
Dr. Walburga Katharina FREITAG | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Lange Laube 12, D-30159 Hannover
https://www.dzhw.eu
Dr. Christian KERST | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Lange Laube 12, D-30159 Hannover
https://www.dzhw.eu
Dr. Jessica ORDEMANN | Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung | Lange Laube 12, D-30159 Hannover
https://www.dzhw.eu
1 E-Mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Magdalena FELLNER2 (Krems)
Studieren ohne Matura: Der Dritte Bildungsweg an Österreichs Hochschulen3
Zusammenfassung
Gemäß den Beschlüssen der Bologna-Ministerkonferenzen soll die Studierendenpopulation die Gesamtbevölkerung in allen Merkmalen abbilden (LONDON COMMUNIQUÉ, 2007). Bildungsbenachteiligte Studienwerber/innen, Personen mit Migrationshintergrund und Studierende aus ländlichen Regionen sind an Österreichs Hochschulen jedoch nach wie vor deutlich unterrepräsentiert (BMWFW, 2017). Der Anteil der Personen aus nicht-akademischem Elternhaus fällt bei Zulassungen über die berufliche Qualifikation bzw. eine Eignungsprüfung höher aus als bei traditionellen Bildungswegen (ZUCHA et al., 2020). Dieser Beitrag stellt 1) die gesetzlichen Bestimmungen und 2) bislang nicht publizierte Daten zum „Dritten Bildungsweg“ an Hochschulen dar.
Schlüsselwörter
Hochschulzugang, Dritter Bildungsweg, Studieren ohne Matura
Studying without a matura: Alternative pathways to higher education in Austria
Abstract
According to the decisions of the Bologna Ministerial Conferences, the student body should reflect the diversity of the population (LONDON COMMUNIQUÉ, 2007). However, educationally disadvantaged applicants, people with migration background and students from rural areas are significantly underrepresented at Austrian higher education institutions (BMWFW, 2017). The proportion of students whose parents have no higher education degrees is higher for admissions via vocational qualifications or an aptitude test than for traditional educational pathways (ZUCHA et al., 2020). These students were admitted to higher education via the so-called “third educational pathway”. This paper outlines the legal basis and the unpublished data on the third educational pathway to higher education.
Keywords
access to higher education, alternative pathways, alternative entry points
1 Einleitung
Zur Unterscheidung nach Art der Hochschulzugangsberechtigung werden die Begriffe „Erster, Zweiter und Dritter Bildungsweg“ verwendet. Personen mit Reifeprüfung (für Österreich: die Matura) oder gleichwertigem ausländischen Zeugnis (z. B. Internationales Baccalaureate oder europäisches Abiturzeugnis) können nach Schulabschluss auf dem „Ersten Bildungsweg“ mit einem Studium im tertiären Bildungsbereich anschließen. Im Vergleich zu den alternativen Bildungswegen geht die Reifeprüfung mit den meisten Privilegien einher: Erstens können sich die Maturant:innen theoretisch für jeden Studiengang entscheiden.4 Zweitens kommt durch den unmittelbaren Übertritt an die Hochschule keine Zeitverzögerung zustande und sie können sich mit dem Erststudium rasch am Arbeitsmarkt positionieren.
Mit der Studienberechtigungsprüfung, Berufsreifeprüfung und Externistenprüfung wurden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um auf dem „Zweiten Bildungsweg“ eine äquivalente formale Zugangsberechtigung zu erwerben. Diese drei Prüfungen weisen unterschiedliche Bestimmungen auf: Personen, die eine Lehre oder eine Berufsbildende Mittlere Schule (BMS) abgeschlossen haben, steht die Berufsreifeprüfung offen. Auch bei einer Externistenprüfung treten die Kandidat:innen an einer öffentlichen Schule zur kommissionellen Prüfung an, wobei sie sich den Prüfungsstoff zum Beispiel an einer alternativen Schule angeeignet haben. Die Studienberechtigungsprüfung wird vonseiten der Hochschule für Personen über 20 mit österreichischer Staatsbürgerschaft angeboten und kann innerhalb eines Jahres erworben werden. Allerdings bietet sie einen nur beschränkten Zugang für eine zuvor gewählte Studienrichtungsgruppe, ein Studienwechsel ist daher nur bedingt möglich. Auf den ersten beiden Bildungswegen erfolgt eine Überprüfung klassischer Prüfungsfächer (z. B. Mathematik, Deutsch oder lebende Fremdsprache) in Anlehnung an den gymnasialen Bildungskanon.
Schließlich können Kompetenzen, die im Zuge der beruflichen Qualifikation oder im Selbststudium erlangt wurden, über den sogenannten „Dritten Bildungsweg“ zur Zulassung an Hochschulen führen. In den künstlerisch-musischen oder sportlichen Prüfungen dienen Portfolios oder exemplarische Veranschaulichungen als Nachweis. Für die Bewertung der Gleichwertigkeit beruflicher Kompetenzen werden mitunter teilstrukturierte Gespräche oder der Nationale Qualifikationsrahmen als Grundlage herangezogen. Liegt aus Sicht der Bewerter:innen eine Studieneignung vor, ist in diesem Zusammenhang häufig von einer „gleichzuhaltenden Qualifikation“ die Rede (HUMER et al., 2019). Tabelle 1 fasst die drei Arten der Hochschulzugangsberechtigung überblicksartig zusammen:
Tab. 1: Die drei Bildungswege zur Hochschulzugangsberechtigung
Bezeichnung
Nachweis
Berechtigte Institution zur Ausstellung der Studienberechtigung
Erster Bildungsweg
Reifeprüfung bzw. gleichwertiges ausländisches Zeugnis
Schule
Zweiter Bildungsweg
Studienberechtigungsprüfung, Externistenprüfung, Berufsreifeprüfung
Hochschule, Erwachsenenbildungseinrichtung bzw. Schule
Dritter Bildungsweg
Berufliche Qualifikation, Portfolio, Eignungsprüfung
Hochschule
Da Studieninteressenten für den Hochschulzugang auf dem Zweiten und Dritten Bildungsweg weitere Qualifikationen erwerben müssen, erfolgt der Studieneintritt in der Regel zeitlich verzögert. Anzunehmen ist, dass viele Studienanwärter:innen zu einem späteren Zeitpunkt bereits berufstätig sind und dieser Faktor erschwerend zur Studienaufnahme hinzukommt. Insbesondere ein früher vorberuflicher Hochschulabschluss wirkt sich jedoch günstig auf die soziale Platzierung beim Berufseinstieg aus (TEICHLER, 1967). Studienanfänger:innen mit nicht-traditioneller Studienberechtigung und verzögertem Studienbeginn stammen überdies häufiger aus bildungsferneren Schichten (UNGER et al., 2020).
Bis dato mangelt es an einem Überblick zu den rechtlichen Bestimmungen, unter welchen die Aufnahme eines Hochschulstudiums ohne Matura oder Äquivalent erfolgt. Der Beitrag folgt dem Ziel, das diffuse Bild der Hochschulübergänge gegen einen systematischen Überblick einzutauschen. Dies erscheint nicht zuletzt deshalb relevant, da die Möglichkeit der Studienaufnahme über den Dritten Bildungsweg bislang kaum in Anspruch genommen wurde. Über das Berechtigungswesen werden bestimmte Gruppen ein- und andere ausgeschlossen, weshalb sich hinter den formalen Barrieren „soziale Regulationen in rechtlicher Form“ (FREITAG, 2012, S. 9) verbergen. Durch die Analyse der Zulassungspolitik treten gleichzeitig die in der Bevölkerung unterschiedlich verteilten Machtverhältnisse zum Vorschein (KARABEL, 2009).
Der Beitrag gestaltet sich wie folgt: Zunächst wird dargestellt, dass mit dem sequenziell gestuften Bildungssystem eine soziale Schließung einhergeht. Anschließend wird die aktuell geltende Gesetzeslage zum Dritten Bildungsweg für die vier österreichischen Hochschulsektoren (Universitäten, Privathochschulen, Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen) zusammengefasst. Daraufhin werden die Anteile der Studierenden nach Art der Zugangsberechtigung für ordentliche Studienprogramme und die wissenschaftliche Weiterbildung dargestellt. Der Beitrag endet mit einem kurzen Fazit.
2 Soziale Selektivität des Bildungswesens
Im LONDON COMMUNIQUÉ (2007) wurde für den Europäischen Hochschulraum das Ziel definiert, dass die Studierendenschaft bei Zugang, Teilhabe und Abschluss der Hochschulbildung die soziodemografische Zusammensetzung der Bevölkerung auf allen Ebenen widerspiegle. Dennoch wurde diese Zielsetzung für Österreich bislang nicht erreicht: Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind insbesondere bildungsbenachteiligte Studienwerber:innen, Personen mit Migrationshintergrund und Studierende aus bestimmten Regionen in der tertiären Bildung unterrepräsentiert (BMWFW, 2017).5 Der Abbau formalrechtlicher Barrieren könnte demgegenüber zur stärkeren Inklusion dieser Gruppen im tertiären Bildungsbereich beitragen. So zeigen ZUCHA et al. (2020), dass sich die wissenschaftliche Weiterbildung in Bezug auf den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ohne Matura als sozial offener erweist als ordentliche Studienprogramme. Der Dritte Bildungsweg allein führt jedoch nicht automatisch zur sozialen Durchlässigkeit. Der Anteil der Studierenden aus bildungsfernen Familien fällt zwar auf dem Dritten Bildungsweg höher aus als auf gymnasialem Weg, dennoch legen Studien aus Deutschland nahe, dass die Teilnehmenden bereits im Vorfeld hohe biografische Vorleistungen wie einen beruflichen Aufstieg zu verzeichnen hatten (WOLTER et al., 2015; OTTO & KAMM, 2016).
Will man das Zustandekommen der Unterrepräsentation sozial deprivierter Gruppen an Hochschulen erklären, ist ein Blick auf frühe Bildungswegentscheidungen im hierarchisch gegliederten und segregierten österreichischen Schulsystem erforderlich. Eine markante Zäsur der Bildungslaufbahnen wird bereits beim Übertritt in die Sekundarstufe I vorgenommen: Nach der 4. Schulstufe werden die Schüler:innen auf zwei unterschiedliche Schultypen, das akademische Gymnasium (Allgemeinbildende Höhere Schule, AHS) und die berufsorientierte Mittelschule (MS; ehemals Hauptschulen) aufgeteilt. Bei der Schultypenwahl nimmt der höchste Bildungsstand der Eltern einen entscheidenden Einfluss: Die Hälfte der Schüler:innen in der AHS-Unterstufe weist zumindest ein Elternteil mit tertiärem Abschluss auf, bei einem weiteren Fünftel haben die Eltern maturiert. Im Gegensatz dazu stammen 64% der Schüler:innen, die in eine Mittelschule übertreten, aus einem Elternhaus mit Lehrabschluss oder Abschluss einer BMS (WIMMER & OBERWIMMER, 2021, S. 267).
Der höchste Bildungsstand der Eltern beeinflusst des Weiteren die Wahl des Schultyps in der Sekundarstufe II: 78% der Schüler:innen, die in der Bildungsstandardüberprüfung 2018 angaben, nach der 8. Schulstufe eine AHS-Oberstufe besuchen zu wollen, wiesen zumindest ein Elternteil mit Matura oder tertiärer Ausbildung auf, während dies für nur 41% bzw. 36%, die an die BMS bzw. Polytechnische Schule wechseln wollten, der Fall war (ebd., S. 267). Vor allem Personen aus bildungsnahem Elternhaus entscheiden sich überproportional häufig für eine Höhere Schule, welche mit der Reifeprüfung abschließt. Das gegliederte Schulsystem bringt somit eine sozial differenzierende Wirkung in Bezug auf die Bildungsverläufe mit sich.
Bildungsungleichheiten nehmen im Laufe der Bildungsbiografien weiter zu und wirken sich in akkumulierter Form auf den Zugang zur tertiären Bildungseinrichtung aus. Obwohl im Schuljahr 2020/21 die Mittelschulen österreichweit beinahe doppelt so viele Schüler:innen aufwiesen wie die AHS-Unterstufen (STATISTIK AUSTRIA, 2021a), absolvierte mehr als die Hälfte der Schüler:innen (53,8%), welche eine AHS-Unterstufe besucht hatte, im Jahrgang 2020 die Matura, während lediglich 43,2% aller Maturierenden in diesem Jahrgang zuvor eine Mittelschule besucht hatten (STATISTIK AUSTRIA, 2021b).
Zusammengefasst wirken sich frühe Bildungswegentscheidungen, die in jungen Jahren nicht losgelöst vom Elternhaus getroffen werden, maßgeblich auf die spätere Möglichkeit an einer Hochschule zu studieren aus. Wenn die Eltern über eine Hochschulzugangsberechtigung oder einen tertiären Abschluss verfügen, ist die Wahrscheinlichkeit für ihre Nachfahren, ein Studium aufzugreifen, schließlich mehr als doppelt so hoch wie für jene aus bildungsfernem Elternhaus (UNGER et al., 2020, S. 123).
3 Gesetzeslage
Das österreichische Hochschulsystem setzt sich aus den vier Sektoren Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Privathochschulen zusammen. Die vier Hochschultypen können neben grundständigen und konsekutiven Studiengängen auch weiterbildende Universitätslehrgänge anbieten. Da mit den gesetzlichen Vorgaben handlungsleitende Orientierungen einhergehen, wird in Folge ein Überblick über die rechtlichen Bestimmungen zum Dritten Bildungsweg in den vier Sektoren gegeben. Abschließend wird der Fokus auf die rechtlichen Bestimmungen in der Weiterbildung gelegt.
3.1 Universitäten
Gemäß § 64 des Universitätsgesetzes (UG) gilt die allgemeine Universitätsreife6 als Voraussetzung für die Zulassung zu einem ordentlichen Studium. Von dieser Regelung ausgenommen waren lange Zeit nur Studienanwerber:innen für künstlerische und sportliche Studien, für die nach einer Eignungsprüfung „Bescheide für eine bedingte Zulassung“ (§ 60 Abs 1 a) erlassen werden konnten.7
Seit der UG Novelle 2021 können hochschulische Akteur:innen erstmals bei Verordnung des Rektorats für „einzelne oder sämtliche Bachelor- oder Diplomstudien, zu deren Zulassung keine besonderen Zugangsregelungen bestehen“ (§ 63 Abs 1 Z 6 UG) Eignungsprüfungen durchführen. Somit wurde kürzlich eine weitere Möglichkeit zur Aufnahme eines ordentlichen Studiums über den Dritten Bildungsweg eingeführt. Diese Gesetzesreform stellt eine Maßnahme dar, um „die Zulassung zum Studium von nicht-traditionellen Studienwerberinnen und -werbern sowie Studienwerberinnen und -werbern aus beim Zugang zur Hochschulbildung unterrepräsentierten Gruppen besonders zu fördern“ (ebd.). Nicht-traditionelle Studienwerber:innen werden näher bestimmt als „Studienwerberinnen und -werber mit Behinderung, berufstätige Personen, Personen mit Betreuungsverpflichtungen, Personen mit verzögertem Studienbeginn, Personen mit alternativem Universitätszugang sowie Personen im Ruhestand oder in Pension“ (§ 51 Abs 2 Z 14e UG). Selbst wenn bildungsbenachteiligte Personen in dieser Definition nicht explizit aufscheinen, sind öffentliche Universitäten dazu angehalten, in der Leistungsvereinbarung eigenständig Maßnahmen zur Inklusion unterrepräsentierter Gruppen zu setzen, welche zur sozialen Durchlässigkeit beitragen (§ 13 Abs 2 Z 2 UG).
3.2 Fachhochschulen
Im § 4 Abs 4 des Fachhochschul-Studiengesetzes (FHG) 1993 wird die allgemeine Universitätsreife oder eine einschlägige berufliche Qualifikation als Voraussetzung für die Zulassung zu einem Bachelorstudium genannt. Manche Studienprogramme sind explizit für Studierende mit Berufserfahrung konzipiert: „Baut das wissenschaftliche und didaktische Konzept eines Fachhochschul-Studienganges auf Berufserfahrung auf, darf der Zugang zu diesem Fachhochschul-Studiengang auf eine entsprechende Zielgruppe beschränkt werden“ (§ 4 Abs 4 FHG).
Gemäß § 11 Abs 1 FHG sind im Rahmen der organisatorischen Möglichkeit Aufnahmeverfahren durchzuführen. Wenn die Zahl der Bewerber:innen für einen
Studiengang die Anzahl der vorhandenen Plätze übersteigt, führen Aufnahmegespräche zur Reihung. Dafür sind leistungsbezogene Kriterien festzulegen, die den Ausbildungserfordernissen des jeweiligen Studienganges entsprechen. Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge gilt es, diese Bewertungen transparent und nachvollziehbar zu dokumentieren.
3.3 Pädagogische Hochschulen
Im § 52b des Hochschulgesetzes (HG) wird die allgemeine Universitätsreife als Voraussetzung für den Hochschulzugang genannt. Eine Ausnahme bildet die Erstzulassung für das Lehramt der berufsbildenden Sekundarstufe. Hier kann eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufsabschlussprüfung oder gleichzuhaltende Eignung (Meisterprüfung, Konzessionsprüfung, Abschluss einer facheinschlägigen Berufsbildenden Höheren Schule) für die Zulassung geltend gemacht werden. Die Studierenden müssen bis zum Erwerb von 120 ECTS-Anrechnungspunkten die Universitätsreife nachweisen, obgleich sie die dafür benötigten Prüfungen parallel zum Studium absolvieren können (§ 52b Abs 3 HG).
Gemäß dem Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) sind jene Fälle, die von der mindestens dreijährigen facheinschlägigen Berufspraxis für die Bachelorund Masterstudien des Lehramts Sekundarstufe (Berufsbildung) ausgenommen sind, durch Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu regeln (Anlage zu § 30a Abs 1 Z 4).
3.4 Privathochschulen
Privathochschulen müssen in regelmäßigen Abständen von der gesetzlich eingerichteten Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) akkreditiert werden. Dem ehemaligen Bundesgesetz über Privatuniversitäten (Privatuniversitätengesetz – PUG) von 2011 und Empfehlungen der AQ Austria zufolge können Privathochschulen die Zulassungen an ihren Hochschulen eigenständig handhaben, sofern sie diese Verfahren zum Zweck der Qualitätssicherung transparent halten. In den Satzungen der Privathochschulen werden diverse Möglichkeiten für die Zulassung auf dem Dritten Bildungsweg angeführt. So lässt sich den Statuten der New Design University St. Pölten (2015) entnehmen, dass Bewerber:innen bei Vorliegen einer außergewöhnlich künstlerisch-gestalterischen Eignung für betreffende Studien zugelassen werden können.
Mit der Privatuniversitäten-Akkreditierungsverordnung (PU-AkkVO) von 2019 wurden die Zulassungsverfahren der Privathochschulen immer mehr an jene der öffentlichen Universitäten herangeführt. Für Studienwerber:innen ohne allgemeine Universitätsreife führen Privathochschulen eine der Studienberechtigungsprüfung (gemäß §64 a. UG) vergleichbare Zulassungsprüfung und gegebenenfalls zusätzliche Aufnahmeverfahren durch. Die Zulassungsprüfung berechtigt wiederum nur zur gewählten Studienrichtungsgruppe an der betreffenden Privathochschule (ÖWR, 2016).
Die PU-AkkVO wurde 2021 von der Privatuniversitäten-Akkreditierungsverordnung (PrivH-AkkVO) abgelöst, derzufolge sich die Aufnahmeverfahren klar, transparent und fair gestalten sollten. Darüber hinaus sollen die Zugangsvoraussetzungen einen Beitrag zur Erreichung der Qualifikationsziele leisten. In dem 2021 in Kraft getretenen Privathochschulgesetz (PrivHG) finden sich für die ordentlichen Studiengänge keine näheren Angaben zu den Zulassungsbestimmungen.
3.5 Wissenschaftliche Weiterbildung
Weiterbildende Studienprogramme können in allen vier Hochschulsektoren angeboten werden. Im Unterschied zu den ordentlichen Studienprogrammen sind für den Besuch der Hochschulweiterbildung Lehrgangsbeiträge unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten zu entrichten (§ 56 Abs 5 UG). Die Voraussetzungen für die Zulassung über den Dritten Bildungsweg gestalten sich für Universitätslehrgänge in allen vier Sektoren gleich: Bis zum Wintersemester 2023/24 besteht die Möglichkeit, Studierende mit „gleichzuhaltender Qualifikation“ zu einem außerordentlichen Universitätslehrgang zuzulassen.8 Der Zutritt setzt den „Nachweis der allfälligen im Curriculum eines Universitätslehrganges geforderten Voraussetzungen“ voraus
(§ 70 Abs 1 UG, Fassung von 2014).9 Die aufnehmende Institution hat damit im Curriculum nur allfällig10 Zulassungskriterien festzulegen. Voraussetzung bildet de facto die facheinschlägige Berufserfahrung und eine Eignungsprüfung oder ein Aufnahmegespräch, das etwa mithilfe des Nationalen Qualifikationsrahmens zur Überprüfung der gleichwertigen non-formal und informell erworbenen Kompetenzen durchgeführt wird (HUMER et al., 2019). Darüber hinaus sollen sich die Zugangsbedingungen ähnlich wie für ausländische Masterstudien gestalten (§ 58 Abs 1 UG). Abgesehen von diesen Bestimmungen finden sich in der Fassung des Universitätsgesetzes von 2014 keine weiteren Kriterien für die Zulassung zur wissenschaftlichen Weiterbildung.
Die Möglichkeit der gleichzuhaltenden Qualifikation wird über die UG Novelle von 2021 für Zulassungen ab dem Wintersemester 2023/24 weiter eingeschränkt, da der Dritte Bildungsweg gemäß § 70 Abs 1 Z 2 und 3 nur mehr für den „Bachelor Professional“11 und „Executive Master of Business Administration (MBA)“ vorgesehen ist. Für die neu eingerichteten Bachelor Professional wird eine einschlägige berufliche Qualifikation oder eine mehrjährige einschlägige Berufserfahrung vorausgesetzt.12 Zudem können im Curriculum Ergänzungsprüfungen festgelegt werden. Für alle Universitätslehrgänge mit Master-Abschluss muss jedenfalls ein Bachelorstudium nachgewiesen werden, ausgenommen sind Universitätslehrgänge mit dem akademischen Grad „Executive MBA“. Hier kann im Curriculum auch eine einschlägige berufliche Qualifikation als Zulassungsvoraussetzung geltend gemacht werden, sofern die Zulassungsbedingungen mit mehreren „fachlich in Frage kommender ausländischer Masterstudien nachweislich vergleichbar sind“ (§ 70 Abs 1 Z 3 UG). Somit gilt die Vergleichbarkeit im internationalen Hochschulraum erneut als zusätzliches Kriterium für die Gestaltung der Zulassungsbedingungen.
3.6 Zwischenfazit
Die rechtlichen Bestimmungen zu den hochschulischen Zugangsberechtigungen ohne Matura oder Äquivalent werden überblicksartig in Tabelle 2 dargestellt.
Tab. 2: Rechtliche Verordnungen zum Dritten Bildungsweg an Österreichs Hochschulen
Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Beurteilung der Kandidat:innen subjektiv verzerrt sein könnte und soziale Benachteiligungen mitunter nicht erkannt werden (MESSERER & HUMPL, 2003; ROTHMÜLLER, 2011). Selbst wenn die Möglichkeit des Dritten Bildungswegs zwar grundsätzlich gegeben ist, bleibt zu vermuten, dass beruflich Qualifizierte, die bereits Führungserfahrungen zu verzeichnen haben oder sich selbstständig gemacht haben und ihre Kompetenzen entsprechend darstellen können, in den Eignungsprüfungen einen Vorteil aufweisen. Gerade für Studienplatzwerber:innen aus bildungsfernen Elternhäusern sind demnach „transparente, allgemeine, systematische, strukturierte Prüfungen und Auswahlmethoden erfolgversprechender als individualisierte Prüfungen der Selbstpräsentation, zumal in mündlicher Form“ (BARGEL & BARGEL, 2010, S. 10).
4 Studierende nach Art der Zugangsberechtigung
Für einen Überblick über die Zusammensetzung der Studierendenpopulation nach Art der Zugangsberechtigung werden im Folgenden die Verhältnisse in den ordentlichen und außerordentlichen Studien veranschaulicht. Dabei wird auf Sonderauswertungen der Studierenden-Sozialerhebung (UNGER et al., 2020) und die auf die durch die Statistik Austria erfasste Hochschulstatistik zurückgegriffen.
4.1 Ordentliche Studienprogramme
Der Anteil der ordentlichen Studienanfänger:innen auf dem Zweiten bzw. Dritten Bildungsweg umfasste im Studienjahr 2018/19 mit 4.103 Studierenden insgesamt 10,5% (Tab. 3).