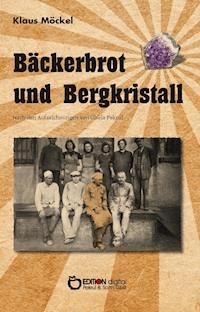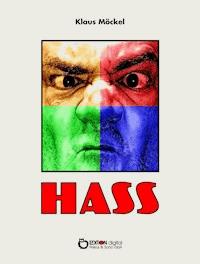7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wann ist ein Mensch normal? Was aber ist normal? Und wenn mit einem nicht alles stimmt, nicht alles normal ist? Ein solcher Mensch, mit dem nicht alles stimmt, der nicht normal ist, ein solcher Mensch ist Dan. Dan ist ein Mensch mit Behinderungen, mit schweren Behinderungen. Es fällt nicht immer leicht, ihn zu verstehen, oft versteht man überhaupt nicht. Es ist, als hätte Dan eine Schallmauer um sich gezogen, und niemand kann zu ihm vordringen: Zwanzig Minuten Weg von unserer Wohnung bis zur Tagesstätte, in der Dan zurzeit noch betreut wird. Auf halb acht bringen wir ihn hin, auf vier holen wir ihn ab. Von Montag bis Freitag - abends und am Wochenende ist er zu Hause. Da muss man sich dann was einfallen lassen, denn allein will und kann er nicht runter. Der Verkehr, die anderen Kinder. Er versteht ihre Spiele nicht, stellt sich nicht auf sie ein, stört sie, und das kann übel für ihn ausgehn. Kinder sind großartig, aber auch rücksichtslos und aggressiv, wenn sie den Außenseiter erkennen, das Besondere nicht erklärt bekommen. Also geht Wolfram mit ihm, während ich den Haushalt mache. Essen koche, erledige, was sonst zu tun ist. Oder ich nehme ihn in die Küche mit. Ich schäle Kartoffeln, er darf sie in Stücke schneiden. Darf Pudding einrühren, zuschaun, mit Wasser pantschen. Auch Wäsche waschen wir gemeinsam, zu dritt, wir haben ein relativ großes Bad. Aber der Tag ist lang, und bis zum Abend muss man viele Ideen haben. Und das an jedem Wochenende, und das an den Feiertagen und im Urlaub, der für uns kein Urlaub wie für andere Leute ist. Nicht für ihn, auch für seine Eltern ist dieses Leben mit Dan eine große Herausforderung: Der Gedanke, von Dan, Wolfram und mir zu berichten, kam uns schon vor Jahren, damals, als wir den ersten Schock wenn auch nicht verdaut (wie könnte man das jemals), so doch hinter uns hatten. Er meldete sich von Zeit zu Zeit erneut, besonders nach jeder Krise, und jetzt, da wieder alles in der Schwebe ist, da sich die ständige Anspannung sehr unfreundlich auf mich ausgewirkt hat, nimmt er konkrete Gestalt an. Wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Ja, es stimmt, die Erfahrungen, die sich angesammelt haben, wollen ausgesprochen sein, die Erlebnisse drängen auf die Lippen. Dennoch fällt es mir schwer, darüber zu reden. Dieser 1983 erschienene literarische Bericht gehörte zu den ersten Büchern, die sich in der DDR mit dem schwierigen Thema Menschen mit Behinderungen auseinandersetzten – ein Buch wie ein Aufschrei. Noch immer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum
Klaus Möckel
Hoffnung für Dan
ISBN 978-3-86394-162-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1983 bei Verlag Neues Leben, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Fotos: Klaus Möckel
© 2011 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
1. Kapitel
Zehn Minuten mit der Straßenbahn, dann umsteigen und nochmals fünf Minuten fahren - ein kurzer Weg, trotz der Wartezeit am Anfang und zwischendurch. Kein Vergleich zu früher, als wir nach Steinberg mussten durch die halbe Stadt, ein gutes Drittel des Tages war schon wegen dieser zweimaligen Kutscherei weg. Der lange Weg von der Straßenbahnendhaltestelle zur Einrichtung ging in die Beine, und wenn der Junge sich abends sperrte, wusste man nicht, wie nach Hause kommen.
Jetzt, na ja, irgendwie schafft man es schon. Irgendwie schaffte man es ja auch damals, selbst wenn er sich in den Schmutz kniete, in die Pfützen, so dass Hosen und Unterhosen pitschnass wurden, vor Dreck klebten, selbst wenn einen die Taxifahrer stehenließen, weil ihnen dieses Kind zu schwierig schien, wenn die Leute verständnislos, bedauernd oder indigniert zu einem herüberstarrten, wenn Dan sich mit all seiner Kraft dagegen stemmte, in die Bahn einzusteigen, wenn er brüllte und sich die halbe Fahrt über wie ein kleines Tier unter dem Sitz verkroch.
Ich erinnere mich an einen Abend, da er sich losgerissen hatte, und mitten auf die Straße lief. Sieben Jahre muss er immerhin gewesen sein oder acht. Ich konnte nichts dagegen tun; es geschah so überraschend, dass ich nicht zum Eingreifen kam. Er lief ohne erkennbaren Grund auf die Fahrbahn und legte sich lang auf den Bauch.
Eine Riesenaufregung: Ein LKW rutscht mit quietschenden Bremsen auf ihn zu, der Gegenverkehr stoppt, nachfolgende Wagen hupen, eine Straßenbahn, zum Glück noch ein Stück entfernt, bimmelt wie verrückt, die Passanten bleiben stehen und schimpfen, eine alte Frau neben mir jammert wie aufgezogen "Ogottogottogottogott". Der Fahrer des Lastwagens klettert gestikulierend und fluchend aus seiner Kabine; nein, es ist nichts passiert, Dan ist nicht zu Schaden gekommen, niemand hat sich bei dem jähen Bremsvorgang verletzt, nicht mal einen Auffahrunfall hat es gegeben. Nur mir stockt der Herzschlag, schmerzt mit einem Mal die linke Brustseite, und ich bringe kein Wort heraus. Weiß nicht, wie ich auf die Fahrbahn komme, jedenfalls muss ich ziemlich blass aussehen, denn der LKW-Fahrer, der drauf und dran ist, den Bengel zu vermöbeln (würde er's doch tun!), wird plötzlich ganz still. Er fasst mich am Arm und sagt: "Nun, nun, nun, junge Frau, beruhigen Sie sich, ist ja noch mal gut gegangen." Gut gegangen, na schön, auf seine Weise hat er recht, bloß mir ist hundsmiserabel. Ein Gefühl inneren Elends, das sich nicht in Worte fassen lässt. Die Leute drängen sich um uns, gaffen. "Was ist los, warum geht's hier nicht weiter?" Andere lassen ihrer Entrüstung freien Lauf, sparen auch nicht mit guten Ratschlägen: "Hat man so was schon erlebt; kann die nicht besser aufpassen; eine Tracht hat er verdient, dass er nicht mehr weiß, was hinten und vorn ist." Er aber, der Sünder, einen Blick wie ein König, liegt auf der Straße, ohne sich um den Trubel zu scheren. Nein, er ist nicht gewillt, klein beizugeben, das Feld zu räumen. Als dann die Dämme in mir endlich brechen und ich ihn voller Wut und Verzweiflung anbrülle, schüttle, zieht er bloß den Kopf ein. Völlig verspannt und verstockt, da helfen weder Schläge noch Zureden. Wir kennen das schon, es gäbe in dieser Situation nur ein Mittel: ihn eine halbe Stunde irgendwo einzusperren und zu sich kommen zu lassen. Aber wir sind ja unterwegs, mitten in der Stadt, und er liegt gut auf dem Asphalt. Ein warmer Tag, die Sonne scheint, ich erinnere mich genau. Ich versuche ihn am Arm zu packen, hochzuziehen - man glaubt nicht, was ein siebenjähriger Junge für eine Kraft entwickeln kann. Er macht sich steif wie ein Brett und knurrt vor Empörung. Schließlich packt ihn der LKW-Fahrer und schleppt ihn zurück auf den Fußsteig. Wo er gekränkt noch zwanzig Minuten hocken bleibt. Ich komme mehr tot als lebendig nach Hause, heule den ganzen Abend.
Oder an jenem Tag im Winter - das muss ein Jahr früher gewesen sein -, als er gleichfalls unvermutet die Straßenseite wechselt. Keine Ahnung, was ihm in den Sinn gekommen ist, vielleicht hat er drüben etwas Interessantes entdeckt, er geht ein paar Meter vor mir, unmöglich, so ein Kind immer an der Hand zu führen, er macht das nicht mit. Er läuft los, zielgerichtet, ohne nach links und rechts zu schauen, und natürlich ohne sich nach mir umzudrehen, mitten in den Verkehr hinein. Ich seh seine braune Pelzmütze zwischen den Fahrzeugen dahinwandern, die wild zu hupen beginnen, und renne wie gehetzt hinterher. Ich kriege ihn in der Straßenmitte zu fassen, bin völlig außer Atem, aber er ist gut gelaunt und geht brav mit zurück. Er versteht nicht, warum ich ihn rüttle und ausschimpfe. Erst jetzt wird er bockig, hält sich an den Laternenpfählen fest, als ich weiter will. Der Heimweg wird zur Qual, nicht zuletzt wegen der vorwurfsvollen Blicke der Leute, die alle Schuld mir geben. Dan ist nicht bereit einzulenken, er nimmt es übel, wenn man ihn tadelt, selbst wenn er weiß, dass er den Bogen überspannt hat. Gerade dann. Er begreift die Gefahren nicht, denen er sich aussetzt. Da er nicht hören kann und die Verständigungsmöglichkeiten mit ihm gering sind, ist es so gut wie ausgeschlossen, ihm Zusammenhänge zu erklären. Fest steht, dass man sich mit solch einem Kind einen besonderen Lebensrhythmus zulegt, eine Art zu existieren, an die man vorher nicht im Traum gedacht hat. Ich gehe auf der Straße, ich sehe normale Kinder und denke: Warum gerade er, warum gerade du, oder genauer, ich denke es schon nicht mehr, ich zwinge mich, es nicht zu denken, ich weiß, dass es sinnlos ist. Ich bleibe stehen, schau eine beliebige Hauswand an, zähle die Autos, die vorbeisausen, lenke mich ab. Gestern, auf dem Weg zur Tagesstätte, ertappe ich mich, wie ich die Fenster der gegenüberliegenden Häuserfront auf ihre Größe, ihr Aussehen hin vergleiche. Vier solche, zwei solche, eins doppelt unterteilt, eins sechsfach. Das heißt, ich ertappe mich nicht, ich tu das bewusst, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. Plötzlich ein kleines Mädchen: "Was is'n da, Tante, an dem Haus?" - "Was da ist? Nichts. Der Vogel dort drüben auf dem Dach, siehst du?" - "Da ist aber gar kein Vogel, ich seh keinen." - "Doch, da war einer, ist grade weggeflogen." Die Kleine schaut mich an, fünf Jahre mag sie alt sein, rot und weiß gestreiftes kurzes Röckchen, gelbe Bluse, Stupsnase und große braune Augen. Dann trollt sie sich. Zehn Meter weiter schreit sie: "Du spinnst ja, Tante" und rennt eilig davon.
Ich spinne, ich bilde mir was ein, schön wär's. Eher hab ich mir früher was eingebildet, als ich dachte, alles würde normal und gut verlaufen. Es gibt Dinge, schlimme Dinge, die werden erst Wirklichkeit, wenn sie einem selbst zustoßen. Der Autofahrer, der täglich von den Unfällen in der Zeitung liest, der den verbeulten Wagen des Nachbarn vorm Fenster stehen sieht, glaubt nicht ernstlich, dass ihm selbst so was passieren könnte. Zu seinem Glück vielleicht, er hätte sonst keine ruhige Minute mehr. Zu seinem Unglück aber, wenn ihm durch Leichtsinn wirklich was geschieht. Wenn er nicht aufpasst, fürs Leben zum Krüppel wird oder andere zum Krüppel macht. Wenigstens kann man den Autofahrer rechtzeitig warnen. Trink und rase nicht, halt die Augen offen, sei vorsichtig, sei dir der Gefahr bewusst! Aber wer hat mich gewarnt, uns, Wolfram, und wenn, wovor hätte man uns warnen sollen? Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, einen leisen Zweifel am allzeit glücklichen Verlauf des Schicksals und der Allmacht der Ärzte in uns zu wecken - wir hätten nicht so unvorbereitet dagestanden. Wir hätten uns auch besser gegen gewisse schematische Auffassungen zur Wehr setzen können, die uns zum Verhängnis wurden. Gegen die Meinung, dass für einen Säugling Muttermilch in jedem Fall das Beste ist. Natürlich, an Ratschlägen fehlte es nicht. Den Schwangeren wird ja allerhand mit auf den Weg gegeben. Tu das nicht, lass jenes sein. Keine Tabletten, keinen Alkohol, kein Nikotin. Ich beachtete all diese Mahnungen genau, verhielt mich der Vorschrift entsprechend. Dennoch haben wir dieses Kind. Vierzehn Jahre ist Dan jetzt alt. Äußerlich sieht man ihm nicht einmal viel an. Allerdings schlägt er oft einen sonderbar hinkenden Gang an, vor allem, wenn er aufgeregt ist. Wenn er abgelenkt ist, zerstreut, ärgerlich. Dass er ziemlich normal wirkt, hat Vor- und Nachteile. Mit Dan fällt man zunächst weniger auf, muss aber später, wenn er sich ungewöhnlich benommen hat, mehr erklären. Manche Leute sind schwer von Begriff, wollen mitunter auch nicht verstehen.
Zwanzig Minuten Weg von unserer Wohnung bis zur Tagesstätte, in der Dan zurzeit noch betreut wird. Auf halb acht bringen wir ihn hin, auf vier holen wir ihn ab. Von Montag bis Freitag - abends und am Wochenende ist er zu Hause. Da muss man sich dann was einfallen lassen, denn allein will und kann er nicht runter. Der Verkehr, die anderen Kinder. Er versteht ihre Spiele nicht, stellt sich nicht auf sie ein, stört sie, und das kann übel für ihn ausgehn. Kinder sind großartig, aber auch rücksichtslos und aggressiv, wenn sie den Außenseiter erkennen, das Besondere nicht erklärt bekommen. Also geht Wolfram mit ihm, während ich den Haushalt mache. Essen koche, erledige, was sonst zu tun ist. Oder ich nehme ihn in die Küche mit. Ich schäle Kartoffeln, er darf sie in Stücke schneiden. Darf Pudding einrühren, zuschaun, mit Wasser pantschen. Auch Wäsche waschen wir gemeinsam, zu dritt, wir haben ein relativ großes Bad. Aber der Tag ist lang, und bis zum Abend muss man viele Ideen haben. Und das an jedem Wochenende, und das an den Feiertagen und im Urlaub, der für uns kein Urlaub wie für andere Leute ist.
2. Kapitel
Der Gedanke, von Dan, Wolfram und mir zu berichten, kam uns schon vor Jahren, damals, als wir den ersten Schock wenn auch nicht verdaut (wie könnte man das jemals), so doch hinter uns hatten. Er meldete sich von Zeit zu Zeit erneut, besonders nach jeder Krise, und jetzt, da wieder alles in der Schwebe ist, da sich die ständige Anspannung sehr unfreundlich auf mich ausgewirkt hat, nimmt er konkrete Gestalt an. Wem das Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Ja, es stimmt, die Erfahrungen, die sich angesammelt haben, wollen ausgesprochen sein, die Erlebnisse drängen auf die Lippen. Dennoch fällt es mir schwer, darüber zu reden. Denn es ist ja nichts ausgestanden, wir haben uns - bis zu einem gewissen Grad - an unsere Situation gewöhnt, aber an jeder Erinnerung klebt zäh der Schmerz. Es gibt Wunden, die vernarben nicht, sie tun weh wie am ersten Tag. Stochert man in ihnen, brennen sie nur stärker. Warum also in der Vergangenheit wühlen, wenn die Gegenwart dadurch eher schwerer wird. Die allein hart genug ist. Da war vorige Woche dieses Gespräch mit der Leiterin der Tagesstätte, es ging um Dans künftigen Weg. Um seine Perspektive, wie wir das mit großem Wort nannten, obwohl von Perspektive, bei Licht besehen, nicht die Rede sein kann. Er wird ja keinen Beruf erlernen, nie selbständig werden. Die Aussichten, ihn für einige Stunden am Tag in einer geschützten Werkstatt unterzubringen, unter besonderen Bedingungen also, sind zwar gut und, wenn man so will, ein Erfolg unserer Anstrengungen, doch er wird immer jemanden für die restliche Zeit brauchen. Für uns bedeutet das eine weitere Beschneidung unserer ohnehin eingeengten persönlichen Sphäre. Oder konkret: Dans Betreuung auch in der Woche ab Mittag. Wie aber hält man das durch, und was wird aus der Arbeit. Ich versuche sachlich zu bleiben, das Für und Wider darzulegen - die Ruhe ist nur äußerlich. Wir debattieren, ich höre zu und rede, doch plötzlich wird mir übel. Ein Druck auf der Brust, Schwindelgefühl, der Atem wird knapp. Ich kenne das bereits, habe es aber nie ernst genommen. Auch diesmal steh ich auf, will zum Fenster gehn, da knicken mir die Beine weg. Irgendwas prägt sich noch ein - die großen erschrockenen Augen der Leiterin, die auf mich zukommen.
Oder ist das schon nach dem Schwächeanfall, als ich auf dem Sofa liege, schweißnass am ganzen Körper, um mich herum die Erzieherinnen, die zu Hilfe geeilt sind. Ich weiß es nicht, es ist auch gleich, jedenfalls ist keine Rede mehr von Dan, es geht erst mal um mich. Ich müsse sofort zum Arzt, sagen die Frauen, so was dürfe man nicht auf die leichte Schulter nehmen, ob mir das öfter passiere, ich hätte ihnen einen schönen Schrecken eingejagt.
Ich versuche, mich zu erheben, ich schaffe es mit Mühe, aber mein Kopf bleibt sonderbar wirr und leer. Außerdem tut mir die linke Brustseite weh, der linke Arm ist ganz taub. Die Leiterin will den Notarzt rufen, doch ich wehre mich dagegen, womöglich muss ich noch ins Krankenhaus. Schließlich nimmt mir die Leiterin das Versprechen ab, gleich am nächsten Tag zum Arzt zu gehn, dann fährt sie mich mit ihrem Wagen nach Hause.
Am darauffolgenden Morgen, alles scheint wieder normal, trabe ich zur Poliklinik - Wolfram hat mir noch zugeredet. Die Ärztin untersucht mich und runzelt die Stirn. Sie hat zu hohen Blutdruck festgestellt; in meinem Alter nicht ganz üblich, meint sie. Sie versucht, die Ursachen zu finden, fragt mich aus. Als ich von Dan erzähle, wundert sie sich nicht mehr. "Da sich an Ihrem Problem kaum was ändern wird, Frau Bade, müssen wir sehn, wie wir für Entlastung sorgen. Ich verschreib Ihnen was, aber das allein tut's nicht. Sie müssen mal ausspannen, ich werde eine Kur für Sie beantragen."
Sie ist in Ordnung, die Ärztin, sie hat keine Zeit für überflüssige Worte, aber man kann mit ihr reden. Um genaueren Aufschluss über meinen Blutdruck zu bekommen, schickt sie mich zur Augenspiegelung. Ergebnis: Der Augenhintergrund ist bereits bleibend verändert, jetzt muss das Nötige getan werden, damit sich dieser Zustand nicht weiter verschlechtert. Was für mich bedeutet, Tabletten auf lange Zeit und bewusster Abstand von Dingen, die mich aufregen. Was auch heißt, wenigstens für die nächsten Tage, Urlaub vom Stress. Also liege ich auf dem Bett und versuche abzuschalten. Zu lesen, Radio zu hören. Doch das gelingt nicht, die Gedanken bedrängen mich, sie lassen sich nicht zurückhalten. Sie laufen und laufen, eine Kugel, die ins Rollen gekommen ist. Ich liege da und denke darüber nach, wie es war, als uns dieser erste Schlag traf. Ich wühle in der Vergangenheit, obwohl ich weiß, dass ich mir im Augenblick kaum damit nütze. Vielleicht, dass ich ruhiger werde, wenn ich mir das alles mal von der Seele geredet habe.
Angefangen hat es gleich nach der Geburt, aber damals kannten wir die Zusammenhänge noch nicht und konnten unmöglich die Folgen ahnen. So stellte sich die erste Schockwirkung später ein, zu jenem Zeitpunkt, als wir das mit Dans Gehör erfuhren. Als wir uns Gewissheit verschaffen wollten und sich unsere vagen Befürchtungen bestätigten. Nein, wir hatten dieses Ergebnis nicht erwartet, wenn wir auch in den Wochen vorher unruhig gewesen waren, uns gewundert hatten. Warum hatte Dan als Baby nur so kurze Zeit gelallt und es dann wieder sein lassen, warum reagierte er auf unsere Rufe nicht, wo blieb sein erstes Wort? Es gab Zeichen, die wir nicht verstanden, die wir sogar vergnüglich fanden. Relativ früh schon, als er noch im Wagen lag, hatte uns sein verständiger Blick aus großen blauen Augen erfreut. "Der weiß bereits alles über die Welt", sagte die Nachbarin, und wir nickten geschmeichelt. Schaute er so wissend drein, weil er nicht durch Geräusche abgelenkt wurde? Kulissen aus Watte um ihn her, mit Gestalten, die den Mund aufsperrten, ohne Laute hervorzubringen. Mehrfach fiel uns auf, dass er unter den Bögen der Hochbahn Angst bekam, wenn oben Züge donnernd dahinratterten. Nur dann, nur lautes Dröhnen erschreckte ihn. Wir lachten darüber, hielten das für ganz natürlich. Erst später vermutete ein Bekannter, dass Dan vielleicht was mit den Ohren haben könnte. Häufige leise Quietschtöne, kein Sprachansatz - so ähnlich habe sich ein kleiner schwerhöriger Neffe verhalten. Wir erschraken, stellten selbst Tests an. Bauten uns hinter ihm auf, riefen, klopften, klatschten. Das Ergebnis dieser Versuche war nicht eindeutig, manchmal reagierte er, dann wieder nicht. Er schien das Schrillen des Telefons zu hören und das Quietschen der Straßenbahn, die um die Ecke fuhr. Andererseits bemerkte er es kaum, wenn einer von uns überraschend das Zimmer betrat.
Es war mein, unser erstes Kind - wir hatten keinerlei Erfahrung. Aber hätte nicht den Ärzten etwas auffallen müssen, mit denen ich in den anderthalb Jahren seit seiner Geburt wahrhaftig nicht zu knapp zu tun gehabt hatte? Die mich und ihn behandelt hatten, von denen ich alle möglichen Verhaltensregeln bekam, nur keinen Hinweis in dieser entscheidenden Sache. Ich wies schließlich in der Mütterberatung auf unseren Verdacht hin, bekam eine Überweisung zur Nordklinik. Wolf nahm einen Tag frei, es war klar, dass wir bei dieser wichtigen Untersuchung beide anwesend sein wollten.
Ich weiß den Tag nicht mehr, aber es war Herbst. Ich erinnere mich an den hässlichen Wind, der mir die Haare durcheinanderbläst, und an die schon kahlen Bäume, als wir von der Schnellbahn aus auf die Vorortgärten schauen. An den Nieselregen, der die Asphaltstraße glitschig macht. Wir suchen uns abzulenken, reden von neutralen Dingen: von den Büchern, die Wolf in den Tagen vorher verkauft hat, von meiner Schule (Sie warten immer noch darauf, dass ich wieder mit dem Unterricht beginne). Dan ist guter Laune, er wippt und strampelt im Sportwagen herum. Als er zu wild wird, nehme ich ihn auf den Schoß und versuche, ihn für die Landschaft zu interessieren. Doch das gelingt nicht. Dafür hat es ihm meine Kette angetan. Er zieht daran. Vor allem ein großer grüner Stein in der Mitte scheint nach seinem Geschmack zu sein.
Mit dieser Kette beschäftigt er sich dann auch, als wir im Vorzimmer sitzen. Wir sind, um nicht zu früh zu kommen, erst noch im Park spazierengegangen und brauchen nun nicht lange zu warten. Sie nehmen uns das Kind ab und führen es nach hinten. "Bitte einen Augenblick Geduld!" Dann dauert es, dauert. Wir sitzen und starren die weißen Wände an; wir sind zu aufgeregt, um uns zu unterhalten. Zum Glück ist viel Bewegung im Raum, immer neue Mütter oder Väter tauchen mit ihren Kindern auf, werden abgefertigt. Ein ständiges Kommen und Gehen.
Wir denken, er kommt wieder nach vorn, aber plötzlich wird mein Name aufgerufen. Wolf folgt mir, wir brauchen uns nicht abzusprechen. In verschiedenen Räumen sitzen Arzte und Patienten. Eine Schwester kommt uns entgegen, führt uns in das dritte oder vierte Zimmer. Eine ältere Ärztin, ein junger Arzt und zwei, drei Schwestern stehen um Dan herum.
Das sieht leider gar nicht günstig aus, Frau Bade", sagt die Ärztin, "bitte, schaun Sie selbst."
Sie stellt Dan mit dem Rücken zu einem großen Gong; der junge Arzt nimmt eine Art Trommelschlegel und schlägt gegen die Blechscheibe. Ein gemäßigtes Dröhnen ertönt, mir tut es bereits weh, aber Dan dreht sich nicht um, horcht nicht einmal auf.
Bei einem zweiten, stärkeren Schlag reagiert er auch noch nicht, erst beim dritten, sehr lauten Widerhall hebt er suchend den Kopf.
Die Ärztin nimmt einen kleinen Wecker und lässt ihn, in der Hand versteckt, neben Dan klingeln. Der Junge deutet durch keinerlei Zeichen an, dass er etwas gehört hat. Erst als die Ärztin den Wecker ganz nahe an sein Ohr heranführt, stutzt er, wendet den Kopf.
"Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen", sagt die Ärztin betont forsch, "sprechen lernen diese Kinder."
"Diese Kinder?"
"Kinder mit einer solchen Schädigung, meine ich."
"Aber er ist doch nicht taub?", flüstre ich.
"Er hat den Wecker doch gehört!", ergänzt Wolfram.
"Sind Sie der Vater?"
"Ja."
"Sie müssen sich damit abfinden", sagt die Ärztin. "Ihr Kind hört so gut wie nichts. Aber ich gebe Ihnen eine Überweisung in die Zentralklinik. Nur dort kann das genau und endgültig ermittelt werden."
3. Kapitel
Ich wüsste nicht, was werden sollte, wenn ich die Arbeit nicht hätte. Natürlich bin ich in meinen Möglichkeiten beschränkt, kann an manchen Tagen lediglich für zwei, drei Stunden an die Maschine, finde an anderen gar nicht die Gelegenheit, muss oft abends ran, um die Termine zu halten. Meiner Zeitknappheit wegen übersetze ich nur relativ kurze Texte, Erzählungen oder kleine Romane bis zu zweihundertfünfzig Seiten. Einmal, am Anfang, habe ich mich auf eine größere Sache, etwa vierhundert Manuskriptseiten, eingelassen. Wenn ich wenigstens eine lange Zeitspanne zur Verfügung gehabt hätte. Aber die Frist war knapp, das Buch sollte schnell heraus, und ich saß die halbe Nacht. Obwohl ich bereits erschöpft war, wenn wir den Jungen im Bett hatten. Wolfram nahm mir Dan ab, so gut es ging, stellte die eigene Arbeit zurück. Dennoch blieb genug für mich zu tun, es war eine einzige Hetzerei.
Aber ohne meine Übersetzungsarbeit - nein. Das ist der einzig wirksame Ausgleich, der Boden, auf den ich mich zurückziehe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn mir unsere Situation zu Bewusstsein kommt, wenn ich verzweifelt bin. Klar, immer hilft das auch nicht, es gibt Augenblicke, da grolle ich mir, dem Schicksal, allen Leuten, die gesunde Kinder haben, so dass ich keine Zeile lesen, geschweige denn aus dem Russischen ins Deutsche bringen kann. Dann brauche ich einen langen Anlauf, jemanden, der mir gut zuredet, dann scheint mir auch diese Arbeit nur eine zusätzliche Belastung. Doch wenn ich mich erst mal aufgerafft habe, verlieren die anderen Probleme einen Teil ihrer Bitterkeit. Wenigstens vorübergehend. Nicht dass sie verschwinden - sie sind nicht mehr ganz so niederdrückend. Ich suche für die Redewendung "Aus einem Lied kann man kein Wort entfernen" eine deutsche Entsprechung, ich mühe mich ab, ärgere mich, weil nichts den Sinn voll wiederzugeben scheint, und befreie mich dabei unmerklich von Fesseln, die mir Dans Behinderung auferlegt. Eine Scheinfreiheit? Meinetwegen. Auf jeden Fall rückt sie einiges zurecht, stellt Proportionen wieder her, die verschoben werden, wenn man sich in seinen Schmerz einspinnt. Der Blick wird wieder nach außen gelenkt. Abgesehen davon, dass es immer ein gutes Gefühl ist, etwas zu schaffen. Die Tage, an denen die Übersetzungen dann gedruckt als Buch ins Haus kommen, entschädigen zwar nicht für alles, aber doch für manche Anstrengung und Aufregung.
Es war nicht leicht für mich, dieses Mittel der Selbstbewahrung zu finden. Ich war Lehrerin gewesen, für Deutsch und Russisch, hatte meine Arbeit gern getan und nie die Absicht gehabt, diesen Beruf aufzugeben. Aber mit Dans Geburt war alles anders gekommen. Erst musste ich ein Jahr aussetzen, dann kam das zweite hinzu, und schließlich wurde klar, dass wir unser Kind weder in einer Krippe unterbringen konnten noch jemanden für seine Betreuung fänden. Das aber bedeutete: Ich würde zu Hause bleiben müssen. Für Dan da sein, den Haushalt versorgen, und das auf Jahre hinaus. Ich hatte mir das natürlich anders vorgestellt. Sich einige Monate von dem Trubel, den Problemen in der Schule erholen - nichts dagegen einzuwenden. Aber auf lange Zeit tagtäglich nur die Wohnung, den Jungen sowie abends und an den Wochenenden den Mann, das füllte mich nicht aus, schon der Gedanke daran machte mich verrückt. Ich fühlte mich auch viel zu jung dazu, die anderthalb Jahre, in denen ich nun bereits so lebte, reichten mir. Dazu kam, dass Dan schon damals schwierig war. Er schlief schlecht, war zapplig, quietschte viel. Ich brauchte etwas, was mich auf andere Gedanken brachte. Und ich hatte ja studiert, war nicht die Schlechteste gewesen, konnte gut Russisch. Wenn man eine Sprache nicht pflegt, entgleitet sie einem. Die Grammatik verliert sich, die fremden Wörter verblassen. Ich wollte nicht alles verlernen. Außerdem konnten wir das Geld gebrauchen. Damals gab's nicht wie heute Kredite für junge Eheleute, und uns fehlte noch die Hälfte der Wohnungseinrichtung. Wenn wir auch bescheiden lebten, so hatten wir doch bestimmte Wünsche und Vorstellungen, und der Verdienst meines Mannes war nicht gerade üppig.
Wolf und ich beratschlagten, wir gingen die wenigen Möglichkeiten durch, die mir unter diesen Umständen blieben. Dolmetscher fiel weg, ich konnte nicht tage- oder wochenlang herumreisen. Da ich einen Bekannten bei der Volkshochschule hatte, dachte ich zunächst an Abendstunden. Sprachunterricht hätte ich geben können, aber wir verwarfen das wieder. Ich wäre zu sehr gebunden gewesen, und Wolfram hätte nach Feierabend Dan betreuen müssen. Dann hätte er aber ein Hobby völlig in den Wind schreiben können, das er mit größter Leidenschaft pflegte: die Pusselei an eigenen literarischen Texten. Das waren Skizzen über Alltagsbegebenheiten, ein wenig melancholisch, ein wenig skurril, ein wenig ironisch und am Ende mit einer kleinen Pointe. Die Pointe zu finden war das schwierigste, von ihr hing der Wert der ganzen Geschichte ab, und er verbrachte Stunden damit, über einen bestimmten Satz am Ende zu grübeln. Diese Stunden, in der letzten Zeit ohnehin rar geworden, konnte ich ihm nicht wegnehmen, ich wollte es auch nicht.
Wir überlegten, ob wir eine Anzeige in die Zeitung setzen sollten: "Erteile Nachhilfeunterricht ..." Ein paar Stunden in der Woche hätten mir für den Anfang genügt, und es gab ja immer Schüler und Studenten, die ihre Zeugnisse aufbessern wollten. Wir hätten das vielleicht versucht, wäre mir nicht der Zufall anderweitig zu Hilfe gekommen. In Gestalt eines ehemaligen Verehrers, der bei einem Berliner Verlag eine kleine Jugendreihe herausgab. Als ich eines Vormittags mit Dan durchs Zentrum kutschte, sprach er mich unvermutet an. Ich hatte ihn ganz aus den Augen verloren, wusste nichts von seiner Arbeit, erkannte ihn mit seiner Halbglatze und dem rund gewordenen Gesicht kaum wieder. Aber ich freute mich über die Abwechslung; wir redeten, tauschten Erinnerungen aus und kamen schließlich auf meine Situation zu sprechen. Damals redete ich nicht gern über Dan. Ich begann immer gleich zu heulen, dabei wusste ich lediglich von seinem Hörschaden. Aber mein Bekannter muss mich ausgefragt haben, denn ich erzählte von meinen Problemen und dass ich nicht wieder in der Schule anfangen konnte. Da schlug er mir vor, es mit Übersetzungen zu versuchen. Er brauche grad jemanden für eine Erzählung, vierzig bis fünfzig Seiten, relativ leichter Text. Ich müsse allerdings zunächst eine Probe liefern.
Die Sache ließ sich gut an und gab mir Auftrieb. Zwar hatte ich anfangs mit der Wortwahl Schwierigkeiten, verhedderte mich auch hin und wieder bei langen Sätzen, aber es machte Spaß. Lehrgeld zahlt jeder, und bei mir lagen die Kosten nicht überm Durchschnitt. Ich fing mit Abenteuererzählungen an, die mir einigermaßen flott von der Hand gingen, und wagte mich dann langsam an schwierigere Texte. Sofern mir die Verlage welche überließen - ich war ja nicht der einzige Anwärter. Zugute kam mir ein Schreibmaschinenkurs, den ich im ersten Jahr nach Dans Geburt besucht hatte. Es muss kurz nach seiner Ernährungsstörung gewesen sein, ich erinnere mich, dass ich die Zeit zwischen seinen Mahlzeiten nutzte; nur mit Mühe brachte ich alles unter einen Hut. Ich besuchte die Übungen nicht ganz bis zum Schluss, hab's aber geschafft, mit zehn Fingern und blindschreiben zu lernen.
Ich schreibe die Rohfassung mit der Maschine, redigiere von Hand und tippe auch das endgültige Manuskript selbst. Das ist mir lieber, als wenn ich's weggeben müsste. Schwierige Passagen spreche ich oft mit Wolf durch.
Das Übersetzen fällt mir nicht immer leicht, es gibt ja solche und solche Texte. Kompliziert wird's, wenn der Autor mehr bieten will, als er kann, wenn er den Stil aufbläht, pseudophilosophisch ausschmückt, wenn er unlogisch wird oder schludert. Aber ich bin froh, dass ich gerade diese Arbeit habe. Es war Glück, dass ich umsatteln konnte, mir einen Beruf erarbeiten, den ich zu Hause auszuüben vermag. Jeder, der ein solches Kind hat, muss sein Leben neu organisieren. Und es wäre ganz bestimmt falsch, die Hände in den Schoß zu legen, sich selbst zu bedauern, zu warten, dass jemand kommt, der einen tröstet und die Probleme löst.
4. Kapitel
Das wichtigste im Umgang mit Dan ist Geduld, man braucht sie zu Hause und unterwegs: Geduld, Engelsgeduld und als Voraussetzung dafür Zeit. Nur ja keine Termine oder Verabredungen, wenn ich mit dem Jungen irgendwohin muss. Der lange Weg nach Steinberg zum Beispiel barg die vielfältigsten Möglichkeiten für unvorhergesehene Aufenthalte. Beim Umsteigen vom Bus in die Straßenbahn und dann auf dem letzten Stück der Strecke. Ein Wunder, dass wir es morgens meist bis acht schafften. Wir brachen allerdings auch zeitig auf.
Als er noch sehr klein war, staunte Dan stets und ausgiebig die Häuserecken an. Dort, wo sie sich kantig von der übrigen Landschaft und vor allem vom Himmel abhoben. Was er genau betrachtete - ob es wirklich diese Scheidelinie zwischen Dunkel und Hell war oder vielleicht die Mauerkante selbst - haben wir nie herausbekommen. Wir fragten ihn, wobei wir die Kante berührten, mit der Hand drüberstrichen: "Ist das schön? Gefällt es dir? Dan schaute uns einen Augenblick lang mit seien großen Augen an, in denen tief innen ein fast verständiges Lächeln aufglomm, und versenkte sich erneut in sein Problem. Fünf Minuten stand er so, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Im Winter, bei größter Kälte. Ich seh ihn noch vor mir, mit seiner Zwergenmütze und seinem dick gefütterten Anzug, und ich seh vor allem mich, die trotz Stiefeln und Handschuhen an Händen und Füßen friert, die weiterwill und der es nicht gelingt, ihn wegzulocken. Mit Zureden, mit Bonbons und ähnlichem ist da nichts zu machen, und gleich gar nichts mit Gewalt. Wenn man ihn fortzerrt, sperrt er sich den ganzen Weg über, vergilt es einem mit tausend kleinen Bockigkeiten. Setzt sich in den Schmutz, oder reißt sich los und läuft auf die Straße. Weigert sich, in die Bahn einzusteigen, macht sich beim Fahren ständig an der Tür zu schaffen. Stößt die Leute an, zupft sie am Mantel, tritt ihnen auf die Füße, nur um mich zu ärgern. Mitunter heule ich vor Wut und Hilflosigkeit. Die vorwurfsvollen Blicke, die wenig freundlichen Worte gehen trotzdem an meine Adresse. "Mein Gott, ist das Kind schlecht erzogen." Wann habe ich schon die Zeit und die Kraft, sein Verhalten zu erklären.
Oder die Straßenbahnen, die um die Ecke fahren. Das ist eine Leidenschaft, die über Jahre anhält und die er in abgeschwächter Form bis jetzt bewahrt hat. Wir stehen an der Haltestelle, sind gerade ausgestiegen und müssen nur noch über die Straße, um zu Hause zu sein. Eine einzige Minute - schön wär's. Dan beobachtet die Bahn, die links abbiegen will, aber durch den Verkehrsstrom auf der Hauptstraße vorläufig daran gehindert wird. Eine Zwölf, sie steht und steht. Endlich ruckt sie an, legt sich quietschend in die Kurve, an der Oberleitung zuckt ein blauer Funken auf. Ich habe Dan an der Hand, ich muss ihn festhalten, weil er unberechenbar ist. Vorsichtig versuche ich ihn wegzuziehen, denn wir erwarten am Abend Besuch, und ich muss noch einiges vorbereiten. Aber Dan gibt nicht nach, erst muss die Bahn ganz um die Ecke sein. Und natürlich tritt ein, was ich befürchtet habe: Mit schwachem Rattern nähert sich die Gegenbahn. Befindet sich bereits in unserem Blickfeld, will gleichfalls in die Kurve einbiegen. Doch das geht noch nicht, denn inzwischen rollt auf der Straße wieder der Autoverkehr. Zuerst auf der Haupt-, dann auf der Nebenstraße. Auch diese zweite Bahn steht und steht. So wie Dan, so wie ich, freilich sind unser beider Gefühle recht unterschiedlich. Er ist vergnügt - da er mein Bestreben merkt wegzukommen, bereits etwas störrisch vergnügt -, in mir dagegen regt sich Unwille. Tag für Tag das gleiche, und heute fehlen mir die Minuten. Der Zorn steigt, ich spüre: Lange werde ich's nicht mehr aushalten. Zum Glück naht die Bahn nun, und Dan lässt sich etwa drei Meter in Richtung Bordsteinkante ziehn. Doch heimlich unbemerkt hat sich von hinten eine Vierundzwanzig herangepirscht. Weshalb wohnen wir nur in einer so verkehrsreichen Gegend. Dan, ein wenig Hinterlist im Blick, bremst meinen Rückwärtsgang. Stemmt sich, wird bockbeinig. Ich zerre ihn am Arm, er zerrt zurück. Bis mir der berüchtigte Geduldsfaden reißt: Ich will nicht mehr warten. Trotz der Leute, die mittlerweile interessiert zu uns herschaun, versuche ich dem Jungen durch Gesten klarzumachen, dass ich mich nicht ständig nach seinen Wünschen richten kann. Dass meine Zeit bemessen ist, besonders heute, dass es Pflichten für mich gibt. Dass er sich wenigstens manchmal fügen muss. Ich rede auf ihn ein, die Antwort ist ein unwirsches Knurren und Sichversteifen. Inzwischen hat die Vierundzwanzig gehalten, die Fahrgäste sind aus-, die Wartenden eingestiegen, aber der PKW-Verkehr fließt erneut - weiter als bis zur Kurve kommt die Bahn nicht. Ich ertrag's nicht mehr, ich zerre Dan unter Aufwendung aller Kräfte hinter mir her über die Straße und lasse ihn auf der anderen Seite los. Soll er stehn und sich die Bahnen bis nachts um zwölf anschaun, mir ist das egal. Ich verschwinde im Hausflur, steige die vier Treppen bis zur Wohnung hoch, öffne. Ich bin außer mir, mein Puls rast. Und doch nehme ich mir nicht mal Zeit, den Mantel abzulegen. Wie ich bin, renne ich ans Fenster und starre hinunter. Er ist weg, offenbar ist er im Haus, denn auf der Straße gibt es keinen Auflauf, nichts Besonderes. Ich sause wieder zur Tür, im Hausflur höre ich ihn scharren und ärgerlich brummen. Aber es dauert lange, ehe er die Freundlichkeit hat, weiter nach oben zu kommen. Wenn ich mich nicht überwinden und ihm zwei Treppen entgegengehen würde, käme ich heute überhaupt nicht mehr zu meinen Vorbereitungen.
Manchmal meinen Bekannte, das sei bei ihren Kindern auch so, .das zeige sein Interesse für die Dinge. Mag sein, dass sie zum Teil recht haben. Dan erkundet die Welt auf seine Weise und wir sind bestimmt die letzten, die ihn daran hindern. Doch diese Art, sich zu interessieren und dabei hartnäckig auf dem eigenen Willen zu beharren, beschwört für uns immer wieder schwierige Situationen und Konflikte herauf. Dan erziehen, hieß zunächst nachgeben und sich auf ihn einstellen. Ein außerordentlich komplizierter Lernprozess, bei dem uns kaum Hilfe zuteil wurde. Im Gegenteil. Die Menschen messen mit der Elle des Normalen, erkennen zwar theoretisch das Ungewohnte an, haben aber in der Praxis oft kein Verständnis dafür. Und keine Zeit. Wir freilich müssen uns diese Zeit nehmen. Was macht man aber, wenn ein Termin eingehalten werden soll, wenn man zum Zahnarzt will oder sich zu Hause die Handwerker angesagt haben. Der Junge muss in die Tagesstätte gebracht werden, er hat keine Ahnung von unseren Pflichten, er sieht unterwegs einen Maurer, der Ziegelsteine über ein kleines Fließband ins erste Stockwerk eines Hauses befördert, einen Mann, der Kohlen in einen Keller schaufelt, und steht wie angegossen. Natürlich ist es faszinierend, zuzuschauen, wie die Briketts von einem riesigen Haufen auf dem Gehsteig durch eine Luke nach unten geworfen werden. Dan wird das Feld nicht räumen, bevor nicht der letzte Handgriff getan ist.
"He, Junge, macht wohl Spaß, aufzupassen, wenn andre arbeiten."
"Er ist gehörlos, er will wissen, wohin die Briketts verschwinden."
"Na dann komm mal her und wirf einen Blick in den Keller. Der ganze Verschlag da unten soll voll werden." Der Arbeiter lächelt breit.
Wolfram schiebt Dan näher an die Luke heran, lässt ihn hinunterschaun. Als er dann aber weiter will, sperrt sich der Junge.
Sie stehen fünf Minuten, schließlich sagt Wolf: "Der geht nicht, bevor der ganze Haufen weg ist."
"Von mir aus kann er zugucken", erwidert der Arbeiter.
"Die Sache ist nur, dass ich's ausgerechnet heute eilig hab." Der Arbeiter zuckt die Schultern, was soll er dazu sagen.
Sie könnten wohl nicht mal um die Ecke verschwinden, eine Pause machen?", fragt Wolf zögernd. "Wenn er sieht, dass es nicht weitergeht, kommt er vielleicht mit."
Der Arbeiter, ein Mann mittleren Alters, ist verblüfft. Er richtet sich auf und schiebt die Mütze ins Genick. Sicherlich denkt er, dass sich der da trotz allem ein bisschen zu sehr mit seinem Bengel hat. Dennoch sagt er gutmütig: "Na meinetwegen, rauch ich eben 'ne Zigarette."
Dan knurrt enttäuscht, als der Mann die Schaufel zur Seite stellt und ins Haus geht. Er lässt sich auch nicht sofort bewegen, seinen Beobachtungsposten aufzugeben. Doch nach zwei, drei Minuten, nach einiger Drängelei und gutem Zureden ist es geschafft. Da nichts mehr passiert, verliert er an Kellerluke und Kohlenhaufen das Interesse. Wolfram kann den Weg fortsetzen. Aber nicht immer wirken solche Tricks, und vor allem findet man nicht immer Leute, die bereit sind, dabei mitzuspielen.
5. Kapitel
Wie soll ich die Gefühle wiedergeben, die wir hatten, als sich unser Verdacht über Dans Hörschaden bestätigte. Die Diagnose in der Nordklinik traf uns hart, wir hatten nicht wirklich geglaubt, dass es so schlimm sein könnte. Aber die Ärztin hatte sich ja nicht endgültig festgelegt, vielleicht war es dennoch nur eine Schwerhörigkeit, und vielleicht ließ sich operativ etwas bessern. Wir hofften also und sprachen uns gegenseitig Mut zu. Wir waren noch naiv und ahnungslos. Wolf führte immer neue Beispiele der letzten Wochen an, aus denen zu schließen war: Dan bekam doch einiges übers Ohr mit. Wenn er nicht alles hörte, taub konnte er keinesfalls sein. Mein Mann versuchte mich auf diese Weise vom Weinen abzuhalten, von einer hemmungslosen Flennerei. Denn das weiß ich noch genau: In mir brannte alles. Ein Schmerz, der von ganz innen kam, der heiß in die Augen stieg und herausdrängte, ohne schwächer zu werden. Als wir bereits wieder in der Bahn saßen, sagte ich: "Stell dir vor, dass er vielleicht nie ein Tonband abhören kann nie eine Schallplatte." Eine Schallplatte - wenn ich heut daran denke, muss ich lachen. Als wäre dies das schrecklichste. Aber sie hatten uns ja gesagt, dass er sprechen lernen würde, und wer konnte schon vermuten, dass es für ihn so unsäglich schwer wurde, überhaupt Kontakt zur Umwelt aufzunehmen. Ich entsinne mich, wir diskutierten ausgiebig über seine Möglichkeiten, Musik zu hören, ich wischte mir mit Wolfs Taschentuch ständig die Augen, und gegen die Scheiben der S-Bahn klatschte der Regen. Dan aber ließ uns auch bei dieser Fahrt nicht in Ruhe. Er strampelte und kreischte, nach der Untersuchung war er noch aufgekratzter als sonst.
In den folgenden Wochen und Monaten versuchten wir Gewissheit zu erlangen, doch die Spezialisten waren selbst im Zweifel. Immer wieder fuhr ich mit Dan in die Zentralklinik, wo man uns bald kannte. Nochmalige Untersuchung der Ohren, audiometrische Tests, Schlafbeschallung, EEG. Wir saßen in überfüllten Wartezimmern, und Dan brachte mich mit seiner Quirligkeit in Bedrängnis. Was musste ich mir alles einfallen lassen, um ihn ein paar Minuten auf seinem Platz zu halten. Bilderbücher interessierten ihn nicht, ebensowenig Spielzeug, das für die Kinder bereitgestellt war: Bauklötzer, Holz- oder Plasteisenbahn, Plüschtiere. Das heißt, an manchen Tagen ging es etwas besser mit ihm, erst später kamen wir dahinter, dass das vielfach vom Wetter abhing. Von irgendwelchen Sturmböen und Kälteeinbrüchen. Noch heute reagiert er empfindlich auf Wetterveränderungen, kann unausstehlich sein, wenn fern aus dem Norden, Osten oder Westen eine Kaltfront heranzieht. Der Wetterbericht kündigt erst Tage später an, was er bereits im Kopf hat.
An günstigen Tagen konnte man eher mit ihm spielen, ihn aus kleinen bunten, verschieden geformten Steinen und Stäbchen Muster legen lassen, mit einem Bleistift Gitter ziehn oder Schlangen malen, die ihn beschäftigten. Mitunter entdeckte er auch eine Tätigkeit für sich, die er mit absonderlich hartnäckigem Eifer bis zur eigenen Verzweiflung betrieb; er wollte nicht mehr damit aufhören, obwohl er bereits vor Erschöpfung weinte. Einmal hatte ich in einer der Wartestunden in einem engen, unbequemen, überhitzten Zimmer nichts anderes zu seiner Ablenkung zur Verfügung als einen Bleistiftstummel und mein Notizbuch. Ohne große Hoffnung, ihn damit reizen zu können, holte ich beides aus der Manteltasche und begann ein Gesicht zu zeichnen. Das Dan, wie ich erwartet hatte, nicht interessierte. Ebenso wenig wie die Mischung zwischen Hund und Elefant, die ich danach zustande brachte. Ich versuchte es mit den gewohnten Gittern und Schlangen - Dan strebte von mir fort und mühte sich, die Gardine am einzigen Fenster des Raumes herunterzureißen. Ein Glück, dass er keine Schere in Reichweite hatte. Da kritzelte ich, mehr um mir Luft zu verschaffen, als um ihn zu beeindrucken, die Worte "Dan ist sehr böse" ins Notizbuch und hielt sie ihm vor die Nase. Mit verblüffendem Erfolg. Dan studierte diesen Satz, als verstehe er ihn und wolle ihn auswendig lernen. Plötzlich fasste er meine Hand und stieß sie aufs Papier: Ich sollte weiterschreiben. Ich kritzelte erneut ein paar Wörter hin. Er betrachtete sie weniger aufmerksam als die ersten, bedeutete mir aber, fortzufahren. Ich tat es, und schnell war die Seite voll. Beflügelt von meinem Erfolg blätterte ich um, schrieb weiter. Er schaute sich die Sätze längst nicht mehr an, gönnte mir aber dennoch keine Pause. Mit der Zeit begriff ich, dass es ihm nicht auf die Wörter ankam, sondern auf den Vorgang des Schreibens und darauf, dass die Blätter Linie um Linie gefüllt wurden. Das faszinierte ihn, ich musste das gesamte Notizbuch vollkritzeln. Eine Woche lang tat mir hinterher die Hand weh.
Heute, wenn ich junge Mütter seh und Väter, die ihre Kinder anbrüllen oder sogar schlagen, nur weil sie ein wenig unruhig sind, denke ich an unsere Aufenthalte in den Wartezimmern, an die überfüllten Korridore der Klinik. Jene ältere Frau fällt mir ein, die mich auf einer Eisenbahnfahrt ansprach; ich legte gerade wieder meine Muster für Dan. "Sie kennen aber schöne Spiele, haben Sie deswegen mal einen Kurs besucht?"
Nein, gute Frau, ich hätte nicht die Zeit gehabt, und mir ist auch nicht bekannt, dass es solche Kurse gibt. Aber Not macht eben erfinderisch, oder wie der Russe sagt: Nacktheit lässt sich allerhand einfallen.
Die Hörprüfungen brachten nicht die letzte Klarheit. Bei der Spielaudiometrie, wo es darum ging, nach Wahrnehmung bestimmter Töne bunte Knöpfe zu betätigen oder Klötzchen in einen Kasten zu werfen, verfuhr Dan allzu sehr nach Laune. Mitunter schien es der zuständigen Psychologin, als vernehme er eine ganze Menge, mitunter hatte sie den Eindruck, er bekomme gar nichts mit. "Einfach nichts zu machen, wahrscheinlich müssen wir noch ein Jahr warten." Eindeutiger fiel die Untersuchung der Ohren selbst aus. Das Trommelfell, Mittel- und Innenohr waren völlig intakt. Damit aber zerschlug sich die schwache Hoffnung, die wir nach dem Bescheid in der Nordklinik noch hatten, dass etwas mit einem operativen Eingriff zu beheben sei. Die Ursache des Schadens musste woanders liegen. Im Hirn, an einer Stelle, wo nichts zu reparieren war.
Doch auch das EEG, die Aufzeichnung der Hirnströme, war in Ordnung. "Das bedeutet", sagte Wolf, der im Medizinischen Wörterbuch nachgeschlagen hatte, um den genauen Sinn dieser Großbuchstaben herauszubekommen, "dass Dan keinen Tumor im Kopf hat, nicht zu epileptischen Anfällen neigt und so weiter."
"Und was steht da vom Hören?"
"Vom Hören nichts. Eben nur so allgemein, dass das Hirn richtig funktioniert. Ist doch wichtig."
Und ob das wichtig war. Bei einem Kind mit Sinnesschädigung ganz besonders.
EEGs wurden in Dans ersten Jahren mehrfach angefertigt, und jedes Mal war es für ihn und mich die gleiche Quälerei. Es begann mit dem Protokollieren seiner Krankengeschichte, die von Mal zu Mal länger wurde, setzte sich mit dem komplizierten Anbringen der Elektroden an seinem Kopf fort und ging dann in einen ununterbrochenen Kampf zwischen dem Jungen auf der einen, den Schwestern und mir auf der anderen Seite über. Die geplante Untersuchung ungefährdet über die Runden zu bringen war ein Kunststück. Dan wehrte sich entschieden dagegen, in ein Wesen mit zahllosen Tentakeln am Kopf verwandelt zu werden. Er weigerte sich, ruhig zu sitzen, hatte Angst und war andererseits auch neugierig. Er schielte nach oben und nach den Seiten, versuchte den Kopf zu drehen oder ruckte plötzlich mit dem ganzen Körper. Er wollte die Drähte fassen und nach Möglichkeit abreißen. Ich hielt ihn auf dem Schoß, redete ihm gut zu und suchte ihn durch Streicheln bei der Stange zu halten. Die Schwestern wurden nervös, was dem Projekt keineswegs diente. Eine halbe Stunde plagten wir uns ab und am Ende wusste ich nie, ob die Sache nun wirklich gelungen war.
Die EEGs zeigten nichts Ungewöhnliches, hellten aber auch nichts auf. Genauso wenig wie eine andere Untersuchungsmethode, die so genannte Schlafbeschallung. Zu ihrem Zweck sollte Dan in einem abgeschlossenen Raum zum Schlafen gebracht werden, ein Bemühen, dem wir von vornherein mit Skepsis begegneten. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten Wolf und ich schon mitbekommen, dass unser Kind nicht zu jenen friedlichen kleinen Erdenbürgern gehörte, für die das Leben vor allem aus Essen und Ausruhen besteht. Dan aß mäßig und schlief viel weniger, als es die einschlägigen Bücher für sein Alter vorsahen. Mit Neid blickte ich auf die Knirpse anderer Mütter, die in ihren Sportwagen mitten am Tag einfach so dahinschlummerten. Die in der einen Minute noch putzmunter übers Trottoir rannten, in der nächsten jedoch gleichmäßig atmend in ihren vierrädrigen Beförderungsmitteln lagen. Bei Sonne, Regen, Wind oder Graupelschauern. Meiner, wenn ihm wirklich mal die Augen zufielen, war fünf Minuten später wieder da. Als wollte er nichts vom Weltgeschehen verpassen. Auch abends schlief er schlecht ein, und morgens war er früh wach. Nicht viel später begann dann die Zeit, da er uns Nacht für Nacht aus dem Bett holte und stundenlang, oft sogar bis zum Morgen, wach blieb. Da er nur noch ein Nervenbündel war und wir weder aus noch ein wussten.