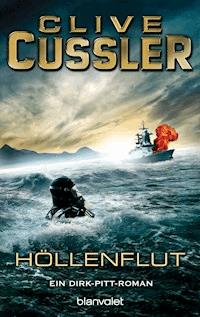
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dirk-Pitt-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Ein erholsamer Tauchgang endet mit einem Schock: Dirk Pitt entdeckt in den Tiefen des Orion Lake Hunderte von ermordeten Chinesen. Julia Lee, eine Sinoamerikanerin, die als verdeckte Ermittlerin für die US-Regierung arbeitet, bestätigt, was Dirk bereits ahnt. Seit langem dient dieser See einem der reichsten Männer der Welt als Stützpunkt: Qin Shang, der perfekt getarnte Geschäfte mit illegalen Einwanderern aus China macht. Als Dirk und Julia ihm zu nahe kommen, verwickelt er sie in einen tödlich raffinierten Plan ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 884
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Clive Cussler
Höllenflut
Roman
Übersetzt von Oswald Olms
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Flood Tide« bei
Simon & Schuster, Inc., New York.
1. Auflage
E-Book-Ausgabe 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der
Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 1997 by Clive Cussler
Copyright © der Originalausgabe 2007 by Sandecker RLLLP
All rights reserved throughout the world.
By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613, New York, NY 10176-0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1998 by
Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15208-6
www.blanvalet.de
Danksagung
Der Autor möchte an dieser Stelle den Frauen und Männern des Immigration and Naturalization Service seinen Dank für die großzügig zur Verfügung gestellten Daten und Statistiken über illegale Einwanderungen aussprechen.
Dank gilt auch dem Army Corps of Engineers für die Hilfe beim Beschreiben der Unwägbarkeiten von Mississippi und Atchafalaya River.
Und den vielen anderen Menschen für die Vorschläge und Ideen bezüglich der Hindernisse, die Dirk und Al überwinden müssen.
Requiem für eine Prinzessin
10. Dezember 1948
Unbekannte Gewässer
Die Wellen türmten sich tückisch auf und wurden mit jedem Windstoß wilder. Die See, die am Morgen noch so ruhig gewesen war, hatte sich bis zum späten Abend in ein tobendes Inferno verwandelt. Jetzt hingen schwarze Wolken über dem aufgewühlten Wasser, und ein peitschender Schneesturm trieb Gischtschwaden von den weißen Kämmen der Wogen, so dass man kaum noch zwischen Himmel und Meer unterscheiden konnte. Der Passagierdampfer Princess Dou Wan kämpfte sich durch die Wellen, die wie Berge aufragten, ehe sie über das Schiff hereinbrachen, doch die Männer an Bord ahnten nichts von dem drohenden Verhängnis, das sie nun jede Minute heimsuchen konnte.
Sturmböen aus Nordost und Nordwest peitschten die tosende See auf und erzeugten heftige Strömungen, die von zwei Seiten zugleich gegen das Schiff anbrandeten. Binnen kürzester Zeit erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von über hundertfünfzig Stundenkilometern, und die Wellen türmten sich bis zu zehn Meter hoch auf. Die Princess Dou Wan war diesem Mahlstrom schutzlos ausgesetzt. Ihr Bug tauchte ab und schnitt unter den Wogen hindurch, die über das offene Deck nach achtern spülten und wieder zurückfluteten, wenn sich das Heck weit über das Wasser hob. Sie stampfte und schlingerte unter der Gewalt der Elemente, die von allen Seiten über sie hereinbrachen, neigte sich zur Seite, bis die Steuerbordreling entlang des Promenadendecks in den kochenden Fluten verschwand. Dann richtete sie sich langsam, viel zu langsam und schwerfällig wieder auf und dampfte weiter durch den schlimmsten Sturm, der diese Gewässer seit Jahren heimgesucht hatte.
Ausgefroren und vom Schneesturm geblendet, zog sich Li Po, der zum Wachdienst eingeteilte Zweite Maat, ins Ruderhaus zurück und schlug die Tür zu. In den vielen Jahren, in denen er nun schon das chinesische Meer befuhr, hatte er manch heftigen Sturm erlebt, aber noch nie einen solchen Flockenwirbel. Po hielt es für ungerecht, dass die Götter derart verheerende Winde wider die Princess entfesselten, nachdem sie fast die halbe Welt umfahren hatte und keine zweihundert Meilen vom sicheren Hafen entfernt war.
Mit Ausnahme von Kapitän Leigh Hunt und dem leitenden Ingenieur drunten im Maschinenraum bestand die gesamte Besatzung aus Nationalchinesen. Hunt, ein alter Seebär, hatte zwölf Jahre bei der englischen Marine gedient und weitere achtzehn als Offizier bei drei verschiedenen Schifffahrtsgesellschaften, davon fünfzehn als Kapitän. Als Junge war er mit seinem Vater von Bridlington aus, einer Kleinstadt an der englischen Ostküste, zum Fischfang ausgefahren, bevor er als einfacher Matrose auf einem Frachter nach Südafrika angeheuert hatte. Er war ein schmächtiger Mann mit ergrauenden Haaren und bekümmertem Blick, der stets etwas geistesabwesend wirkte. Er hatte erhebliche Bedenken, ob sein Schiff in der Lage war, einen derartigen Sturm abzuwettern.
Zwei Tage zuvor hatte ihn ein Besatzungsmitglied auf einen Riss in der Rumpfwand an Steuerbord, unmittelbar hinter dem Schornstein, aufmerksam gemacht. Er hätte eine Monatsheuer dafür gegeben, wenn er ihn jetzt, da das Schiff unglaublichen Belastungen ausgesetzt war, genauer hätte untersuchen können. Widerwillig verscheuchte er den Gedanken. Bei Windgeschwindigkeiten von mehr als hundertfünfzig Stundenkilometern und einer tobenden See, die ein ums andere Mal über das Schiff hinwegspülte, wäre schon der Versuch der reinste Selbstmord gewesen. Er spürte es in den Knochen, dass sich die Princess in großer Gefahr befand, fand sich jedoch damit ab, dass ihr weiteres Schicksal nicht in seiner Hand lag.
Hunt starrte hinaus in das Schneetreiben, das die Fenster des Ruderhauses einhüllte. »Wie sieht’s mit der Vereisung aus, Mr. Po?«, sagte er zum Zweiten Maat, ohne sich umzudrehen.
»Nimmt rasch zu, Käpt’n.«
»Glauben Sie, wir laufen Gefahr zu kentern?«
Li Po schüttelte langsam den Kopf. »Noch nicht, Sir, aber bis morgen früh könnte sich die Last auf Decks und Aufbauten als kritisch erweisen, wenn wir schwere Schlagseite bekommen.«
Hunt dachte einen Moment nach, dann wandte er sich an den Rudergänger. »Bleiben Sie auf Kurs, Mr. Tsung. Halten Sie den Bug in Wind- und Wellenrichtung.«
»Aye, Sir«, erwiderte der chinesische Steuermann, der breitbeinig dastand und das Messingruder mit beiden Händen festhielt.
Hunt musste wieder an den Riss in der Rumpfwand denken. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann die Princess Dou Wan zum letzten Mal zu einer ordentlichen Inspektion im Trockendock gewesen war. Die Besatzung schien sich seltsamerweise nicht die geringsten Sorgen wegen der verrosteten Rumpfplatten und der losen oder fehlenden Nieten zu machen, und offenbar störte sich auch niemand daran, dass die Lenzpumpen wegen des eindringenden Wassers ständig auf Hochtouren liefen. Der Rumpf, angegriffen und verwittert wie er war, war die eigentliche Schwäche der Princess. Ein Schiff gilt im Allgemeinen als alt, wenn es zwanzig Jahre lang die Ozeane durchpflügt hat. Die Princess indessen hatte Hunderttausende von Seemeilen zurückgelegt, hatte oftmals schwere See und manch einen Taifun überstanden, seit sie vor fünfunddreißig Jahren die Werft verlassen hatte. Es grenzte fast an ein Wunder, dass sie überhaupt noch schwamm.
Bei Harland & Wolff für die Singapore Pacific Steamship Lines gebaut, war sie 1913 vom Stapel gelaufen und auf den Namen Lanei getauft worden. Sie hatte eine Bruttotonnage von 10 758, eine Gesamtlänge von 151 Metern und war achtzehn Meter breit. Ihre Dreifach-Expansionsdampfmaschinen leisteten fünftausend Pferdestärken, die auf zwei Schrauben übertragen wurden. In ihrer besten Zeit machte sie beachtliche siebzehn Knoten. Bis zum Jahr 1931 war sie zwischen Singapur und Honolulu verkehrt, war dann an die Canton Lines verkauft und in Princess Dou Wan umgetauft worden. Nach einer Umrüstung war sie als Passagier- und Frachtschiff im gesamten südostasiatischen Raum eingesetzt worden.
Im Zweiten Weltkrieg war sie von der australischen Regierung beschlagnahmt und zum Truppentransporter umgebaut worden. Im Konvoidienst durch japanische Luftangriffe schwer beschädigt, war sie nach dem Krieg an die Canton Lines zurückgegeben worden. Eine Zeitlang war sie im Kurzstreckeneinsatz zwischen Schanghai und Hongkong verkehrt, bis sie im Frühjahr 1948 an ein Abwrackunternehmen in Singapur verkauft worden war.
Sie verfügte über fünfundfünfzig Kabinenplätze für Passagiere der ersten Klasse, fünfundachtzig Unterkünfte in der zweiten und dreihundertsiebzig in der dritten Klasse. Normalerweise zählte die Besatzung hundertneunzig Mann, doch auf dieser Fahrt, die ihre letzte sein sollte, waren lediglich achtunddreißig Seeleute an Bord.
Für Hunt war sein altes Schiff eine winzige Insel inmitten einer stürmischen See, in einen Kampf verstrickt, von dem niemand Notiz nahm. Sein Schicksal kümmerte ihn nicht. Er war bereit für den letzten Landgang, und die Princess gehörte längst ins Abwrackdock. Hunt hatte regelrecht Mitleid mit seinem schlachterprobten Schiff, das sich wacker gegen den wütenden Sturm stemmte. Die Princess krängte und ächzte, wenn die mächtigen Sturzseen über sie hinwegspülten, aber sie richtete sich immer wieder auf und rammte den Bug in die nächste Woge hinein. Hunts einziger Trost war, dass ihre ausgeleierten alten Maschinen bislang noch keinen Takt ausgesetzt hatten.
Drunten im Maschinenraum war das Knacken und Ächzen im Rumpf viel lauter – ungewöhnlich laut. Rostflocken lösten sich von den Schotten und segelten herunter, und das eingedrungene Wasser sickerte bereits durch die Gitterroste der Laufgänge. Nieten, welche die Stahlplatten zusammengehalten hatten, platzten ab und schossen durch die Luft. Normalerweise ließ sich die Besatzung dadurch nicht aus der Ruhe bringen, denn auf Schiffen, die zu einer Zeit gebaut worden waren, als auf den Werften noch nicht geschweißt wurde, war das etwas Alltägliches. Ein Mann jedoch bekam es mit der Angst zu tun.
Chefmaschinist Ian »Hongkong« Gallagher, ein trinkfester, breitschultriger Ire mit rotem Gesicht und mächtigem Schnurrbart, wusste die Zeichen zu deuten, und ihm war klar, dass das Schiff jeden Moment auseinanderbrechen konnte. Doch er verdrängte seine Angst und dachte in aller Ruhe darüber nach, wie er überleben könnte.
Ian Gallagher war als elfjähriger Waisenknabe dem Elendsviertel von Belfast entronnen und als Schiffsjunge zur See gefahren. Weil er eine besondere Begabung im Umgang mit Dampfmaschinen zeigte, wurde er zunächst zum Putzen und Abschmieren eingesetzt und schließlich zum dritten Hilfsmaschinisten ernannt. Mit siebenundzwanzig besaß er ein Patent als Chefmaschinist und fuhr auf allerlei Trampschiffen, die zwischen den Inseln des Südpazifik verkehrten. Den Beinamen »Hongkong« hatte er bekommen, nachdem er sich in einer Kneipe der gleichnamigen Hafenstadt eine sehenswerte Schlägerei mit acht chinesischen Schauermännern geliefert hatte, die ihn aufmischen wollten. Im Sommer 1945, als er dreißig geworden war, hatte er auf der Princess Dou Wan angeheuert.
Mit grimmiger Miene wandte sich Gallagher an Chu Wen, den Zweiten Maschinisten. »Geh nach oben, zieh dir ’ne Schwimmweste an und halt dich bereit, wenn der Kapitän den Befehl zum Verlassen des Schiffes gibt.«
Der chinesische Maschinist nahm den Zigarrenstumpen aus dem Mund und schaute Gallagher prüfend an. »Du meinst, wir gehen unter?«
»Ich weiß, dass wir untergehen«, erwiderte Gallagher entschieden. »Der alte Rostkübel steht das keine Stunde mehr durch.«
»Hast du dem Kapitän Bescheid gesagt?«
»Der müsste ja blind und taub sein, wenn er da nicht von selber draufkommt.«
»Also los, kommst du?«, fragte Chu Wen.
»Gleich«, antwortete Gallagher.
Chu Wen wischte die öligen Hände an einem Lappen ab, nickte dem Chefmaschinisten zu und stieg über eine Leiter zu einer Luke empor, die auf die Oberdecks führte.
Gallagher warf einen letzten Blick auf seine geliebten Maschinen, die seiner Überzeugung nach schon bald in der Tiefe versinken würden. Er zuckte zusammen, als ein ungewöhnlich lautes und schrilles Ächzen durch den Rumpf hallte. Die stählernen Bauteile der betagten Princess Dou Wan gaben nach – eine Folge der Materialermüdung, von der Flugzeuge ebenso heimgesucht werden wie Schiffe. In ruhigem Fahrwasser war so etwas außerordentlich schwer festzustellen, aber umso deutlicher machte es sich bemerkbar, wenn das Schiff rauer See ausgesetzt war. Und selbst wenn die Princess neu gewesen wäre, hätten sie die Wellen, die mit vielen Tausend Tonnen Wucht gegen ihren Rumpf brandeten, in schwere Bedrängnis gebracht.
Gallagher blieb beinahe das Herz stehen, als er einen Riss im Schott sah, der erst nach unten verlief, sich dann quer über die Rumpfplatten zog und von Backbord nach Steuerbord immer breiter wurde. Er griff zum Bordfernsprecher und rief die Brücke.
Li Po meldete sich. »Brücke.«
»Geben Sie mir den Käpt’n«, versetzte Gallagher.
Es dauerte einen Moment. »Hier spricht der Kapitän.«
»Sir, hier unten im Maschinenraum ist ein Riesenriss im Rumpf, und er wird zusehends größer.«
Hunt war wie vom Donner gerührt. Er hatte wider besseres Wissen gehofft, dass sie es bis zum Hafen schaffen würden, ehe die Schäden überhandnahmen. »Dringt Wasser ein?«
»Die Pumpen werden nicht mehr damit fertig.«
»Besten Dank, Mr. Gallagher. Können Sie die Maschinen in Gang halten, bis wir Land sichten?«
»Wie lange wird das Ihrer Meinung nach dauern?«
»In etwa einer Stunde sollten wir ruhigeres Fahrwasser erreichen.«
»Ich glaube nicht«, sagte Gallagher. »Ich geb ihr allenfalls noch zehn Minuten.«
»Besten Dank«, entgegnete Hunt bedrückt. »Verlassen Sie lieber den Maschinenraum, solange es noch geht.«
Müde legte Hunt den Hörer auf, drehte sich um und blickte durch die Fenster des Ruderhauses achteraus. Das Schiff hatte mittlerweile merklich Schlagseite und krängte heftig. Zwei Rettungsboote waren bereits zertrümmert und über Bord gespült worden. Die nächstbeste Küste anzulaufen und das Schiff auf Grund zu setzen kam jetzt nicht mehr in Frage. Wenn er das Schiff in ruhigeres Fahrwasser bringen wollte, musste er nach Steuerbord beidrehen. Aber sobald die Princess den anbrandenden Wogen die Breitseite darbot, war sie verloren. Allzu leicht könnte sie dabei in ein Wellental geraten, aus dem sie nie wieder auftauchen würde. Ob das Schiff dabei nun auseinanderbrach oder wegen der immer dicker und schwerer werdenden Eisschicht auf seinen Aufbauten kenterte, spielte keine Rolle – zum Untergang war es auf jeden Fall verdammt.
Er dachte kurz daran, wie alles angefangen hatte, vor dreißig Tagen und zehntausend Meilen weit weg. An einem Kai am Jangtse in Schanghai waren die Salons und Kabinen der Princess Dou Wan ausgeschlachtet worden, bevor sie ihre letzte Fahrt zum Abwrackdock in Singapur antreten sollte. Das Auslaufen hatte sich zunächst verzögert, als General Kung Hui von der nationalchinesischen Armee in einem Packard am Kai vorgefahren war und Kapitän Hunt zu einem Gespräch in seine Limousine beordert hatte.
»Ich bitte um Verzeihung, Kapitän, aber ich muss Sie auf persönliche Anweisung von Generalissimus Tschiang Kai-schek in die Pflicht nehmen.« General Kung Hui saß da wie aus dem Ei gepellt – Haut und Hände glatt und weiß wie ein Blatt Papier, die Uniform tadellos und ohne jede Knitterfalte. Er nahm die gesamte Rückbank in Beschlag, so dass Kapitän Hunt mit dem unbequemen Notsitz vorliebnehmen musste. »Ihr Schiff wird für eine lange Fahrt benötigt. Ich erteile Ihnen hiermit den Befehl, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen.«
»Da muss ein Irrtum vorliegen«, sagte Hunt. »Für lange Strecken ist die Princess nicht mehr geeignet. Wir haben nur eine Notbesatzung an Bord, weil wir grade zum Abwracken fahren wollten, und unser Treibstoff und die Vorräte reichen nur bis Singapur.«
»Singapur können Sie getrost vergessen«, sagte Hui, während er blasiert mit der Hand wedelte. »Wir werden Ihnen reichlich Treibstoff und Verpflegung zur Verfügung stellen, dazu zwanzig Mann von unserer Marine. Sobald Ihre Fracht an Bord ist …«, Hui hielt einen Moment inne, steckte eine Zigarette in einen langen Halter und zündete sie an, »… in etwa zehn Tagen also, würde ich meinen, erhalten Sie Befehl zum Auslaufen.«
»Ich muss das mit meiner Reederei klären«, wandte Hunt ein.
»Die Direktoren der Canton Lines sind bereits davon verständigt, dass die Princess Dou Wan vorübergehend von der Regierung beschlagnahmt ist.«
»Waren sie damit einverstanden?«
Hui nickte. »Da ihnen der Generalissimus eine großzügige Vergütung in Gold anbot, waren sie überaus entgegenkommend.«
»Wie geht es weiter, wenn wir unseren oder, besser gesagt, Ihren Bestimmungsort erreicht haben?«
»Sobald die Fracht sicher an Land gebracht ist, können Sie Ihre Reise nach Singapur fortsetzen.«
»Darf ich fragen, wohin die Fahrt geht?«
»Dürfen Sie nicht.«
»Und welche Fracht befördern wir?«
»Der gesamte Einsatz steht unter strengster Geheimhaltung. Von diesem Augenblick an werden Sie und Ihre Besatzung an Bord des Schiffes bleiben. Niemand darf mehr an Land. Sie werden keinerlei Kontakt zu Angehörigen oder Freunden aufnehmen. Meine Männer werden das Schiff Tag und Nacht bewachen und für seine Sicherheit sorgen.«
»Verstehe«, sagte Hunt, aber er verstand gar nichts. Er konnte sich nicht entsinnen, jemals so verschlagene Augen gesehen zu haben.
»Während wir hier miteinander reden«, sagte Hui, »werden sämtliche Fernmeldeeinrichtungen auf Ihrem Schiff entweder entfernt oder zerstört.«
Hunt war sprachlos. »Sie erwarten doch sicher nicht, dass ich ohne ein Funkgerät in See steche? Was ist, wenn wir in Schwierigkeiten geraten und einen Notruf senden müssen?«
Hui hielt den Zigarettenhalter hoch und musterte ihn beiläufig. »Ich erwarte keinerlei Schwierigkeiten.«
»Sie sind ein Optimist, General«, sagte Hunt bedächtig. »Die Princess ist ein müdes, altes Schiff. Sie hat ihre beste Zeit längst hinter sich und ist schlecht gerüstet für schwere See und heftige Stürme.«
»Ich kann Sie nur auf die Bedeutung dieses Unternehmens hinweisen und auf den Lohn, der Ihnen zuteilwerden wird, wenn wir es erfolgreich ausführen. Generalissimus Tschiang Kai-schek wird Sie und Ihre Besatzung großzügig mit Gold entschädigen, sobald Sie unseren Bestimmungshafen sicher erreicht haben.«
Hunt starrte aus dem Fenster der Limousine auf den rostigen Rumpf seines Schiffes. »Ein Haufen Gold nützt mir nicht viel, wenn ich am Meeresgrund liege.«
»Dann werden wir auf ewig nebeneinander ruhen.« General Hui lächelte verkniffen. »Ich komme nämlich als Passagier mit.«
Kapitän Hunt erinnerte sich an das hektische Treiben, das binnen kürzester Zeit rund um die Princess ausgebrochen war. Dieselöl wurde in den Schiffsbauch gepumpt, bis die Tanks voll waren. Der Schiffskoch wunderte sich nur noch über die Menge und die Qualität der Lebensmittel, die an Bord gebracht und in der Kombüse verräumt wurden. Draußen auf dem Kai rückte unterdessen ein steter Strom von Lastwagen an, die allesamt unter den riesigen Kränen anhielten. Ihre Ladung, große Holzkisten, wurde auf das Schiff gehievt und in den Frachträumen verstaut, die bald bis oben voll waren.
Und es kamen immer noch mehr Lastwagen. Kisten, die so klein waren, dass zwei Männer sie tragen konnten, wurden in den ausgeräumten Passagierkabinen, auf den Gängen und in jedem verfügbaren Freiraum unter Deck verstaut. Alle Winkel waren bis obenhin vollgestapelt. Die letzten sechs Lastwagenladungen wurden auf dem Promenadendeck verzurrt, wo einst Passagiere herumgeschlendert waren. General Hui kam zuletzt an Bord, begleitet von einer Schar schwerbewaffneter Offiziere. Sein Gepäck bestand aus zehn Überseekoffern und dreißig Kisten voller edlem Wein und Cognac.
Alles vergebens, dachte Hunt. Kurz vor dem Zieleinlauf von Mutter Natur besiegt. Die ganze Geheimnistuerei, all die Täuschungsmanöver waren umsonst gewesen. Die Funkstille zum Beispiel, die sie seit dem Auslaufen aus dem Jangtse hielten. Die ganze Zeit war die Princess einsam durch das Meer gepflügt und hatte nicht einmal die Funksprüche vorbeifahrender Schiffe beantworten können.
Der Kapitän warf einen Blick auf das Radargerät, das unlängst eingebaut worden war. Kein anderes Schiff im Umkreis von fünfzig Meilen. Außerdem konnte sie sowieso niemand retten, weil sie keinen Notruf absetzen konnten. Er blickte auf, als General Hui unsteten Schrittes ins Ruderhaus trat. Er war kreidebleich und hielt sich ein schmutziges Taschentuch an den Mund.
»Seekrank, General?«, fragte Hunt spöttisch.
»Dieser verdammte Sturm«, murmelte Hui. »Hört der denn nie mehr auf?«
»Wir hatten eine Vorahnung, Sie und ich.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Dass wir auf ewig nebeneinander auf dem Meeresgrund ruhen werden. Wird nicht mehr lange dauern.«
Gallagher stürmte nach oben, stützte sich am Handlauf ab und rannte den Gang entlang zu seiner Kabine. Trotz aller Eile war er ruhig und gefasst. Er wusste genau, was er tun musste. Die Tür hatte er wie immer vorsichtshalber abgesperrt, aber diesmal fummelte er nicht lange nach dem Schlüssel, sondern trat sie kurzerhand ein.
Eine Frau mit langen, blonden Haaren ruhte, in einen seidenen Morgenrock gehüllt, auf dem Bett und las eine Illustrierte. Erschrocken blickte sie auf, als er hereinplatzte. Der Dackel, der zu ihren Füßen gelegen hatte, sprang hoch und kläffte los. Die Frau war schlank und wohlgestaltet, hatte klassische Züge und einen makellosen Teint, und ihre Augen strahlten so blau wie der Himmel an einem Herbstmorgen. Wenn sie aufrecht stand, reichte sie Gallagher bis knapp unters Kinn. Anmutig setzte sie sich auf und schwang die Beine über die Bettkante.
»Komm schon, Katie.« Er packte sie am Handgelenk und zerrte sie hoch. »Wir haben herzlich wenig Zeit.«
»Laufen wir schon im Hafen ein?«, fragte sie verdutzt.
»Nein, mein Schatz. Das Schiff kann jeden Moment untergehen.«
Sie schlug die Hand vor den Mund. »O Gott!«, keuchte sie.
Gallagher riss sämtliche Schranktüren auf, zog die Schubladen heraus und warf ihr ein Kleidungsstück nach dem andern zu. »Zieh dir so viele Sachen an, wie du übereinander kriegst – all deine Hosen, Socken von mir. Zieh das Zeug schichtweise übereinander, zuerst die dünnen, dann die dicken Sachen, und mach schnell. Der alte Kahn kann jeden Moment absaufen.«
Die Frau blickte kurz auf, so als wollte sie aufbegehren. Dann streifte sie schweigend den Morgenrock ab und zog ihre Unterwäsche an. Sie ging rasch und methodisch vor, schlüpfte erst in ihre Hose und dann in eine von Gallagher. Sie zog drei Blusen an und darüber fünf Strickpullover. Gott sei Dank hatte sie zum Rendezvous mit ihrem Verlobten einen ganzen Koffer voller Kleidung mitgenommen. Als sie in nichts mehr hineinpasste, stopfte sie Gallagher in einen seiner alten Overalls und streifte ihr noch etliche Socken und ein Paar Arbeitsstiefel über die Seidenstrümpfe.
Der kleine Dackel hüpfte aufgeregt und mit wedelnden Ohren zwischen ihren Beinen auf und ab. Er war ein Verlobungsgeschenk von Gallagher, ebenso wie der Smaragdring, den er ihr überreicht hatte, als er um ihre Hand anhielt. Am roten Lederhalsband des Hundes hing ein goldenes Drachenmedaillon, das wie wild an seiner Brust hin und her pendelte.
»Fritz!«, herrschte sie ihn an. »Leg dich aufs Bett und sei still.«
Katrina Garin war eine willensstarke Frau, der man nicht alles haarklein erklären musste. Sie war gerade zwölf, als ihr Vater, ein Brite, der als Kapitän auf einem Trampschiff zwischen den Inseln hin und her fuhr, auf See verschollen war. Sie wuchs bei der weißrussischen Familie ihrer Mutter auf, fing als Schreibkraft bei den Canton Lines an und arbeitete sich bis zur Chefsekretärin hoch. Sie war so alt wie Gallagher, den sie in der Niederlassung der Schifffahrtsgesellschaft kennengelernt hatte, wohin er zitiert worden war, um über den Zustand der Princess Dou Wan Bericht zu erstatten. Er gefiel ihr. Zwar hätte sie einen Mann mit etwas mehr Eleganz und Lebensart vorgezogen, aber seine rauen Umgangsformen und die leutselige Art erinnerten sie an ihren Vater.
In den folgenden Wochen hatten sie sich häufig getroffen und miteinander geschlafen, zumeist in seiner Kabine an Bord des Schiffes, denn sie fand es besonders erregend, wenn sie heimlich an Bord schlichen und sich miteinander vergnügten, ohne dass der Kapitän und die Besatzung Wind davon bekamen. Katie hatte in der Falle gesessen, als General Huis Wachmannschaften Schiff und Kai abgeriegelt hatten. Kapitän Hunt war zunächst ungehalten gewesen, als er von ihrer Anwesenheit erfuhr, hatte dann aber ebenso wie Gallagher darum gebeten, man möge sie an Land gehen lassen. Doch General Hui hatte darauf beharrt, dass sie bis zum Ende der Reise an Bord bleiben müsse. Seitdem sie aus Schanghai ausgelaufen waren, hatte sie kaum die Kabine verlassen. Wenn Gallagher Dienst im Maschinenraum hatte, war der kleine Hund, dem sie zum Zeitvertreib allerlei Kunststücke beigebracht hatte, ihr einziger Gefährte.
Gallagher packte in aller Eile ihre Papiere, Pässe und Wertsachen in einen wasserdichten Öltuchbeutel. Er zog eine schwere Seemannsjacke über und warf ihr mit seinen blauen Augen einen besorgten Blick zu. »Bist du fertig?«
Sie hob die Arme und blickte hinab auf ihren dick eingepackten Körper. »Mit dem ganzen Zeug passe ich nie und nimmer in eine Schwimmweste«, sagte sie mit bebender Stimme. »Und ohne versink ich wie ein Stein im Wasser.«
»Hast du nicht was vergessen? General Hui hat vor vier Wochen den Befehl erteilt, sämtliche Schwimmwesten über Bord zu werfen.«
»Dann nehmen wir eben ein Rettungsboot.«
»Bei dieser See kann man kein Boot zu Wasser lassen, soweit es der Sturm nicht ohnehin schon zertrümmert hat.«
Ruhig und mit stetem Blick schaute sie ihn an. »Wir werden sterben, nicht wahr? Entweder ertrinken wir, oder wir erfrieren.«
Er setzte ihr eine Strickmütze auf und zog sie bis über die Ohren herunter. »Wenn einem obenrum warm ist, kriegt man keine kalten Füße.« Dann nahm er ihren Kopf in seine mächtigen Pranken, zog ihr Gesicht zu sich und küsste sie. »Liebes, hat dir noch nie einer erzählt, dass Iren nicht ertrinken?« Damit nahm Gallagher Katie an der Hand, zog sie ohne viel Federlesens auf den Gang und stieg mit ihr an Deck.
Fritz, der Dackel, der in dem ganzen Tohuwabohu vergessen wurde, blieb gehorsam auf dem Bett liegen, sah ihnen verwundert nach und verließ sich darauf, dass seine Herrin bald zurückkommen werde.
Die Besatzungsmitglieder, die keinen Dienst taten, schliefen tief und fest in ihren Kojen, soweit sie nicht beim Dominospiel saßen oder einander Geschichten von allerlei Stürmen erzählten, die sie bereits überlebt hatten. Keinem war bewusst, dass die Princess jeden Moment auseinanderbrechen konnte. Der Koch und sein Gehilfe räumten nach dem Abendessen die Kombüse auf und bereiteten nebenher Kaffee für die verbliebenen Männer zu. Die Besatzung war trotz des tobenden Sturmes frohgemut, denn allzu weit konnte es bis zum Zielhafen nicht mehr sein. Sie wussten zwar nicht, wohin die Reise ging, aber ihre Position kannten sie auf dreißig Meilen genau.
Ganz anders war die Stimmung im Ruderhaus. Hunt schaute achteraus, obwohl er durch das dichte Schneetreiben kaum die Decksbeleuchtung erkennen konnte. Gebannt und voller Entsetzen beobachtete er, wie sich mit einem Mal das Heck hob und nach mittschiffs hin wegknickte. Über das Heulen des Sturmes hinweg hörte er das reißende Kreischen, als der Stahlrumpf auseinanderbarst. Er drückte auf den Notrufknopf und löste Alarm im Schiff aus.
Hui schlug seine Hand vom Klingelknopf. »Wir dürfen das Schiff nicht verlassen.« Er flüsterte vor Schreck.
Hunt musterte ihn mit angewidertem Blick. »Sterben Sie wie ein Mann, General.«
»Ich darf noch nicht sterben. Ich habe geschworen, dass ich die Fracht sicher zum Zielhafen geleite.«
»Das Schiff bricht entzwei«, sagte Hunt. »Es gibt keine Rettung mehr, weder für Sie noch für Ihre kostbare Fracht.«
»Dann müssen Sie sofort unsere genaue Position bestimmen, damit man sie später bergen kann.«
»Für wen sollen wir die denn bestimmen? Die Rettungsboote sind weggerissen oder zertrümmert. Unsere Schwimmwesten haben Sie über Bord werfen lassen. Sie haben das Funkgerät des Schiffes zerstört. Wir können nicht mal ein SOS senden. Sie haben es mit den Sicherheitsvorkehrungen übertrieben. Niemand vermutet uns in diesen Gewässern. Keine Menschenseele kennt unsere Position. Tschiang Kai-schek wird lediglich erfahren, dass die Princess Dou Wan sechstausend Meilen südlich von hier mit Mann und Maus verschollen ist. Sie haben dies viel zu gut geplant, General.«
»Nein!«, stieß Hui aus. »Das darf nicht sein!«
Hunt stellte fest, dass ihn Huis Miene hilflosen Zornes regelrecht amüsierte. Die dunklen Augen wirkten jetzt ganz und gar nicht mehr verschlagen.
Der General konnte sich nicht mit dem Unabänderlichen abfinden. Er riss die Tür zur Brückennock auf und rannte hinaus in den tosenden Sturm. Selbst er erkannte jetzt, dass sich das Schiff im Todeskampf befand. Das Heck stand mittlerweile schräg zum Vorderteil. Dampf drang aus dem Riss im Rumpf. Wie versteinert stand er da, betäubt von dem Kreischen und Mahlen und Reißen des Metalls, und sah zu, wie der hintere Teil des Schiffes abbrach. Dann gingen sämtliche Lichter an Bord aus, so dass er das Heck nicht mehr erkennen konnte.
Die Besatzung stürmte von unten auf das mit Schnee und Eis überzogene Deck. Die Männer fluchten über die fehlenden Schwimmwesten, zumal sie zu ihrer Erbitterung feststellen mussten, dass die mörderischen Wellen die Rettungsboote zertrümmert hatten. Das Ende kam so rasch, dass keiner darauf vorbereitet war. Um diese Jahreszeit lag die Wassertemperatur knapp über dem Gefrierpunkt, und die Luft war mit fünfzehn Grad minus klirrend kalt. Von Panik erfüllt, sprangen sie über Bord, ohne sich bewusst zu sein, dass sie in dem eisigen Wasser innerhalb weniger Minuten sterben würden, wenn nicht an Unterkühlung, dann an Herzversagen aufgrund des jähen Temperaturunterschieds.
Das Heck versank in weniger als vier Minuten. Mitschiffs schien sich der Rumpf einfach aufzulösen, so dass zwischen dem weggebrochenen Heck und dem Vorschiff mit dem Schornstein ein großes Loch klaffte. Ein kleiner Trupp Männer versuchte ein nur teilweise beschädigtes Rettungsboot zu Wasser zu lassen, doch eine mächtige Woge ergoss sich über das Vorschiff und fegte tosend über das Deck hinweg. Männer und Boot verschwanden auf Nimmerwiedersehen in den Fluten.
Gallagher hielt Katies Hand mit eisernem Griff fest. Er zerrte sie eine Leiter hoch und über das Dach der Offizierskajüten zu einem hinter dem Ruderhaus vertäuten Rettungsfloßs. Zu seinem Erstaunen stellte er fest, dass es leer war. Zweimal rutschten sie auf dem vereisten Dach aus und fielen hin. Die vom Sturm aufgewirbelte Gischt brannte ihnen im Gesicht und blendete sie. Im allgemeinen Durcheinander hatte offenbar keiner der chinesischen Offiziere oder der Besatzung an das Rettungsfloß auf dem Dach gedacht. Die Mehrzahl, darunter auch General Huis Soldaten, war zu dem verbliebenen Rettungsboot gestürzt oder in das mörderische Wasser gesprungen.
»Fritz!«, rief Katie plötzlich gequält. »Wir haben Fritz in der Kabine vergessen.«
»Keine Zeit zum Umkehren«, sagte Gallagher.
»Wir können nicht ohne ihn weg!«
Er schaute sie mit ernstem Blick an. »Du musst Fritz vergessen. Entweder er oder wir.«
Katie wand sich in seiner Hand, doch er ließ sie nicht los. »Steig rein, Liebes, und halt dich fest.« Dann zog er ein Messer aus seinem Stiefel und durchtrennte hastig die Taue, mit denen das Floß festgezurrt war. Beim letzten Seil hielt Gallagher einen Moment lang inne und warf einen Blick durch das Fenster des Ruderhauses. Im fahlen Schein der Notbeleuchtung sah er Kapitän Hunt, der ruhig neben dem Ruder stand und auf den Tod wartete.
Gallagher winkte seinem Kapitän wie wild zu, doch Hunt drehte sich nicht um. Er schob lediglich die Hände in die Jackentaschen und starrte in den Schnee, der sich rund um die Fenster auftürmte.
Plötzlich tauchte auf der Brücke eine Gestalt auf, die sich durch das wirbelnde weiße Schneegestöber kämpfte. Der torkelt ja, als wären die Furien hinter ihm her, dachte Gallagher. Der Neuankömmling rannte gegen das Floß, blieb mit den Knien hängen und stürzte hinein. Erst als er das Gesicht hob und sie mit einem Blick anstarrte, aus dem eher Wahnwitz denn Entsetzen sprach, erkannte Gallagher General Hui.
»Müssen wir das Floß nicht losmachen?«, rief Hui durch den heulenden Wind.
Gallagher schüttelte den Kopf. »Das hab ich schon erledigt.«
»Der Sog des sinkenden Schiffes wird uns in die Tiefe reißen.«
»Nicht bei diesem Seegang, General. Wir werden im Nu abgetrieben. Legen Sie sich jetzt auf den Boden und halten Sie sich gut an den Sicherungsleinen fest.«
Hui, der von der Kälte zu benommen war, als dass er hätte antworten können, tat wie geheißen und nahm seinen Platz im Floß ein.
Ein tiefes Grollen drang von unten herauf, als das kalte Wasser in den Maschinenraum einbrach und die Kessel platzten. Das Vorschiff zitterte und bebte, kippte dann hintenüber, so dass der Bug in die kalte Nacht aufragte. Die Stahltrossen, die den altmodischen Schornstein hielten, rissen unter der übergroßen Last, worauf er klatschend in den Fluten versank. Das Wasser stand jetzt bis zum Kajütendach, leckte um die Schwimmkörper des Floßes und hob es aus seiner Verankerung. Gallagher warf einen letzten Blick auf Kapitän Hunt, um dessen Beine bereits die Fluten wirbelten. Er stand da, wie aus Granit gehauen, und hielt das Ruder fest, entschlossen, mit seinem Schiff unterzugehen.
Gallagher kam es vor, als wäre die Zeit stehengeblieben. Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis das Schiff unter dem Floß versank. Doch all das geschah binnen weniger Sekunden. Dann wurde das Floß weggespült und in die tosende See geschleudert.
Rundum gellten Hilfeschreie in Mandarin und Kantonesisch, doch sie konnten nicht darauf eingehen. Und allmählich erstarben die flehentlichen Rufe im Donner der gigantischen Wogen und im Brausen des Windes. Es gab keine Rettung. Weit und breit war kein Schiff, auf dessen Radarschirm man ihren Untergang hätte bemerken können, und ein Notruf war auch nicht abgesetzt worden. Gallagher und Katie sahen voller Grauen zu, wie sich der Bug immer höher aufrichtete, als ob er dem Sturmwind drohen wollte. Fast eine Minute lang stand das Schiff, das mit seinen eisverkrusteten Aufbauten wie eine Erscheinung wirkte, steil aufragend da. Dann ergab es sich in sein Schicksal und versank in den schwarzen Fluten. Die Princess Dou Wan war untergegangen.
»Dahin«, murmelte Hui, dessen Worte im Wind verwehten. »Alles dahin.« Fassungslos starrte er auf die See, in der das Schiff verschwunden war.
»Kuschelt euch zusammen und haltet euch gegenseitig warm«, befahl Gallagher. »Wenn wir bis morgen früh durchhalten, fischt uns vielleicht jemand auf.«
Im nächsten Moment wurde das Floß mitsamt seiner bedauernswerten Besatzung vom erbarmungslosen Sturm davongerissen und verschwand in der eiskalten einsamen Nacht.
In der Morgendämmerung hämmerten die tückischen Wogen noch immer an das kleine Floß. Der Himmel war jetzt gespenstisch grau und mit dunklen Wolken bedeckt. Der dichte Flockenwirbel war in einen eisigen Schneeregen übergegangen. Der Wind hatte gottlob deutlich nachgelassen, und die Wellen wogten nur mehr drei Meter hoch. Das Floß war zwar fest und stabil, doch es verfügte über keinerlei Notfallausrüstung. Bis Rettung nahte, waren die Insassen allein auf ihre innere Kraft angewiesen.
Dank der vielen Kleiderschichten überstanden Gallagher und Katie die Nacht halbwegs. Aber General Hui, der nur seine Uniform trug und nicht einmal einen Mantel übergezogen hatte, erfror langsam. Der beißende Wind schnitt wie tausend Nadeln durch das dünne Tuch. Seine Haare waren mit Eis überkrustet. Gallagher hatte seine schwere Seemannsjacke ausgezogen und sie Hui gegeben, aber Katie wurde rasch klar, dass der alte Soldat bald sein Leben aushauchen würde.
Das Floß wurde über die Wellenkämme geschleudert und von der Wucht der Wogen herumgewirbelt. Unwahrscheinlich, dass es dem Toben der Elemente noch lange standhalten konnte. Doch ein ums andere Mal überstand es die hereinbrechenden Sturzseen, richtete sich wieder auf und trotzte auch dem nächsten Brecher, ohne dass die armen Insassen in die kalten Fluten geworfen wurden.
Gallagher kniete sich von Zeit zu Zeit auf, wenn das Floß auf einen Wellenkamm hochgerissen wurde, und ließ den Blick über die aufgewühlten Fluten schweifen, bevor es in den nächsten Strudel hinabstürzte. Es war vergeblich. Weit und breit war keine Menschenseele. Die ganze schreckliche Nacht hindurch sahen sie nicht ein einziges Licht von einem anderen Schiff.
»Irgendwo muss doch ein Schiff in der Nähe sein«, sagte Katie zähneklappernd.
Gallagher schüttelte den Kopf. »Die See ist so leer wie das Sparschwein von ’nem armen Waisenkind.« Er verriet ihr nicht, dass man kaum fünfzig Meter weit sehen konnte.
»Ich werde mir nie verzeihen, dass ich Fritz im Stich gelassen habe«, flüsterte Katie unter Tränen, die in kürzester Zeit auf ihren Wangen zu Eis gefroren.
»Meine Schuld«, tröstete Gallagher sie. »Ich hätt ihn mir schnappen sollen, als wir aus der Kabine gerannt sind.«
»Fritz?«, erkundigte sich Hui.
»Mein kleiner Dackel«, erwiderte Katie.
»Sie haben einen Hund verloren.« Er setzte sich ruckartig auf. »Sie haben einen Hund verloren?«, wiederholte er. »Ich habe Herz und Seele meines Landes verloren …« Er stockte und bekam einen Hustenanfall. Seine Miene wirkte gepeinigt, der Blick verzweifelt. Er sah aus, als hätte sein Leben jeglichen Sinn verloren. »Ich habe meine Aufgabe nicht erfüllt. Mir bleibt nur der Tod.«
»Seien Sie doch nicht blöd, Mann«, versetzte Gallagher. »Wir kommen durch. Sie müssen nur noch eine Weile aushalten.«
Hui hörte ihn nicht mehr. Er schien aufgegeben zu haben. Katie warf einen Blick auf die Augen des Generals. Es war, als hätten sie jegliche Leuchtkraft verloren. Sie wirkten mit einem Mal glasig, blicklos.
»Ich glaube, er ist tot«, murmelte Katie.
Gallagher überzeugte sich kurz davon. »Schieb ihn ein Stück rüber und benutz ihn als Schutzschild gegen den Wind und die Gischt. Ich leg mich auf die andere Seite.«
Es kam ihr zunächst grausig vor, aber Katie stellte fest, dass sie Huis erstarrenden Leichnam durch die dicke Kleidung kaum spürte. Der Verlust ihres treuen kleinen Hundes, das sinkende Schiff, der wahnwitzige Wind und die tobende See – all das kam ihr auf einmal unwirklich vor. Wie ein Albtraum, aus dem sie hoffentlich jeden Moment erwachen würde. Sie drückte sich tiefer zwischen die beiden Männer, den toten und den lebendigen.
Während des Tages und der folgenden Nacht ließ der Sturm allmählich nach, doch dem mörderischen Eiswind waren sie nach wie vor schutzlos ausgesetzt. Katie hatte kein Gefühl mehr in Händen und Füßen. Sie dämmerte vor sich hin, verlor ab und zu das Bewusstsein. Gelegentlich phantasierte sie. Eigenartige Gedanken gingen ihr durch den Kopf. So musste sie zum Beispiel an ihr letztes Essen denken, ihr Henkersmahl sozusagen. Dann bildete sie sich ein, sie sei an einem sonnigen Strand unter wiegenden Palmen und Fritz komme kläffend quer über den Sand auf sie zugerannt. Sie unterhielt sich mit Gallagher, als säßen sie beide im Restaurant und stellten gerade ihr Menü zusammen. Ihr toter Vater erschien ihr in seiner Kapitänsuniform. Aufrecht stand er im Floß, blickte auf sie herab und lächelte. Er redete ihr gut zu, sagte ihr, dass sie überleben werde, sich keine Sorgen zu machen brauche. Dass es nicht mehr weit bis zum Land sei. Dann war er wieder weg.
»Wie spät ist es?«, krächzte sie.
»Meiner Meinung nach müsste es später Nachmittag sein«, antwortete Gallagher. »Meine Uhr ist kurz nach dem Untergang der Princess Dou Wan stehengeblieben.«
»Wie lange treiben wir schon dahin?«
»Grob geschätzt etwa achtunddreißig Stunden.«
»Wir nähern uns dem Land«, murmelte sie plötzlich.
»Wie kommst du denn darauf, Liebes?«
»Mein Vater hat’s mir gesagt.«
»Aha, wirklich?« Mitleidig lächelte er ihr zu. Mit seinem frostig weißen Schnurrbart, den schneeverkrusteten Augenbrauen und den Eiszapfen, die an den unter der Mütze hervorlugenden Haaren hingen, sah er aus wie ein Ungeheuer aus den Tiefen des Polarmeeres. Katie fragte sich, wie sie wohl aussehen mochte – auch wenn sie keinen Schnurrbart vorweisen konnte.
»Siehst du es denn nicht?«
Gallagher, der von der Kälte furchtbar steif war, setzte sich mühsam auf und suchte den Horizont ab, soweit er etwas erkennen konnte. Der peitschende Schneeregen nahm ihm die Sicht, aber er versuchte es dennoch. Dann traute er seinen Augen kaum. Er meinte, eine mit großen Felsblöcken übersäte Küste zu erkennen. Unmittelbar dahinter, keine fünfzig Meter weit weg, wiegten sich verschneite Bäume im Wind. Und dann entdeckte er etwas Dunkles zwischen den Bäumen – womöglich eine Hütte.
Gallagher setzte sich auf, zog mit tauben, ungelenken Fingern seinen linken Stiefel aus und benutzte ihn als Paddel. Nach ein paar Minuten wurde ihm warm, so dass ihm seine Aufgabe leichter fiel. »Nur Mut, Liebes. Gleich sind wir an Land.«
Gallagher musste mit aller Kraft gegen die Strömung rudern, die parallel zur Küste verlief. Es kam ihm so vor, als paddelte er durch dicken Sirup. Doch allmählich rückte die Küste näher. Er meinte die Bäume mit der Hand fassen zu können, aber noch waren sie gut fünfzig Meter weit weg.
Gerade als Gallagher völlig ausgepumpt und mit seiner Kraft am Ende war, spürte er, wie das Floß an Felsblöcke stieß, die unter Wasser lagen. Er warf einen Blick auf Katie. Sie bibberte vor Kälte. Lange hielt sie nicht mehr durch.
Er schlüpfte mit dem Fuß wieder in den Stiefel. Dann atmete er einmal tief durch, hoffte, dass er in dem eiskalten Wasser zumindest stehen konnte, und sprang hinein. Ungefährlich war das nicht, doch er musste es riskieren. Gott sei Dank bekam er festen Fels unter die Stiefelsohlen, ehe ihm das Wasser bis zur Leiste reichte.
»Katie!«, schrie er wie von Sinnen. »Wir haben’s geschafft. Wir sind an Land.«
»Wie schön«, murmelte Katie, die kaum noch wusste, wie ihr geschah.
Gallagher zog das Floß auf den Strand, der mit glatten Kieseln und vom Wasser abgeschliffenen Felsen übersät war. Er bot seine letzten Kräfte auf, und dann brach er einfach zusammen, blieb reglos auf den kalten, nassen Steinen liegen. Er wusste nicht, wie lange er dagelegen hatte, doch als er sich endlich aufraffte, zu dem Rettungsfloß kroch und einen Blick ins Innere warf, sah er, dass Katies Gesicht blau verfärbt war. Beklommen zog er sie an sich. Er wusste nicht, ob sie überhaupt noch lebte, doch dann nahm er den schwachen Hauch wahr, der aus ihrer Nase drang, und tastete nach dem Puls an ihrem Hals. Ihr sonst so starkes Herz schlug schwach und langsam. Der Tod war nicht mehr fern.
Er sah zum Himmel auf. Die dicke graue Wolkendecke war aufgerissen, die Wolken färbten sich bereits wieder weiß. Der Sturm legte sich allmählich: Er spürte schon, wie die heftigen Windböen zu einer sanfteren Brise abflauten. Viel Zeit hatte er nicht. Wenn er nicht bald eine warme Bleibe fand, würde er sie verlieren.
Gallagher holte tief Luft, schob die Arme unter Katies Körper und hob sie hoch. Aus lauter Wut versetzte er dem Floß einen Tritt, so dass es mitsamt General Huis steifgefrorenem Leichnam zurück in die See befördert wurde. Er sah einen Moment lang zu, wie die Strömung das Floß erfasste und es hinaus ins tiefe Wasser zog. Dann drückte er Katie an seine Brust und torkelte auf die Hütte unter den Bäumen zu. Es kam ihm vor, als werde die Luft allmählich wärmer, als fiele jede Müdigkeit und Verkrampfung von ihm ab.
Drei Tage später meldete der Frachter Stephen Miller, dass man ein Rettungsfloß gesichtet und eine Leiche geborgen habe. Der Tote, offenbar ein Chinese, habe ausgesehen wie aus Eis gemeißelt. Niemand konnte ihn identifizieren. Auf dem Rettungsfloß einem altmodischen Bautyp, wie er seit zwanzig Jahren nicht mehr in Gebrauch war, standen chinesische Buchstaben. Später stellte man fest, dass es von einem Schiff namens Princess Dou Wan stammte.
Bei einer Suchaktion fand man zwar allerlei Treibgut, das indes nicht geborgen wurde. Aber man stieß auf keinerlei Ölteppich. Kein Schiff wurde als verschollen gemeldet. Niemand, weder an Land noch auf See, hatte einen Notruf aufgefangen. Allerdings mussten die Seenotrettungsdienste später einräumen, dass sie wegen des dichten Schneetreibens so gut wie gar nichts hatten empfangen können.
Die Sache wurde noch rätselhafter, als man erfuhr, dass ein Schiff namens Princess Dou Wan angeblich einen Monat zuvor vor der chilenischen Küste gesunken war. Der Tote, den man in dem Rettungsfloß gefunden hatte, wurde bestattet, und der Vorfall geriet binnen kurzer Zeit in Vergessenheit.
ERSTER TEIL: Das mörderische Gewässer
14. April 2000
Pazifischer Ozean, vor der Küste von Washington
1
Langsam, so als kämpfe sie sich aus einer bodenlosen Grube frei, kam Ling T’ai wieder zu Bewusstsein. Ihr ganzer Oberkörper tat weh. Sie stöhnte mit zusammengebissenen Zähnen, hätte am liebsten vor Schmerz laut aufgeschrien. Sie hob die Hand, die übel zugerichtet war, und strich sich mit den Fingerspitzen vorsichtig über das Gesicht. Eins ihrer kaffeebraunen Augen war ganz zugeschwollen, das andere bekam sie wenigstens ein Stück weit auf. Die Nase war gebrochen und blutete noch immer. Gott sei Dank hatte sie, soweit sie spüren konnte, noch sämtliche Zähne, aber Arme und Schulter verfärbten sich allmählich grün und blau. Sie wollte gar nicht wissen, wo sie überall Blutergüsse hatte.
Ling T’ai wusste zuerst nicht genau, warum man ausgerechnet sie zum Verhör ausgewählt hatte. Die Erklärung kam erst später, kurz bevor sie brutal zusammengeschlagen worden war. Selbstverständlich hatte man unter den zahllosen illegalen chinesischen Einwanderern, die sich an Bord des Schiffes befanden, auch noch andere Opfer ausgesucht, hatte sie misshandelt und anschließend in ein dunkles Abteil im Frachtraum geworfen. Sie begriff nichts mehr; alles kam ihr so verworren und undurchsichtig vor. Sie hatte das Gefühl, als verlöre sie jeden Moment das Bewusstsein und versänke wieder in dem schwarzen Loch.
Das Schiff, mit dem sie von der chinesischen Hafenstadt Qingdao aus quer über den Pazifik gefahren war, wirkte auf den ersten Blick wie ein typischer Passagierdampfer. Auf den Namen Indigo Star getauft und von der Wasserlinie bis zum Schornstein weiß gestrichen, ähnelte es einem kleinen Kreuzfahrtschiff, auf dem etwa hundert bis hundertfünfzig Passagiere in allem Luxus und Komfort reisen konnten. In den riesigen offenen Ladebuchten im Bauch und in den Aufbauten der Indigo Star drängten sich hingegen nahezu zwölfhundert illegale chinesische Einwanderer. Das Schiff täuschte – nach außen hin unschuldig, aber innen die wahre Hölle.
Nie und nimmer hätte sich Ling T’ai vorstellen können, unter welch unerträglichen Bedingungen sie und über tausend andere Menschen um die halbe Welt fahren mussten. Das Essen war so knapp bemessen, dass man kaum davon leben konnte. Die Toiletten waren in einem fürchterlichen Zustand, und andere sanitäre Einrichtungen waren schlichtweg nicht vorhanden. Manch einer war gestorben, vor allem kleine Kinder und Ältere. Die Leichen waren fortgeschleppt worden und auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Ling T’ai hatte den Eindruck, dass man sie kurzerhand ins Meer geworfen hatte, wie Abfall.
Am Tag bevor die Indigo Star die Nordwestküste der Vereinigten Staaten erreichen sollte, hatte ein Trupp Wachmänner – Aufseher nannten sie sich, und sie verbreiteten ständig Angst und Schrecken an Bord des Schiffes – etwa dreißig, vierzig Passagiere zusammengetrieben und sie ohne jede Erklärung einem Verhör unterworfen. Als sie an der Reihe gewesen war, hatte man sie in ein kleines dunkles Kabuff geführt und ihr befohlen, auf einem Stuhl vor einem Tisch Platz zu nehmen, an dem vier Aufseher der Schlepperorganisation saßen. Dann unterzog man Ling einer eingehenden Befragung.
»Name!«, herrschte sie ein schlanker Mann an, der einen eleganten grauen Nadelstreifenanzug trug. Sein glattes braunes Gesicht wirkte intelligent, war aber völlig ausdruckslos. Die anderen drei Aufseher saßen schweigend da und musterten sie mit bösartigem Blick. Das klassische Einschüchterungsmanöver beim Verhör, dachte sie.
»Ich heiße Ling T’ai.«
»In welcher Provinz bist du geboren?«
»Jiangsu.«
»Hast du dort gewohnt?«
»Bis zu meinem zwanzigsten Lebensjahr, als ich mit der Ausbildung fertig wurde. Dann bin ich als Lehrerin nach Kanton gegangen.«
Kühl und leidenschaftslos kamen die Fragen, ohne jede Schärfe. »Warum willst du in die Vereinigten Staaten.«
»Ich wusste, dass die Überfahrt äußerst gefährlich werden würde. Aber die Verlockung war zu groß, denn dort winkt mir ein besseres Leben«, antwortete Ling T’ai. »Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu verlassen und Amerikanerin zu werden.«
»Woher hast du das Geld für die Überfahrt?«
»Den Großteil habe ich in den letzten zehn Jahren von meinem Lehrerinnengehalt gespart. Den Rest habe ich mir von meinem Vater geborgt.«
»Was ist er von Beruf?«
»Er ist Professor für Chemie an der Universität Peking.«
»Hast du Freunde oder Verwandte in den Vereinigten Staaten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kenne dort niemanden.«
Der schmächtige Mann schaute sie lange und nachdenklich an, dann deutete er mit dem Finger auf sie. »Du bist eine Spionin. Du sollst unsere Organisation auskundschaften.«
Der Vorwurf kam so unverhofft, dass sie einen Moment wie erstarrt dasaß. »Ich weiß nicht, was Sie meinen«, stammelte sie schließlich. »Ich bin Lehrerin. Wieso bezeichnen Sie mich als Spionin?«
»Du siehst nicht so aus, als wärst du in China geboren.«
»Das stimmt nicht!«, rief sie erschrocken. »Meine Mutter und mein Vater sind Chinesen. Und meine Großeltern auch.«
»Dann erklär mir mal, warum du mindestens zehn Zentimeter größer bist als die Durchschnittschinesin und woher dieser leicht europäische Einschlag in deinem Gesicht stammt.«
»Wer sind Sie eigentlich?«, herrschte sie ihn an. »Weshalb sind Sie so grausam?«
»Nicht dass es darauf ankäme, aber ich heiße Ki Wong. Ich bin Chefaufseher auf der Indigo Star. Und jetzt beantworte bitte meine Frage.«
Ling tat erschrocken und erklärte, dass ihr Urgroßvater ein holländischer Missionar gewesen sei, der in Longyan eine Missionsstation geleitet und eine Einheimische zur Frau genommen habe. »Das ist das einzige westliche Blut, das in meinen Adern fließt. Ich schwöre es.«
Ihr Gegenüber tat ungläubig. »Du lügst.«
»Bitte, Sie müssen mir glauben!«
»Kannst du Englisch?«
»Ich kenne nur ein paar Wörter und Ausdrücke.«
Dann kam Wong zum eigentlichen Thema. »Laut unseren Unterlagen hast du für die Überfahrt nicht genug bezahlt. Du schuldest uns noch zehntausend amerikanische Dollar.«
Ling T’ai sprang auf. »Aber ich habe kein Geld mehr!«, rief sie.
Wong zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Dann wirst du nach China zurückgebracht.«
»Nein, bitte nicht. Ich kann nicht zurück, nicht jetzt!« Sie rang die Hände, bis ihre Knöchel weiß anliefen.
Der Oberaufseher warf den drei anderen Männern, die reglos dasaßen, einen süffisanten Blick zu. Dann schlug er einen anderen Ton an. »Es gäbe da noch eine Möglichkeit, wie du in die Vereinigten Staaten gelangen könntest.«
»Ich werde alles tun«, flehte Ling T’ai.
»Wenn du an Land gebracht wirst, musst du die ausstehenden Reisekosten abdienen. Eine Anstellung als Lehrerin wirst du auf keinen Fall finden, weil du kaum Englisch kannst. Und da du weder Freunde noch Familie hast, wirst du auch keinerlei Unterstützung bekommen. Daher werden wir dich verköstigen, dir Unterkunft gewähren und eine Arbeitsmöglichkeit verschaffen, bis du allein zurechtkommst.«
»Um welche Arbeit handelt es sich?«, fragte Ling T’ai zögernd.
Wong schwieg einen Moment, dann grinste er boshaft. »Um die hohe Kunst, Männer zufriedenzustellen.«
Darauf also lief die ganze Sache hinaus. Man hatte von Anfang an nicht vorgehabt, sie in den Vereinigten Staaten ihrer Wege ziehen zu lassen. Ling T’ai und der Großteil ihrer Landsleute sollten als Arbeitssklaven auf Zeit eingesetzt werden, die man nach Belieben quälen und zu Tode schinden konnte.
»Prostitution?«, schrie Ling T’ai entsetzt. »Dazu werde ich mich niemals hergeben!«
»Ein Jammer«, versetzte Wong leidenschaftslos. »Du bist eine attraktive Frau und hättest einen guten Preis verlangen können.«
Er erhob sich, ging um den Tisch herum und baute sich vor ihr auf. Das höhnische Grinsen war verschwunden. Stattdessen musterte er sie bösartig. Dann zog er einen länglichen Gegenstand, der aussah wie eine Art steifer Gummischlauch, aus seiner Jackentasche und drosch damit auf ihr Gesicht und ihren Oberkörper ein. Er hörte erst auf, als ihm der Schweiß ausbrach. Mit einer Hand packte er ihr Kinn und betrachtete ihr zerschlagenes Gesicht. Sie stöhnte und flehte ihn an, er solle aufhören.
»Hast du etwa deine Meinung geändert?«
»Niemals«, versetzte sie trotz aufgeplatzter Lippe und blutendem Mund. »Eher sterbe ich.«
Da verzogen sich Wongs schmale Lippen zu einem kalten Lächeln. Er holte aus und versetzte ihr mit dem Schlauch einen heftigen Schlag auf die Schädelbasis. Ling T’ai wurde schwarz vor Augen.
Ihr Peiniger kehrte zu seinem Platz zurück, griff zum Telefon und gab seine Anweisungen. »Ihr könnt die Frau abholen und sie zu den anderen bringen, die für den Orion Lake bestimmt sind.«
»Meinst du nicht, dass sich aus der eine Menge Profit rausschlagen ließe?«, fragte ein untersetzter Mann am anderen Ende des Tisches.
Wong schüttelte den Kopf und blickte auf Ling T’ai hinab, die blutend am Boden lag. »Irgendetwas an der Frau gefällt mir nicht. Wir sollten lieber auf Nummer sicher gehen. Wir wollen doch nicht das ganze Unternehmen gefährden und uns den Zorn unseres werten Vorgesetzten zuziehen. Ling T’ai wird sterben, wie sie es sich gewünscht hat.«
Eine ältere Frau, die, wie sie sagte, Krankenschwester war, tupfte Ling T’ais Gesicht vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab, entfernte das angetrocknete Blut, griff dann zu einem kleinen Sanitätskasten und trug ein Desinfektionsmittel auf. Als sie Ling T’ais Verletzungen versorgt hatte, kümmerte sich die alte Schwester um einen Jungen, der wimmernd im Arm seiner Mutter lag. Ling T’ai schlug das Auge auf, das noch nicht völlig zugeschwollen war, und unterdrückte einen jähen Übelkeitsanfall. Trotz der quälenden Schmerzen am ganzen Körper war sie klar bei Sinnen, und sie wusste genau, wie sie in diese elende Situation geraten war.
Sie hieß nicht Ling T’ai. Sie war in San Francisco geboren und auf den Namen Julia Marie Lee getauft. Ihr Vater war einst als Analyst eines Finanzinstituts in Hongkong tätig gewesen, wo er die Tochter eines reichen chinesischen Bankiers geheiratet hatte. Von den blaugrauen Augen einmal abgesehen, die sie hinter braunen Kontaktlinsen versteckte, war sie eher nach ihrer Mutter geraten, von der sie die herrlichen schwarzen Haare und die asiatischen Züge geerbt hatte. Natürlich war sie auch keine Lehrerin aus der Provinz Jiangsu.
Julia Marie Lee war Undercoveragentin der für internationale Ermittlungen zuständigen Abteilung des US-amerikanischen Immigration and Naturalization Service, kurz INS, also der Einwanderungsbehörde. Sie hatte sich als Ling T’ai ausgegeben und einem Vertreter des Schlepperrings in Peking umgerechnet dreißigtausend Dollar in chinesischer Währung bezahlt, damit man sie in die USA brachte. Auf der menschenunwürdigen Überfahrt hatte sie unschätzbare Eindrücke über das Treiben und die Vorgehensweise des Syndikats sammeln können.
Sobald man sie an Land brachte, wollte sie sich mit dem stellvertretenden Bezirksdirektor ihrer Dienststelle in Seattle in Verbindung setzen, der nur auf ihren Anruf wartete und sich bereit hielt, um sämtliche Schlepper in seinem Zuständigkeitsbereich festzunehmen und ihre geheimen Routen nach Nordamerika auffliegen zu lassen. Doch im Augenblick sah sie keinerlei Fluchtmöglichkeit, und ihr Schicksal war mehr als ungewiss.
Julia hatte ungeahnte Kräfte aufgeboten, mehr als sie für möglich gehalten hätte, und nur dadurch hatte sie die Folter überstanden. Sie hatte zwar eine monatelange harte Ausbildung durchlaufen, doch auf eine derartige Brutalität war sie nicht gefasst gewesen. Jetzt verfluchte sie sich, weil sie sich falsch verhalten hatte. Wenn sie sich demütig in ihr Schicksal ergeben hätte, hätte sie höchstwahrscheinlich entkommen können. Aber sie hatte gemeint, sie könnte die Schlepper täuschen, wenn sie eine angsterfüllte, aber stolze Chinesin mimte. Das war ein Fehler gewesen, wie sich herausgestellt hatte. Jetzt war ihr klar, dass es an Bord dieses Schiffes keinerlei Gnade gab, wenn sich jemand widersetzte. Und dann, als ihre Augen sich allmählich an das Zwielicht gewöhnten, sah sie, dass viele andere Männer und Frauen ebenso übel zugerichtet waren wie sie.
Je länger Julia über ihre Lage nachdachte, desto mehr war sie davon überzeugt, dass sie und alle anderen Menschen, die in diesem Frachtraum saßen, ermordet werden würden.
2
Der Besitzer des kleinen Gemischtwarenladens in Orion Lake, rund neunzig Meilen westlich von Seattle gelegen, drehte sich kurz um und betrachtete den Mann, der die Tür öffnete und einen Moment lang auf der Schwelle stehen blieb. Orion Lake lag abseits der großen Verkehrswege, und Dick Colburn kannte jeden hier in dem zerklüfteten Bergland auf der Olympic-Halbinsel. Der Fremde war entweder ein Tourist auf der Durchreise oder ein Sportangler aus der Stadt, der sein Glück bei den Lachsen oder Forellen versuchen wollte, die von der Forstverwaltung im nahe gelegenen See eingesetzt wurden. Er trug eine Kordhose, einen irischen Wollpullover und darüber eine kurze Lederjacke. Kein Hut bedeckte die dichten, welligen schwarzen Haare, die an den Schläfen graumeliert waren. Colburn sah, wie der Fremde auf die Regale und Glasvitrinen starrte, ehe er eintrat.
Aus alter Gewohnheit musterte Colburn den Mann eine Zeitlang. Der Fremde war groß; zwischen seinem Kopf und dem Türsturz war keine drei Finger breit Platz. Dem Gesicht nach zu urteilen, kein Schreibtischarbeiter, befand Colburn. Die Haut war zu braun und wettergegerbt für einen Stubenhocker. Kinn und Wangen könnten eine Rasur gebrauchen. Er war ein bisschen schmal für seine Statur. Ganz unverkennbar wirkte er wie jemand, der zu viel gesehen und dabei allerlei Strapazen und Leid durchgestanden hatte. Er wirkte müde, nicht körperlich erschöpft, sondern seelisch ausgelaugt, so als läge ihm nicht mehr allzu viel am Leben. Fast so, als hätte er dem Tod bereits ins Auge gesehen, wäre aber irgendwie noch einmal davongekommen. Doch trotz der hageren Züge strahlten die grün schimmernden Augen eine ruhige Heiterkeit aus, einen gewissen Stolz.
Colburn überspielte seine Neugier und füllte die Regale mit Waren auf. »Kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte er, nach hinten gewandt.
»Wollte mir bloß ein paar Lebensmittel besorgen«, erwiderte der Fremde. Colburns Laden war zu klein für Einkaufswagen, daher nahm der Mann einen Korb und hängte sich den Griff über den Unterarm.
»Was machen die Fische?«
»Hab mein Glück noch nicht versucht.«
»An der Südspitze vom See gibt’s ’ne gute Stelle, wo sie angeblich wie wild anbeißen sollen.«
»Danke, ich werd’s mir merken.«
»Haben Sie schon einen Angelschein?«
»Nein, aber ich wette, dass Sie mir einen ausstellen können.«
»Wohnen Sie im Bundesstaat Washington?«
»Nein.«
Der Lebensmittelhändler holte ein Formular unter dem Ladentisch hervor und reichte dem Fremden einen Stift. »Füllen Sie einfach den Antrag aus. Ich schlag die Gebühr auf Ihre Rechnung drauf.« Colburn, der ein feines Gehör hatte, meinte einen leichten Akzent herauszuhören, der nach Südwesten klang. »Die Eier sind frisch. Hier am Ort gelegt. Den Eintopf von Shamus O’Malley gibt’s im Sonderangebot. Und der Räucherlachs und die Elchsteaks schmecken einfach himmlisch.«
Zum ersten Mal spielte ein leichtes Lächeln um den Mund des Fremden. »Elchsteaks und Lachs klingt gut, aber ich glaube, den Eintopf lass ich lieber.«
Es dauerte fast eine Viertelstunde, bis der Korb voll war und neben der alten Messingregistrierkasse auf dem Ladentisch stand. Statt der üblichen Lebensmitteldosen, mit denen sich die meisten Angler eindeckten, hatte der Fremde hauptsächlich Obst und Gemüse gekauft.
»Sie haben offenbar vor, eine Weile zu bleiben«, sagte Colburn.
»Ein alter Freund meiner Familie hat mir seine Hütte am See vermietet. Sie kennen ihn vermutlich. Er heißt Sam Foley.«
»Ich kenne Sam schon seit zwanzig Jahren. Seine Hütte ist die einzige, die der verdammte Chinese noch nicht aufgekauft hat«, grummelte Colburn. »Ist auch gut so. Wenn Sam verkauft, gibt’s überhaupt keinen Zugang mehr zum See. Jedenfalls nicht für die Angler, die ihre Boote zu Wasser lassen wollen.«
»Ich habe mich schon gefragt, warum die Hütten alle so heruntergekommen und verlassen wirken. Von dem komischen Bauwerk einmal abgesehen, das an der Nordseite des Sees steht, direkt gegenüber von dem kleinen Fluss, der nach Westen führt.«
»In den vierziger Jahren war dort mal ’ne Fischkonservenfabrik«, sagte Colburn, während er die Lebensmittel abrechnete. »Die Firma ist pleitegegangen. Der Chinese hat sie sich für ’n Appel und ’n Ei geschnappt und zu einem schicken Herrenhaus umgebaut. Hat sogar ’nen Golfplatz mit neun Löchern anlegen lassen. Dann hat er jedes Stück Land aufgekauft, das an den See grenzt. Ihr Freund Sam Foley ist der Einzige, der bislang eisern geblieben ist.«
»Kommt mir ohnehin so vor, als ob die Bevölkerung von Washington und British Columbia zur Hälfte aus Chinesen besteht«, meinte der Fremde.
»Seit die Kommunisten Hongkong übernommen haben, haben die Chinesen den pazifischen Nordwesten wie eine Flutwelle überschwemmt. Denen gehören bereits die halbe Innenstadt von Seattle und der Großteil von Vancouver. Keiner weiß, wie hoch ihr Bevölkerungsanteil in fünfzig Jahren sein wird.« Colburn schwieg einen Moment und drückte auf die Additionstaste der Registrierkasse. »Einschließlich Angelschein macht das neunundsiebzig-fünfunddreißig.«
Der Fremde zog seine Brieftasche hinten aus der Hose, reichte Colburn einen Hundertdollarschein und wartete auf das Wechselgeld. »Der Chinese, den Sie erwähnt haben – was macht der geschäftlich?«
»Ich hab bloß gehört, dass er ein reicher Reedereibesitzer aus Hongkong sein soll.« Colburn schwatzte munter weiter, während er die Lebensmittel einpackte. »Niemand hat ihn bislang zu Gesicht gekriegt. Im Ort ist er auch noch nie gewesen. Von ein paar Lieferwagenfahrern mal abgesehen, kommt dort keiner raus oder rein. Die meisten Leute hier in der Gegend sind der Meinung, dass dort seltsame Sachen vor sich gehen. Man sieht ihn und seine Leute nie tagsüber beim Angeln. Nur bei Nacht hört man Motorboote, und die fahren immer ohne Licht. Harry Daniels, der am Fluss jagt und manchmal sein Lager dort auf schlägt, behauptet, dass er gesehen hat, wie ein merkwürdig gebautes Boot um Mitternacht über den See gefahren ist. Aber nur, wenn der Mond nicht scheint.«
»Auf Geheimnisse steht eben jeder.«
»Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, solange Sie hier in der Gegend sind, brauchen Sie bloß nach mir zu fragen. Ich heiße Dick Colburn.«
Der Fremde grinste breit und zeigte seine weißen, ebenmäßigen Zähne. »Dirk Pitt.«
»Sind Sie aus Kalifornien, Mr. Pitt?«
»Professor Henry Higgins wäre stolz auf Sie«, versetzte Pitt gutgelaunt. »Ich bin in Südkalifornien geboren und aufgewachsen, wohne aber seit fünfzehn Jahren in Washington.«
Colburn witterte Morgenluft. »Dann sind Sie wahrscheinlich bei der Regierung beschäftigt.«
»Bei der National Underwater and Marine Agency. Und damit hier kein falscher Eindruck entsteht – ich bin lediglich zum Abschalten und Ausspannen in Orion Lake. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage«, erwiderte Colburn. »Aber Sie sehen aus, als ob Sie ein bisschen Ruhe gebrauchen könnten.«
Pitt grinste. »Eigentlich brauche ich bloß jemanden, der mir mal tüchtig den Rücken durchknetet.«
»Cindy Eider. Die ist Barkeeperin drüben im Sockeye Saloon und kann Ihnen eine erstklassige Massage verpassen.«
»Ich werd’s mir merken.« Pitt nahm die Lebensmitteltüte mit beiden Armen und ging zur Tür. Bevor er den Laden verließ, blieb er noch einmal stehen und drehte sich um. »Nur aus Neugier, Mr. Colburn. Aber wie heißt der Chinese?«
Colburn schaute Pitt an und versuchte erfolglos, ihm etwas an den Augen abzulesen. »Er nennt sich Shang, Qin Shang.«
»Hat er sich jemals dazu geäußert, warum er die alte Konservenfabrik gekauft hat?«
»Norman Selby, das ist der Immobilienmakler, der das Geschäft abgewickelt hat, hat gesagt, dass Shang ein abgelegenes Grundstück am Wasser haben wollte, um sich dort ein Feriendomizil mit allen Schikanen hinzustellen, in das er seine betuchte Klientel einladen kann.« Colburn hielt inne und blickte streitlustig auf. »Sie haben bestimmt gesehen, was der aus einer einwandfreien Konservenfabrik gemacht hat. War nur eine Frage der Zeit, bis sie von Staats wegen unter Denkmalschutz gestellt worden wäre. Shang hat daraus eine Mischung aus modernem Bürogebäude und Pagode gebaut. Eine Missgeburt ist das, sag ich nur, ein verdammter Schandfleck.«
»Neumodisch sieht es auf jeden Fall aus«, pflichtete Pitt bei. »Shang legt sicher Wert auf gutnachbarliche Beziehungen und lädt die Bürger der Stadt von Zeit zu Zeit zu Partys und Golfturnieren ein?«
»Soll das ein Witz sein?«, sagte Coburn, der jetzt seinen ganzen Ärger herausließ. »Shang würde den Bürgermeister und die Stadträte nicht mal bis auf einen Kilometer an sein Grundstück ranlassen. Der hat doch sogar fast den ganzen See mit einem drei Meter hohen Maschendrahtzaun mit einer Stacheldrahtkrone umgeben.«
»Kommt er denn damit durch?«
»Er kommt damit durch, weil er sich die entsprechenden Politiker kauft. Er kann die Leute nicht vom See fernhalten. Der gehört dem Staat. Aber er kann ihnen den Zugang so schwer wie möglich machen.«
»Manche Menschen machen eben viel Getue um ihre Privatsphäre.«





























