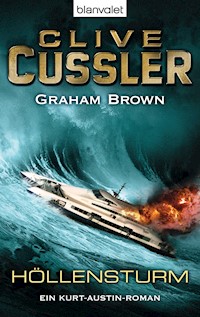
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kurt-Austin-Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Der Jemenitische Warlord Jinn al-Khalif weiß: Wer das Wetter beherrscht, beherrscht die Welt. Und wenn Stürme und Unwetter Millionen von Leben kosten, bevor er der Wüste Regen und damit Leben bringt, dann sei es! Doch Kurt Austin und sein Partner Joe Zavala von der NUMA erfahren durch Zufall von dem mörderischen Plan, nachdem bereits eine ganze Schiffscrew durch al-Khalifs Machenschaften getötet wurde. Sie sind die Einzigen, die den Warlord noch aufhalten können. Doch die Veränderung des globalen Klimas hat bereits begonnen!
Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Autoren
Seit er 1973 seinen ersten Helden Dirk Pitt erfand, ist jeder Roman von Clive Cussler ein »New-York-Times«-Bestseller. Auch auf der deutschen SPIEGEL-Bestsellerliste ist jeder seiner Romane vertreten. 1979 gründete er die reale NUMA, um das maritime Erbe durch die Entdeckung, Erforschung und Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er lebt in der Wüste von Arizona und in den Bergen Colorados.
Der leidenschaftliche Pilot Graham Brown hält Abschlüsse in Aeronautik und Rechtswissenschaften. In den USA gilt er bereits als der neue Shootingstar des intelligenten Thrillers in der Tradition von Michael Crichton. Wie keinem zweiten Autor gelingt es Graham Brown, verblüffende wissenschaftliche Aspekte mit rasanter Nonstop-Action zu einem unwiderstehlichen Hochspannungscocktail zu vermischen.
Liste der lieferbaren Bücher
Von Clive Cussler im Blanvalet-Taschenbuch (die Dirk-Pitt-Romane):
Eisberg (35601), Das Alexandria-Komplott (35528), Die Ajima-Verschwörung (36089), Schockwelle (35201), Höllenflut (35297), Akte Atlantis (35896), Im Zeichen der Wikinger (36014), Die Troja-Mission (36473), Cyclop (37025), Geheimcode Makaze (37151), Der Fluch des Khan (37210), Polarsturm (37469), Wüstenfeuer (37755)
Von Clive Cussler und Paul Kemprecos im Blanvalet-Taschenbuch
(die Kurt-Austin-Romane):
Tödliche Beute (36068), Brennendes Wasser (35683), Das Todeswrack (35274), Killeralgen (36362), Packeis (36617), Höllenschlund (36922), Flammendes Eis (37285), Eiskalte Brandung (37577)
Von Clive Cussler und Graham Brown im Blanvalet-Taschenbuch
(die Kurt-Austin-Romane):
Teufelstor (38048), Höllensturm (38297)
Von Clive Cussler und Craig Dirgo im Blanvalet-Taschenbuch
(die Juan-Cabrillo-Romane):
Der goldene Buddha (36160), Der Todesschrein (36446)
Von Clive Cussler und Jack DuBrul im Blanvalet-Taschenbuch
(die Juan-Cabrillo-Romane):
Todesfracht (36857), Schlangenjagd (36864), Seuchenschiff (37243),
Kaperfahrt (37590), Teuflischer Sog (37751), Killerwelle (37818)
Von Clive Cussler und Grant Blackwood im Blanvalet-Taschenbuch
(die Fargo-Romane):
Das Gold von Sparta (37683), Das Erbe der Azteken (37949), Das Geheimnis von Shangri La (38069), Das fünfte Grab des Königs (38224)
Von Clive Cussler (die Isaac-Bell-Romane):
Höllenjagd (37057)
Von Clive Cussler und Justin Scott (die Isaac-Bell-Romane):
Sabotage (37684), Blutnetz (37964), Todesrennen (38167)
Clive Cussler
& Graham Brown
Höllensturm
Roman
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Storm« bei Putnam, New York.
Copyright © 2012 by Sandecker RLLLP
By arrangement with
Peter Lampack Agency, Inc.
551 Fifth Avenue, Suite 1613
New York, NY 10176 – 0187 USA
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by
Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
Redaktion: Jörn Rauser
HK · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-12035-1V002
www.blanvalet.de
PROLOG
INDISCHER OZEAN
SEPTEMBER 1943
Die S.S. John Bury erzitterte vom Bug bis zum Heck, während sie durch die schwere Dünung des Indischen Ozeans pflügte. Als ein sogenannter »Schnellfrachter« war sie konstruiert worden, um Kriegsschiffe als Tender zu begleiten. Gewöhnlich mit zügiger Fahrt unterwegs, aber mit allen Kesseln unter Volldampf, legte die John Bury ein Tempo vor, das sie seit ihrer letzten Probefahrt vor der Indienststellung nicht mehr erreicht hatte. Schwer beschädigt, brennend und eine Rauchfahne hinter sich herziehend, rannte die John Bury geradezu um ihr Leben.
Das Schiff schob sich auf den Kamm einer Drei-Meter-Welle, das Deck neigte sich nach vorn, und der Bug bohrte sich in den nächsten Brecher. Eine breite Gischtwolke schoss in die Höhe, verschlang die Reling, peitschte über das Deck und rüttelte an den Überresten der zertrümmerten Kommandobrücke.
Obenherum war die John Bury nur noch ein geschundenes Wrack. Qualm stieg von verbogenem Stahlschrott auf, wo Raketen in die Deckaufbauten eingeschlagen waren. Trümmerteile lagen auf dem Deck herum, dazwischen tote Mannschaftsangehörige. Aber die eigentlichen Schäden befanden sich oberhalb der Wasserlinie, und das fliehende Schiff würde das überstehen, wenn es weitere Treffer vermeiden konnte.
Am dunklen Horizont hinter ihm quollen Rauchwolken aus anderen Schiffen, die weniger Glück gehabt hatten. Über einem von ihnen blühte ein orangefarbener Feuerball auf, wurde von der aufgewühlten See reflektiert und erhellte für einen kurzen Moment den Schauplatz des Massakers.
Vier brennende Schiffskolosse waren zu erkennen: drei Zerstörer und ein Kreuzer – alles Schiffe, die die John Bury als Eskorte begleitet hatten. Ein japanisches Unterseeboot und eine Staffel Sturzbomber hatten sie gleichzeitig aufgespürt. Als die Abenddämmerung anbrach, brannte ein meilenlanger Ölteppich um die sinkenden Schiffe, der den Himmel mit dicken schwarzen Qualmwolken verhüllte. Keines dieser Schiffe würde den Sonnenaufgang erleben.
Die Kriegsschiffe wurden schnell unter Beschuss genommen und zerstört, aber die John Bury war lediglich bombardiert und mit Raketen getroffen worden und hatte ihre Fahrt ungehindert fortgesetzt. Für diese Art von Schonung gab es nur eine Erklärung: Die Japaner wussten von der streng geheimen Fracht, die sie transportierte, und wollten sie unbedingt in ihren Besitz bringen.
Captain Alan Pickett war entschlossen, es nicht so weit kommen zu lassen, auch wenn die Hälfte der Mannschaft tot und sein eigenes Gesicht von einem Granatsplitter getroffen worden war. Er ergriff das Sprechrohr und rief den Maschinenraum.
»Mehr Fahrt!«, verlangte er.
Er erhielt keine Antwort. Der letzten Meldung zufolge war unter Deck ein Feuer ausgebrochen. Pickett hatte seinen Männern zwar befohlen, auf dem Posten zu bleiben und es zu löschen, aber jetzt erfüllte ihn die Stille doch mit lähmender Angst.
»Zekes bugwärts an Backbord!«, rief ein Ausguck auf der Brückennock. »Auf zweitausend Fuß und sinkend.«
Pickett blickte durch die geborstene Glasscheibe. Im sinkenden Tageslicht sah er vier schwarze Punkte am grauen Himmel kreisen und im Sinkflug auf sein Schiff zukommen. Unter den Tragflächen zuckten Blitze.
»Deckung!«, brüllte er.
Zu spät. Kaliber-.50-Geschosse stanzten eine Linie in das Schiff, halbierten den Ausguck und zertrümmerten, was von der Kommandobrücke noch übrig war. Holzsplitter, Glasscherben und Stahltrümmer schossen durch den Raum.
Pickett warf sich aufs Deck. Ein Schwall glühend heißer Luft wälzte sich über die Kommandobrücke, als dicht vor ihr eine weitere Rakete einschlug. Der Treffer schüttelte das Schiff durch und rollte wie ein gigantischer Dosenöffner das stählerne Brückendach hoch.
Nachdem die Woge der Zerstörung über ihn hinweggeschwappt war, blickte Pickett auf. Seine letzten Offiziere waren tot, die Kommandobrücke glich einer Ruine. Sogar das Steuer des Schiffes war verschwunden. Übrig war nur noch ein stählerner Rest des Steuerrads an der Spindel. Doch irgendwie gelang es dem Schiff weiterzudampfen.
Während Pickett nach oben auf die Brücke kletterte, machte er eine Entdeckung, die ihn Hoffnung schöpfen ließ: dunkle Wolken und dichte Regenschleier. Eine Unwetterfront näherte sich zügig von Steuerbord. Falls er es schaffte, sein Schiff dort hineinzulenken, würde ihn die zunehmende Dunkelheit vor seinen Verfolgern verbergen.
Indem er sich am Schott abstützte, griff er nach dem, was vom Steuerrad noch übrig war. Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den kurzen Speichenrest. Dann bewegte er sich etwa eine halbe Spindeldrehung weiter, wobei Pickett den Halt verlor und zu Boden sank, jedoch nicht losließ.
Das Schiff änderte den Kurs.
Er suchte sich auf dem Deck eine sichere Position, drückte die Speiche nach oben und schaffte eine weitere Umdrehung.
Der Frachter gehorchte dem Ruder, schwenkte herum und erzeugte eine gebogene weiße Kiellinie auf der Wasseroberfläche, während er auf die Unwetterfront zusteuerte.
Dichte Wolkenberge türmten sich vor dem Bug auf. Die Regenvorhänge, die aus ihnen herabrauschten, fegten wie ein riesiger Besen über den Ozean. Zum ersten Mal seit Beginn des Angriffs glaubte Pickett, dass sie eine reelle Chance hatten, das nackte Leben zu retten. Doch während das Schiff weiter durch die hohe Dünung in Richtung Unwetter pflügte, ließ der anschwellende Lärm der Sturzkampfbomber, die gewendet hatten und zu einer weiteren Attacke zurückkehrten, diese Möglichkeit höchst zweifelhaft erscheinen.
Er blickte durch die klaffenden Einschusslöcher des Schiffes und hielt nach der Quelle des Lärms Ausschau.
Direkt vor ihm fielen zwei Aichi-D3A-Sturzkampfflugzeuge, sogenannte Vals, vom Himmel. Es war derselbe Flugzeugtyp, den die Japaner mit tödlicher Wirkung in Pearl Harbor und gegen die englische Flotte in den Gewässern Ceylons eingesetzt hatten.
Pickett beobachtete, wie sie abkippten, und hörte, wie das pfeifende Geräusch ihrer Tragflächen lauter wurde. Er stieß einen Fluch aus und zog seine Seitenwaffe.
»Haut ab von meinem Schiff!«, brüllte er und schoss mit seinem .45er Colt auf sie.
Im letzten Moment zogen sie hoch, rasten vorbei und überschütteten das Schiff mit einer Salve von Kaliber-.50-Geschossen. Pickett kippte rücklings aufs Deck, als ein Geschoss sein Bein durchschlug und es völlig zertrümmerte. Er riss die Augen weit auf und starrte in den Himmel. Bewegen konnte er sich nicht mehr.
Rauchwolken und grauer Himmel vereinigten sich und wälzten sich über ihn hinweg. Das war das Ende, dachte er. Das Schiff und seine geheime Fracht würden den Feinden schon bald in die Hände fallen.
Pickett machte sich heftige Vorwürfe, das Schiff nicht versenkt zu haben. Er hoffte, dass es irgendwie von allein unterging, ehe es jemand entern konnte.
Während die Umgebung vor seinen Augen allmählich verschwamm, drang der Lärm weiterer Sturzkampfflugzeuge an seine Ohren. Das Dröhnen der Motoren wurde lauter, und das Kreischen, das von den Tragflächen ausging, kündigte die schreckliche Unabwendbarkeit des Endes an.
Und dann verdunkelte sich der Himmel. Die Luft wurde eisig kalt und nass, und die S.S.John Bury stampfte mitten in das Unwetter hinein und wurde von einer Wand aus Dunst und Regen verschlungen.
Die letzte Meldung eines japanischen Piloten beschrieb sie als zwar brennend, aber in voller Fahrt. Nie mehr wurde etwas von ihr gesehen oder gehört.
1
NORDJEMEN, UNWEIT DER SAUDI-ARABISCHEN GRENZE
AUGUST 1967
Tariq al-Khalif verbarg sein Gesicht hinter einem Tuch aus weicher weißer Baumwolle. Die Kufiya bedeckte seinen Kopf und verhüllte Mund und Nase. Sonne, Wind und Sand hielt sie von seinem wettergegerbten Gesicht fern und versteckte ihn gleichzeitig vor der Welt.
Nur Khalifs Augen waren zu sehen, hart und scharf von sechzig Jahren unausgesetztem Leben in der Wüste. Sie blinzelten nicht oder wandten sich ab, während er die toten Körper betrachtete, die im Sand vor ihm lagen.
Insgesamt waren es acht. Zwei Männer, drei Frauen und drei Kinder: nackt, aller Kleider und ihres sämtlichen Besitzes beraubt. Die meisten waren erschossen worden, einige erstochen.
Während die Karawane hinter Khalif wartete, kam langsam ein Reiter auf ihn zu. Khalif erkannte die kräftige, junge Gestalt im Sattel. Ein Mann namens Sabah, sein vertrauenswürdigster Helfer und Stellvertreter. Ein aus russischer Produktion stammendes AK-47-Sturmgewehr hing an seiner Schulter.
»Ganz sicher Banditen«, sagte Sabah. »Mittlerweile längst über alle Berge.«
Khalif studierte den groben Sand unter und vor seinen Füßen. Er stellte fest, dass die Spuren nach Westen wiesen, direkt zur einzigen Wasserstelle im Umkreis von einhundertfünfzig Kilometern, der Oase Abi Quzza – dem »seidenen Wasser«.
»Nein, mein Freund«, sagte er. »Diese Männer warten nicht, bis sie entdeckt werden. Um zu verbergen, wie viele sie sind, bewegen sie sich auf felsigem Grund, wo sie keine Spuren hinterlassen. Oder sie gehen durch weichen Sand, wo ihre Fußspuren schnell verweht werden. Aber hier kann ich erkennen, dass sie zu unserem Lager wollen.«
Abi Quzza gehörte Khalifs Familie bereits seit mehreren Generationen. Die Oase versorgte sie mit lebenswichtigem Wasser und verhalf ihr zu einem bescheidenen Wohlstand. Dattelpalmen gediehen zwischen den zahlreichen Quellen in großer Menge, außerdem gab es ausreichend Gras für die Schafe und Kamele.
Mit einer zunehmenden Anzahl von Lastwagen und anderen Arten moderner Transportmittel wurden die Karawanen, die für die Segnungen der Oase bezahlten, weniger, und die Rolle, die Kamele züchtende Beduinen wie Khalif und seine Familie im Transportwesen der Wüste spielten, verlor in gleichem Maß an Bedeutung. Aber noch waren sie nicht gänzlich verschwunden. Damit der Clan überhaupt Aussichten auf ein Überleben hatte, musste die Oase um jeden Preis geschützt werden, das war Khalif völlig klar.
»Deine Söhne werden sie verteidigen«, sagte Sabah.
Die Oase lag etwa dreißig Kilometer entfernt im Osten. Khalifs Söhne, zwei Neffen und ihre Familien warteten dort. Ein halbes Dutzend Zelte, zehn Männer mit Gewehren. Fast eine kleine Festung, die nicht so leicht anzugreifen war. Dennoch verspürte Khalif eine gewisse Unruhe.
»Wir müssen uns beeilen«, sagte er und stieg wieder auf sein Kamel.
Sabah nickte. Er schob seine Kalaschnikow so zurecht, dass er sie schneller in Anschlag bringen konnte, und trieb sein Kamel an.
Drei Stunden später näherten sie sich der Oase. Von weitem konnten sie nichts anderes erkennen als vereinzelte kleine Feuer. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine zerfetzten Zelte oder umherirrenden Tiere, keine reglosen Leiber im Sand.
Khalif ließ die Karawane anhalten und saß ab. Er winkte Sabah und zwei andere Männer zu sich und ging zu Fuß weiter.
Die Stille ringsum war so vollkommen, dass sie das Knistern der Holzscheite in den Feuern und das Scharren ihrer eigenen Füße im Sand hören konnten. Irgendwo in der Ferne erklang der Ruf eines Schakals. Er kam von weit her, aber in der Wüste legte der Schall gewöhnlich lange Wege zurück.
Khalif blieb stehen und wartete ab, dass der Ruf des Schakals verhallte. Als er erstarb, wurde er durch einen angenehmeren Laut ersetzt: eine kindliche Stimme, die ein altes Volkslied der Beduinen sang. Sie drang aus dem Hauptzelt und klang ruhig und unbeschwert.
Allmählich entspannte sich Khalif. Es war die Stimme Jinns, seines jüngsten Sohnes.
»Holt die Karawane«, befahl Khalif. »Alles ist in Ordnung.«
Während Sabah und die anderen zu den Kamelen zurückkehrten, ging Khalif weiter. Er erreichte sein Zelt, schlug die Klappe zurück und erstarrte.
Vor ihm stand ein zerlumpter Bandit und hielt die Klinge eines gekrümmten Messers an die Kehle seines Sohnes. Neben ihm saß ein anderer Bandit mit einem alten Gewehr in den Händen.
»Eine falsche Bewegung, und ich schneide ihm den Hals durch«, drohte der Bandit mit dem Messer.
»Wer bist du?«
»Ich bin Masiq«, antwortete der Bandit.
»Was willst du?«, fragte Khalif.
Masiq zuckte die Achseln. »Was sollen wir schon wollen?«
»Die Kamele sind wertvoll«, sagte Khalif, der ahnte, worauf sie es abgesehen hatten. »Ich gebe sie euch. Verschont nur meine Familie.«
»Dein Angebot ist bedeutungslos für mich«, erwiderte Masiq, während sich sein Gesicht zu einer hasserfüllten Grimasse verzerrte. »Weil ich mir ohnehin nehmen kann, was ich will, und weil …« – er packte den Jungen fester – »außer dem hier deine Familie bereits tot ist.«
Khalifs Herz verkrampfte sich. In seinem Burnus verbarg er einen Webley-Fosbery-Automatic-Revolver. Die mit einem Selbstspannmechanismus versehene Waffe war robust und schoss mit tödlicher Genauigkeit. Sie versagte nicht einmal nach Monaten in der Sandwüste. Er überlegte, wie er jetzt an sie herankommen könnte.
»Dann gebe ich dir alles«, sagte er, »nur für ihn. Und du kannst unbehelligt gehen.«
»Du hast hier Gold versteckt«, stellte Masiq fest, als sei es eine allgemein bekannte Tatsache. »Sag uns, wo es ist.«
Khalif schüttelte den Kopf. »Ich habe kein Gold.«
»Du lügst«, sagte der zweite Bandit.
Masiq brach in Gelächter aus, wobei seine krummen Zähne und sein fauliger Mund einen grässlichen Laut erzeugten. Er presste den Jungen mit einem Arm fester an sich und hob den anderen, als wollte er ihm die Kehle durchschneiden. Doch der Junge rutschte aus der Umklammerung, streckte sich, erwischte Masiqs Finger mit dem Mund und biss mit aller Kraft zu.
Masiq fluchte vor Schmerz. Seine Hand zuckte zurück, als hätte er sich verbrannt.
Khalifs Hand fand den Revolver und jagte zwei Schüsse durch den weiten Mantel. Der Bandit kippte nach hinten, zwei qualmende Löcher in der Brust.
Der zweite Bandit feuerte, die Kugel streifte Khalifs Bein, aber Khalif schoss ihm sofort mitten ins Gesicht. Der Mann fiel ohne einen Laut – aber das war erst der Anfang.
Draußen vor dem Zelt hallte Gewehrfeuer durch die Nacht. Es wurde heftig geschossen, Kugeln flogen hin und her. Khalif identifizierte den Klang von ebenso schweren Gewehren, wie es das in der Hand des toten Banditen war. Ihnen antwortete das Rattern von Sabah und seiner Maschinenpistole.
Khalif packte seinen Sohn und drückte ihm die Pistole in die Hand. Er ergriff das alte Gewehr, das neben einem der toten Banditen lag. Dann hob er auch das gekrümmte Messer auf und drang tiefer in das Zelt ein.
Dort lagen seine älteren Söhne nebeneinander, als ob sie schliefen. Ihre Kleidung war mit dunklem Blut getränkt und über und über durchlöchert.
Tiefer Schmerz rollte wie eine Woge über Khalif hinweg, Schmerz, Bitterkeit und Wut.
Während das Gewehrfeuer draußen unvermindert anhielt, stieß er das Messer in die Seitenwand des Zelts und schnitt ein kleines Loch hinein. Er schaute hindurch und konnte so das Kampfgeschehen verfolgen.
Sabah und drei seiner Männer hatten hinter einem Wall toter Kamele Schutz gefunden und schossen von dort aus auf alles, was sich bewegte. Eine Gruppe Räuber, genauso gekleidet wie die Banditen, die er gerade getötet hatte, besetzten die Oase und verbargen sich hinter Dattelpalmen in knietiefem Wasser.
Doch anscheinend war ihre Anzahl so niedrig, dass sie das Lager unmöglich hatten durch Gewalt erobern können.
Er wandte sich an Jinn. »Wie sind diese Männer hierhergekommen?«
»Sie haben gefragt, ob sie über Nacht bleiben dürften«, antwortete der Junge. »Wir haben ihre Kamele getränkt.«
Dass sie die traditionelle Großzügigkeit der Beduinen und die Gastfreundschaft seiner Söhne ausgenutzt hatten, um sie nachher zu töten, steigerte Khalifs Wut ins Maßlose. Er ging zur anderen Seite des Zelts. Diesmal stieß er das Messer kräftig in den Stoff und drückte es mit einem heftigen Ruck nach unten.
»Bleib hier«, befahl er Jinn.
Khalif schlüpfte durch die Öffnung und tauchte in die Dunkelheit ein. Er schlug einen weiten Bogen, bis er sich im Rücken seiner Feinde befand und unbemerkt in die Oase gelangte.
Von Sabah und seinen Männern, die sich vor ihnen befanden, abgelenkt, bemerkten die Banditen nicht, wie sich Khalif an ihnen vorbeischlich. Er ging hinter ihnen in Stellung und eröffnete aus kürzester Entfernung das Feuer.
Drei wurden sofort ausgeschaltet und dann noch ein Vierter. Ein anderer wollte fliehen und wurde von einem Schuss aus Sabahs Waffe getroffen und getötet, aber der sechste und letzte Bandit wirbelte noch rechtzeitig herum und schoss zurück.
Eine Kugel traf Khalifs Schulter, schleuderte ihn zurück und löste in seinem Körper eine Schmerzexplosion aus. Er landete im Wasser.
Der Bandit rannte auf ihn zu. Wahrscheinlich hielt er ihn für tot oder für zu schwer verwundet, um sich zu wehren.
Khalif brachte das alte Gewehr in Anschlag und drückte ab. Die Patrone verkeilte sich jedoch in der Kammer. Er griff nach dem Verschlusshebel und zog daran, um sie zu befreien.
Der Bandit hob seine eigene Waffe und zielte auf Khalifs Brust. Und dann erklang der Knall des Webley-Revolvers wie ein Donner.
Der Bandit taumelte mit einem verwirrten Gesichtsausdruck gegen eine Dattelpalme. Er rutschte daran herab, während das Gewehr seinen Händen entglitt und im Wasser versank.
Jinn stand hinter dem toten Mann und hielt die Pistole in seinen zitternden Händen. Seine Augen füllten sich mit Tränen.
Khalif schaute sich um, suchte nach weiteren Feinden, fand jedoch keine mehr. Dann konnte er hören, wie Sabah den Männern etwas zurief. Der Kampf war vorüber.
»Komm her, Jinn«, verlangte Khalif.
Zitternd und mit unsicheren Schritten kam sein Sohn zu ihm. Khalif legte einen Arm um seine Schultern und drückte ihn an sich.
»Sieh mich an.«
Der Junge reagierte nicht.
»Sieh mich an, Jinn!«
Schließlich wandte Jinn den Kopf. Khalif hielt seine Schultern fest im Arm.
»Du bist noch zu jung, um zu verstehen, mein Sohn, aber du hast etwas Großartiges getan. Du hast deinen Vater gerettet. Mehr noch, du hast deine Familie gerettet.«
»Aber meine Brüder und meine Mutter sind tot«, klagte Jinn.
»Nein«, widersprach Khalif. »Sie sind im Paradies, und wir werden weiterleben, bis wir sie eines Tages wiedersehen.«
Jinn reagierte nicht, sondern schluchzte nur.
Ein Geräusch in seiner Nähe ließ Khalif herumfahren. Einer der Banditen lebte noch und versuchte wegzukriechen.
Khalif hob das gekrümmte Messer, bereit, dem Mann den Todesstoß zu versetzen, doch dann hielt er inne. »Töte ihn, Jinn.«
Der zitternde Junge starrte ihn mit leerem Blick an. Khalif erwiderte den Blick, zwingend und unbeugsam.
»Deine Brüder sind tot, Jinn. Die Zukunft des Clans ruht auf deinen Schultern. Du musst lernen, stark zu sein.«
Jinns Zittern wollte nicht nachlassen, aber Khalif war sich seiner Sache umso sicherer. Hilfsbereitschaft und Freigebigkeit hatten sie fast vernichtet. Diese Schwäche musste bei seinem einzigen überlebenden Sohn ausgemerzt werden.
»Du darfst niemals Mitleid haben«, sagte Khalif. »Er ist ein Feind. Wenn wir nicht die Kraft haben, unsere Feinde zu töten, werden sie uns das Wasser wegnehmen. Und ohne das Wasser bleibt uns nur noch, weiterzuwandern und … zu sterben.«
Khalif wusste, dass er Jinn zwingen konnte, das Verlangte zu tun, er wusste auch, dass er es ihm befehlen konnte und dass der Junge gehorchen würde. Aber es war wichtig, dass Jinn diese Tat aus eigenem Antrieb ausführte.
»Hast du Angst?«
Jinn schüttelte den Kopf. Er drehte sich langsam um und hob die Pistole.
Der Bandit blickte zu ihm auf, aber Jinn schwankte nicht, sondern seine Hand wurde ruhig. Er blickte dem Banditen ins Gesicht und drückte ab.
Der Knall der Pistole rollte über das Wasser und weit hinaus in die Wüste. Als er verhallte, versiegten die Tränen, die aus den Augen des Jungen sickerten.
2
INDISCHER OZEAN
JUNI 2012
Im abnehmenden Licht des Sonnenuntergangs glitt der neunzig Fuß lange Katamaran durch die ruhigen Fluten des Indischen Ozeans. Eine leichte Brise schob ihn mit drei oder vier Knoten Geschwindigkeit vor sich her. Über dem Deck blähte sich ein strahlend weißes Segel. In seiner Mitte bildeten fünf Fuß hohe türkisfarbene Lettern den Schriftzug NUMA – die allgemein geläufige Abkürzung für die National Underwater and Marine Agency.
Kimo A’kona stand dicht vor dem Bug eines der Doppelrümpfe des Katamarans. Er war dreißig Jahre alt, hatte jettschwarzes Haar, eine wie aus Marmor gemeißelte Statur, und einer seiner Arme und eine Schulter waren mit den verschlungenen Linien einer traditionellen hawaiianischen Tätowierung bedeckt. Er stand barfuß auf dem Bug und balancierte auf der Spitze, als führe er einen Hanging Ten auf einem Surfbrett aus.
Er hielt einen langen Stab in den Händen und tauchte ein Instrument, das an seinem Ende befestigt war, ins Wasser. Die Zahlen auf einem kleinen Display verrieten ihm, dass es einwandfrei funktionierte.
»Sauerstoffgehalt ziemlich gering, Temperatur einundzwanzig Grad Celsius beziehungsweise siebzig Komma vier Grad Fahrenheit«, verkündete er die Ergebnisse.
Kimo wurde von zwei anderen Personen beobachtet. Die eine, Perry Halverson, der Führer des Teams und älteste Angehörige der Mannschaft, stand am Ruder. Er trug Khakishorts, ein schwarzes T-Shirt und einen olivenfarbenen Boonie Hat, der seit Jahren sein äußeres Erscheinungsbild abrundete.
Hinter ihm stand Thalia Quivaros, von allen nur T genannt, in weißen Shorts und einem roten Bikinitop, das ihre Kurven ausreichend unterstrich, um beide Männer immer wieder abzulenken.
»Das ist bisher der niedrigste Wert«, stellte Halverson fest. »Drei ganze Grad kälter, als es um diese Jahreszeit sein dürfte.«
»Den Leuten, die ständig vor der globalen Erwärmung warnen, wird das gar nicht gefallen«, meinte Kimo.
»Wahrscheinlich nicht«, sagte Thalia, während sie die Werte in einen kleinen Tablet-Computer eingab. »Aber es ergibt ganz eindeutig ein Muster. Neunundzwanzig der letzten dreißig Werte weichen um mindestens zwei Grad ab.«
»Könnte es sein, dass hier ein Unwetter durchgezogen ist?«, fragte Kimo. »Und Regen oder Hagel abgeladen hat, die wir nicht in unsere Berechnungen einbeziehen?«
»Seit Wochen nicht«, erwiderte Halverson. »Es ist eine Anomalie, aber keine örtlich begrenzte Abweichung.«
Thalia nickte. »Tiefseemessungen der ferngesteuerten Sensoren, die wir abgesetzt haben, bestätigen unsere Beobachtungen. Die Temperaturabweichungen treten bis hinunter zur Thermokline auf. Man könnte meinen, dass die Sonnenwärme diese Region irgendwie ausspart.«
»Ich glaube nicht, dass die Sonne das Problem ist«, sagte Kimo. Die Lufttemperatur hatte ein paar Stunden zuvor ihren höchsten Wert von fünfunddreißig Grad Celsius erreicht, als die Sonne von einem wolkenlosen Himmel herabbrannte. Und noch während sie unterging, strahlte sie kräftig und warm.
Kimo zog erst das Instrument ein, überprüfte es und holte dann aus wie ein Fliegenfischer mit dem Stab. Er schleuderte den Sensor gut fünfzehn Meter vom Boot weg, wo er versank und wieder mitgeschleppt wurde. Der zweite Messwert war mit dem ersten identisch.
»Wenigstens haben wir etwas gefunden, das wir den hohen Tieren in D. C. präsentieren können«, sagte Halverson. »Sie glauben doch glatt, dass wir hier draußen auf einer Vergnügungsfahrt sind.«
»Ich tippe auf einen Auftrieb des Tiefenwassers«, sagte Kimo. »Vergleichbar mit dem El Niño/La Niña-Effekt. Aber da dies hier der Indische Ozean ist, werden sie ihm sicherlich einen Namen aus dem Hinduismus verpasst haben.«
»Vielleicht könnten sie diese Erscheinung einfach nach uns benennen«, schlug Thalia vor. »Den Quivaros-A’kona-Halverson-Effekt. Kurz QAH.«
»Beachte, dass sie sich selbst an erster Stelle nennt«, sagte Kimo zu Halverson.
»Ladies first«, sagte Thalia, nickte bestätigend und grinste.
Halverson lachte schallend, während er seinen Hut zurechtschob.
»Während ihr darüber streitet, sehe ich schon mal zu, dass ich irgendwas fürs Abendessen zusammenzaubere. Zum Beispiel könnte ich mit Fliegendem Fisch gefüllte Tacos zubereiten.«
Thalia musterte ihn zweifelnd. »Die hatten wir gestern Abend erst.«
»Die Angelhaken sind leer«, erwiderte Halverson. »Wir haben heute nichts gefangen.«
Kimo ließ sich das durch den Kopf gehen. Je weiter sie in die kalte Zone vordrangen, desto spärlicher wurde die Meeresfauna. Es war, als verwandelte sich der Ozean nach und nach in eine kalte Wüste. »Es klingt besser als Essen aus der Dose«, sagte er.
Thalia nickte, und Halverson verschwand in der Kabine, um das Abendbrot zuzubereiten. Kimo blieb an der Bugspitze stehen und blickte nach Westen.
Die Sonne war mittlerweile unter den Horizont gesunken, und der Himmel nahm einen indigofarbenen Schimmer an, mit einem hellorange strahlenden Saum dicht über dem Wasser. Die Luft war still und feucht, die Temperatur betrug um die dreißig Grad Celsius. Es war ein idyllischer Abend, abgerundet und perfektioniert von der Vorstellung, dass sie etwas Ungewöhnliches entdeckt hatten.
Sie hatten keine Ahnung, wodurch sie ausgelöst wurde, aber anscheinend brachte die auffällige Temperaturschwankung die Wetterlage in dieser Region völlig durcheinander. Bisher waren in einer Zeit, in der die Monsunregen einsetzten, in Süd- und Westindien nur verschwindend geringe Niederschläge zu verzeichnen gewesen.
Große Sorge breitete sich aus, da eine Milliarde Menschen auf den Beginn der regelmäßig einsetzenden Regenzeit warteten, die für eine ausreichende Reis- und Weizenernte lebenswichtig war. Soweit er gehört hatte, lagen die Nerven der Wartenden blank. Angesichts der mageren Ernte im vorangegangenen Jahr wurde bereits von einer drohenden Hungersnot gesprochen, wenn sich nicht bald einiges änderte.
Während sich Kimo darüber bewusst war, dass er in dieser Richtung nur wenig tun konnte, hoffte er, dass sie zumindest einer Erklärung der Ursache näher kamen. Die letzten Tage nährten immerhin die Hoffnung, dass sie auf der richtigen Spur waren. In einer Stunde, einige Meilen weiter westlich, würden sie abermals Messwerte registrieren. Bis dahin wartete erst einmal das Abendessen.
Kimo holte den Sensor wieder ein. Während er ihn aus dem Wasser zog, fiel ihm etwas Seltsames auf. Er kniff die Augen zusammen. In etwa einhundert Metern Entfernung breitete sich ein merkwürdiger schwarzer Glanz auf den Wellen aus – wie ein Schatten.
»Sieh dir das mal an«, sagte er zu Thalia.
»Du willst ja nur, dass ich zu dir nach vorn komme, damit du auf dem schmalen Bug mit mir auf Tuchfühlung gehen kannst«, scherzte sie.
»Ich meine es ernst«, sagte er. »Da ist irgendetwas auf dem Wasser.«
Sie legte den Tablet-Computer beiseite und ging nach vorn. Dabei legte sie eine Hand auf seinen Arm, um auf dem schmalen Bugspriet nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Kimo deutete auf den Schatten. Er breitete sich unverkennbar aus, bewegte sich wie Öl oder ein Algenteppich über die Wasseroberfläche, hatte jedoch eine Beschaffenheit, die mit nichts Bekanntem zu vergleichen war.
»Siehst du das?«
Sie folgte seinem Blick, dann setzte sie ein Fernglas an die Augen. Nach ein paar Sekunden ließ sie es wieder sinken.
»Das Licht hat dir einen Streich gespielt.«
»Es ist nicht das Licht.«
Sie blickte wieder durch das Fernglas, dann reichte sie es ihm. »Ich sage dir, da draußen ist nichts.«
Kimo spähte ins sinkende Licht. Täuschten ihn seine Augen? Er nahm das Fernglas zu Hilfe und suchte die Gegend ab. Dann ließ er es sinken, hielt es wieder vor die Augen und nahm es erneut herunter.
Nichts als Wasser. Keine Algen, kein Öl, kein seltsamer Schimmer auf dem Meer. Er ließ den Blick nach rechts und links wandern, um sicherzugehen, dass er nicht in die falsche Richtung schaute, aber die See sah wieder vollkommen normal aus.
»Ich versichere dir, da draußen war etwas«, sagte er.
»Netter Versuch«, erwiderte sie. »Lass uns essen.«
Thalia machte kehrt und tastete sich mit vorsichtigen Schritten zurück auf das Hauptdeck des Katamarans. Kimo warf einen letzten Blick aufs Meer hinaus, konnte dort aber nichts Ungewöhnliches erkennen. Dann schüttelte er den Kopf und machte ebenfalls kehrt, um seiner Kollegin zu folgen.
Ein paar Minuten später saßen sie in der Hauptkabine, schaufelten hungrig Fisch-Tacos à la Halverson in sich hinein und diskutierten aufgekratzt über die Ursachen der auffälligen Temperaturabweichung.
Während ihrer Mahlzeit trieb der Wind sie weiter nach Nordwesten. Der glatte Glasfiberbug schnitt durch die ruhige See, das Wasser glitt nahezu lautlos an der hydrodynamischen Wölbung der Rümpfe vorbei.
Und dann setzte eine Veränderung ein. Die Viskosität des Wassers nahm zu. Es wurde zähflüssiger. Die Wellen wurden länger und ein wenig langsamer. Die strahlend weißen Glasfiberrümpfe des Bootes verdunkelten sich an der Wasserlinie, als würden sie mit einer Farbe überzogen.
Dieser Vorgang dauerte einige Sekunden, in denen sich ein anthrazitgrauer Fleck auf dem Rumpf ausbreitete. Er wanderte aufwärts, unbehelligt von der Schwerkraft, als würde er von irgendetwas angezogen werden.
Die stoffliche Beschaffenheit des Flecks erinnerte an Graphit oder an eine dunklere, erheblich dünnere Version von Quecksilber. Nicht lange, und der vordere Rand des Flecks kroch über den Bug des Katamaranrumpfs und bedeckte den Punkt, auf dem Kimo während seiner Messungen gestanden hatte.
Bei eingehender Beobachtung hätte man ein Muster erkennen können. Für einen kurzen Moment waren in dem Fleck Umrisse von Fußabdrücken zu erkennen, doch dann glättete sich die Substanz wieder und glitt auf dem Bootsrumpf nach achtern in Richtung Kabine.
In der Kabine war ein Radio eingeschaltet. Eine Kurzwellenstation sendete klassische Musik. Es war die ideale Tischmusik, und Kimo genoss den Abend und die Gesellschaft genauso wie das Essen. Aber während sich Halverson wortreich dagegen wehrte, das Geheimnis seines Taco-Rezepts preiszugeben, machte Kimo eine beunruhigende Beobachtung.
Irgendetwas verdunkelte plötzlich die breiten getönten Fensterscheiben der Kabine, verdeckte die Sicht auf den Abendhimmel und schluckte den hellen Schein der Positionslampen des Bootes hoch oben am Mast. Die Substanz kletterte am Glas aufwärts wie vom Wind angewehter Schnee oder Sand, der sich an einem Hindernis mit glatter Außenfläche aufhäuft, nur viel, viel schneller.
»Was um alles in der Welt …«
Thalia schaute zum Fenster. Halversons Blick wanderte in die andere Richtung, zum Achterdeck, und ein erschreckter Ausdruck trat in seine Augen.
Kimo fuhr herum. Eine graue Substanz floss durch die offene Tür, wanderte über das Bootsdeck, bewegte sich jedoch aufwärts.
Thalia sah die Erscheinung ebenfalls. Sie kam direkt auf sie zu.
Sie sprang von ihrem Platz hoch und stieß dabei den Teller vom Tisch hinunter. Die letzten Happen ihres Abendessens landeten auf dem Deck vor der herankriechenden Masse. Als sie die Essensreste erreichte, schob sich die Masse darüber, bedeckte sie vollständig und breitete sich weiter aus.
»Was ist das?«, fragte Thalia.
»Keine Ahnung«, sagte Kimo. »So was hab ich noch nie …«
Er brauchte den Satz nicht zu beenden. Keiner von ihnen hatte jemals so etwas gesehen. Außer …
Kimos Augen verengten sich. Die seltsame Substanz verhielt sich wie eine Flüssigkeit, hatte jedoch eine körnige Konsistenz. Sie erschien eher wie ein metallisches Pulver, das sich vorwärtswälzte, so ähnlich wie Sanddünen, die der Wind aufwirbelt und vor sich hertreibt.
»Das ist es, was ich vorhin auf dem Wasser gesehen habe«, sagte er und wich zurück. »Ich wusste doch, dass da draußen irgendetwas Ungewöhnliches war.«
»Was tut es?«
Alle drei waren jetzt auf den Beinen und zogen sich zurück.
»Sieht so aus, als würde es den Fisch fressen«, sagte Halverson.
Kimo schwankte bei dem Anblick zwischen Angst und Staunen. Er schaute durch die offene Tür. Das gesamte Achterschiff war mit der Substanz bedeckt.
Er suchte einen Fluchtweg. Weiter vorn befanden sich die Kojen des Katamarans. Dort säßen sie in der Falle. Nach achtern zu fliehen würde aber bedeuten, dass sie auf die merkwürdige Substanz traten.
»Los, kommt«, sagte er und stieg auf den Tisch. »Ganz gleich, was dieses Zeug sein mag, ich denke, wir wollen damit ganz sicher nicht in Berührung kommen.«
Während Thalia zu ihm hochkletterte, streckte Kimo eine Hand zum Oberlicht aus und stieß es auf. Er hob Thalia hoch, und sie zog sich nach oben durch die Öffnung und auf das Kabinendach.
Halverson kletterte als Nächster auf den Tisch, rutschte jedoch aus. Sein Fuß tauchte in den metallischen Staub und ließ ihn hochspritzen wie Wasser in einer Pfütze. Etwas davon traf seine Wade.
Halverson gab einen Laut von sich, als sei er von einem Insekt gestochen worden. Er bückte sich, um die Substanz von seinem Bein abzuwischen, aber die Hälfte der Partikel blieb an seiner Hand kleben.
Er schüttelte sie heftig und rieb sie an seinen Shorts ab.
»Das Zeug brennt auf der Haut«, sagte er mit schmerzverzerrtem Gesicht.
»Komm hoch, Perry!«, rief Kimo.
Halverson, an dessen Hand und Bein immer noch ein wenig von dem silbrig glänzenden Staub haftete, schwang sich auf den Tisch, der unter dem Gewicht der beiden Männer nachgab.
Kimo streckte sich nach dem Rand des Oberlichts aus und hielt sich fest, aber Halverson stürzte ab. Er landete auf dem Rücken und schlug mit dem Kopf auf. Der Aufprall trübte offenbar für einen kurzen Moment seine Sinne. Er stöhnte, rollte sich herum und stützte die Hände aufs Deck, um sich hochzustemmen.
Die graue Substanz verteilte sich auf ihm, bedeckte seine Hände, seine Arme und den Rücken. Er schaffte es, sich aufzurichten und an die Kabinenwand zu lehnen, aber einige Staubpartikel erreichten sein Gesicht. Halverson schlug sich mit den Händen auf die Wangen und die Stirn, als sei er in einen Bienenschwarm geraten. Zwar hatte er die Augen fest geschlossen, aber die seltsamen Staubkörner fanden dennoch einen Weg unter seine Augenlider, in seine Nasenlöcher und seine Ohren.
Er löste sich von der Kabinenwand und sank auf die Knie. Er griff sich an die Ohren und schrie auf. Die Substanz sammelte sich auf seinen Lippen und strömte in seine Kehle und verwandelte seine Schreie in das krampfhafte Würgen eines Erstickenden. Halverson kippte nach vorn. Die sich ausbreitende graue Masse bedeckte ihn, als würde er von einem Ameisenheer im Urwald verschlungen werden.
»Kimo!«, rief Thalia.
Ihre Stimme riss Kimo aus seiner Trance. Er zog sich hoch und schlängelte sich durch die Öffnung aufs Dach der Kabine. Dort schlug er das Oberlicht zu und sicherte es mit der Außenverriegelung. Im Licht der Scheinwerfer oben am Mast konnte er erkennen, dass die graue Masse das gesamte Boot vom Bug bis zum Heck verhüllte. Außerdem kroch sie an der Kabinenwand aufwärts.
Hier und da hatte die Masse verschiedene Gegenstände unter sich begraben wie kurz vorher die Essensreste und Halverson.
»Das Zeug kommt zu uns herauf!«, rief Thalia.
»Berühr es bloß nicht!«
Auf seiner Seite war der wandernde Schwarm noch nicht so weit vorgedrungen. Kimo griff über die Dachkante auf der Suche nach irgendetwas, womit er sich zur Wehr setzen konnte. Seine Hand ertastete den Wasserschlauch, mit dem gewöhnlich das Deck gereinigt wurde. Er öffnete die Düse und richtete sie auf die graue Masse.
Der Hochdruckwasserstrahl traf die Partikel und spülte sie von der Kabinenwand wie lästigen Schmutz.
»Auf dieser Seite auch!«
Er kam zu ihr hinüber und attackierte die graue Invasion mit dem Wasserstrahl.
»Bleib hinter mir!«, rief er und schwenkte den Druckstrahl hin und her.
Das Wasser hielt den gespenstischen Gegner anfangs auf Distanz. Doch es war ein aussichtsloser Kampf. Der graue Schwarm hatte sie umzingelt und rückte von allen Seiten näher auf sie zu. Ganz gleich, wie sehr er sich bemühte, Kimo konnte ihn nicht zurücktreiben.
»Wir sollten springen«, rief Thalia.
Kimo blickte auf den Ozean. Die Erscheinung bedeckte die Meeresoberfläche vor dem Boot, so weit das Auge reichte.
»Das sollten wir lieber nicht tun«, warnte er.
Verzweifelt nach einer wirkungsvollen Waffe Ausschau haltend, suchte er das Deck ab. Zwei Fünf-Gallonen-Kanister Benzin standen dicht vor dem Bootsheck. Er richtete die Schlauchdüse auf die Kanister und schwenkte sie hin und her, um einen Weg durch die graue Staubschicht freizuräumen.
Er ließ den Schlauch fallen, machte ein paar Laufschritte und sprang. Er landete auf dem nassen Deck, rutschte ein Stück und prallte gegen den Heckspiegel am Ende des Bootes.
Ein Brennen auf seinen Händen und Beinen – als würde Wundbenzin auf Hautverletzungen geträufelt – verriet ihm, dass ihn die graue Masse ebenfalls gefunden hatte. Er ignorierte die Schmerzen, schnappte sich den ersten Kanister und leerte ihn auf dem Bootsdeck aus.
Die graue Masse wich vor der Flüssigkeit zurück, machte ihr Platz, wo sie ihr zu nahe kam, und suchte sich einen neuen Weg, um weiter vorzudringen.
Oben auf dem Kabinendach setzte Thalia den Kampf mit Hilfe des Wasserschlauchs fort, doch die Fläche, die noch nicht von der gespenstischen Invasion besetzt worden war, wurde ständig kleiner. Plötzlich stieß sie einen Schrei aus und ließ den Schlauch fallen, als ob sie kapitulierte. Sie wirbelte herum und kletterte am Mast empor, doch Kimo konnte erkennen, dass die graue Substanz ihre Beine bedeckte.
Sie schrie und stürzte. »Kimo!«, klagte sie. »Hilf mir. Hilf …«
Er verteilte das restliche Benzin auf dem Deck und griff nach dem zweiten Kanister. Er war leicht und fast leer. Angst schnitt wie eine Messerklinge durch Kimos Herz.
Von dort, wo Thalia aufs Deck aufgeschlagen war, waren nur noch ein ersticktes Gurgeln und Kampfgeräusche zu hören. Alles, was er sehen konnte, war ihre Hand, die zuckend aus der wogenden Masse der mörderischen Partikel herausragte. Direkt vor ihm hatte sich die Masse wieder gesammelt und suchte einen Weg zu seinen Füßen.
Er blickte abermals aufs Meer hinaus. Die Substanz bedeckte die Wasseroberfläche wie eine Schicht aus flüssigem Metall, so weit der Lichtschein der Positionslampen reichte. Kimo stellte sich der schrecklichen Erkenntnis, dass eine Flucht unmöglich war.
Da er nicht genauso sterben wollte wie Thalia und Halverson, traf er eine qualvolle Entscheidung.
Er kippte den letzten Rest Benzin auf das Deck, trieb den gespenstischen Schwarm damit abermals zurück, holte ein Feuerzeug aus der Hosentasche und ließ sich auf ein Knie sinken. Er hielt das Feuerzeug dicht über das von Benzin triefende Deck, wappnete sich gegen das, was ihn gleich erwartete, und betätigte mit dem Daumen den Zündmechanismus.
Funken blitzten auf, und die Benzindämpfe entzündeten sich. Ein Feuerblitz wälzte sich vom Heck über den ganzen Katamaran. Flammen rasten durch die herandrängende graue Substanz bis zur Kabine und kehrten dann zu Kimo zurück, loderten um ihn herum in die Höhe und setzten ihn in Brand.
Die Schmerzen waren selbst für die wenigen Sekunden Leben, die ihm noch blieben, zu grässlich. Eingehüllt in eine Feuersäule und unfähig, mit seiner verbrannten Lunge einen Schrei zu erzeugen, taumelte Kimo A’kona rückwärts und versank im Ozean.
3
Es war kurz nach Mitternacht, als Kurt Austin in der halbdunklen Werkstatt in der unteren Etage seines Bootshauses stand.
Breitschultrig und ziemlich attraktiv, tendierte Kurt in seinem Aussehen eher in Richtung robust als aufsehenerregend. Sein Haar war stahlgrau und passte zwar nicht ganz zu einem Mann, der aussah, als sei er gerade erst Mitte dreißig, jedoch ausgezeichnet zu dem Mann, den alle seine Freunde kannten und schätzten. Er hatte ein kantiges Kinn und regelmäßige, aber keinesfalls perfekte Zähne. Nach Jahren, die er auf dem Wasser und unter freiem Himmel verbracht hatte, war sein Gesicht von der Sonne gebräunt und von markanten Linien durchzogen.
Unbeugsam und solide waren die Begriffe, die ihn am treffendsten beschrieben. Zu diesem rauen Gesicht gehörte jedoch ein durchdringender Blick. Kurt Austins Gewohnheit, seine jeweiligen Gesprächspartner stets in aller Offenheit einer genauen visuellen Prüfung zu unterziehen, und das Leuchten seiner korallenblauen Augen weckten bei vielen das Gefühl, überrumpelt zu werden und nichts vor ihm verbergen zu können.
In diesem Moment studierten diese Augen das Endprodukt einer langen liebevollen Arbeit.
Kurt Austin baute ein Rennboot. Beherrscht wurden seine Gedanken von Überlegungen zur Leistungsfähigkeit, zu Strömungswiderstandskoeffizienten und Leverage-Faktoren und von den Berechnungen der Kraft, die von einem Menschen erzeugt werden kann.
In der Luft lag der Geruch von Bootslack, und der Fußboden war mit Sägemehl, Holzspänen und anderem Abfall bedeckt, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hatte und anzeigte, wie weit die Arbeit an einem von Hand gefertigten Boot vorangeschritten war.
Nach monatelanger, häufig unterbrochener Arbeit hatte Kurt Austin nun das Gefühl, etwas nahezu Perfektes geschaffen zu haben. Zwanzig Fuß lang. Schmal und schnittig. Der honiggoldene Schimmer des Holzboots entwickelte unter neun Schichten Bootslack einen Glanz, der den gesamten Raum erhellte.
»Verdammt feines Boot«, murmelte er, während er das fertige Produkt begutachtete.
Die glasartige Hochglanzlackierung des Bootes ließ seine Farbe meilentief erscheinen. Eine kleine Veränderung des Blickwinkels, und der Raum wurde vom Bootsrumpf reflektiert.
Auf der einen Seite des Spiegelbilds stand ein ganzer Werkzeugsatz unberührt in einer hellroten Kiste. Auf der anderen Seite, akkurat an der Rückwand der Werkbank befestigt, befand sich eine Kollektion alter Hämmer, Sägen und Hobel, die Holzgriffe waren vom Alter rissig und verfärbt.
Das neue Werkzeug hatte er selbst gekauft, das alte bestand aus Erbstücken seines Großvaters – ein Geschenk und eine Botschaft zugleich. Und genau in der Mitte, wie jemand, der zwischen zwei Welten gefangen ist, erkannte Kurt sein eigenes Spiegelbild.
Dieser Vergleich war in jeder Hinsicht zutreffend. Kurt Austin bediente sich bei seiner Arbeit vordringlich modernster Technologien, liebte jedoch auch die alten Dinge dieser Welt: antike Waffen, Vorkriegs- und viktorianische Architektur und sogar historische Briefe und Dokumente. All dies erregte gleichermaßen sein Interesse. Aber die Boote, die er besaß, und dazu gehörte auch das, welches er soeben fertiggestellt hatte, erzeugten ein Gefühl unbändiger, reinster Freude in ihm.
Einstweilen ruhte die schlanke Schönheit in ihrem Tragegerüst wie in einer Wiege, aber schon morgen würde er sie herausheben und sie mitsamt den Rudern zu ihrer Jungfernfahrt aufs Wasser setzen. Dann würde das Rennboot, angetrieben von der beträchtlichen Kraft seiner Arme, Beine und seines Rückens, mit erstaunlichem Tempo über die glatte Oberfläche des Potomac gleiten.
Bis dahin, sagte er sich, sollte er lieber aufhören, sich visuell an seinem Werk zu berauschen, sonst wäre er am Morgen zu müde für eine Ruderpartie.
Er ließ die Werkstatttür herunter und streckte die Hand nach dem Lichtschalter aus.
Ehe er ihn betätigen konnte, ließ ihn ein unangenehmes Summen zusammenzucken. Der Schuldige war sein Mobiltelefon, das auf dem Schreibtisch vibrierte. Er schnappte sich den Apparat, erkannte sofort den Anrufernamen auf dem Display und drückte auf die Antworttaste.
Es war Dirk Pitt, der Direktor der NUMA, Kurt Austins Chef und guter Freund. Ehe er die Position des Direktors übernahm, hatte Pitt gut zwanzig Jahre lang im Rahmen diverser Sonderprojekte für die Organisation immer wieder Leib und Leben riskiert. Gelegentlich tat er das immer noch.
»Tut mir leid, dich mitten in der Nacht zu stören«, sagte Pitt. »Ich hoffe, du bist allein.«
»Tatsächlich«, erwiderte Austin und ließ den Blick zum Boot zurückwandern, »befinde ich mich gerade in Gesellschaft einer bildschönen Blondine. Sie ist grazil und seidenglatt. Und ich weiß schon jetzt, dass ich sehr viel Zeit mit ihr verbringen werde.«
»Ich fürchte, dass du all das verschieben und dich sogar schon für heute Nacht von ihr verabschieden musst«, sagte Pitt.
Der ernste Unterton in Dirk Pitts Stimme war deutlich zu hören.
»Was ist passiert?«
»Kennst du Kimo A’kona?«, fragte Pitt.
»Ich habe bei dem Hawaiian Ecology Project mit ihm zusammengearbeitet«, antwortete Austin. Ihm war auf Anhieb klar, dass Pitt niemals eine Unterhaltung auf diese Art und Weise beginnen würde, wenn er nicht irgendetwas sehr Ernstes auf Lager hatte. »Er ist ziemlich gut. Warum fragst du?«
»Er war für uns im Rahmen eines Projekts im Indischen Ozean tätig«, begann Pitt. »Perry Halverson und Thalia Quivaros gehörten zu seinem Team. Seit zwei Tagen haben wir keinen Kontakt mehr.«
Das gefiel Kurt Austin ganz und gar nicht, aber Funkgeräte konnten versagen, manchmal sogar die gesamte Stromversorgung, und oft genug tauchten Bootsbesatzungen gesund und munter wieder auf.
»Was ist geschehen?«
»Das wissen wir nicht, aber heute Morgen wurde ihr Katamaran gesichtet: steuerlos treibend und fünf Meilen von der Position entfernt, in der er sich eigentlich hätte befinden müssen. Ein Flugzeug ist am Nachmittag von den Malediven aus gestartet und hat das Boot niedrig überflogen. Auf den Fotos, die der Pilot bei dieser Gelegenheit gemacht hat, sind schwere Brandschäden an einem der Zwillingsrümpfe zu erkennen. Von der Besatzung keine Spur.«
»Woran haben sie gearbeitet?«
»Sie haben die Wassertemperatur sowie den Salz- und Sauerstoffgehalt gemessen«, sagte Pitt. »Nichts Gefährliches. Solche Jobs reserviere ich gewöhnlich für dich und Joe.«
Kurt Austin konnte sich nicht vorstellen, dass sich jemand durch eine solche Studie angegriffen fühlte. »Und trotzdem glaubst du, dass irgendeine unbekannte Partei ihre Finger im Spiel hatte?«
»Wir wissen nicht, was da genau vorgefallen sein kann«, sagte Dirk. »Aber irgendetwas ist an der Sache faul. Wir können aus der Luft die Rettungsinseln erkennen. Die Container sind mit Feuer in Berührung gekommen, ansonsten jedoch unversehrt geblieben. Halverson ist seit zehn Jahren im Geschäft. Und davor war er acht Jahre lang bei der Handelsmarine. Kimo und Thalia sind jünger, aber bestens ausgebildet. Niemand hier in der Zentrale findet eine Erklärung für ein derart ausgedehntes Feuer auf einem Segelboot. Und selbst wenn es eine Erklärung gäbe, kann niemand die Frage beantworten, weshalb drei ausgebildete Seeleute es nicht schaffen konnten, unter diesen Bedingungen ein Rettungsfloß zu Wasser zu lassen oder einen Notruf zu senden.«
Kurt Austin überlegte. Auch er fand keine plausible Erklärung dafür, es sei denn, die drei wären aus irgendeinem Grund zu solchen Maßnahmen nicht mehr fähig gewesen.
»Eins ist jedenfalls eindeutig klar, sie werden vermisst«, sagte Dirk Pitt. »Vielleicht finden wir sie schon bald. Aber wir beide sind lange genug in diesem Geschäft tätig, um zu erkennen, dass es nicht gut aussieht.«
Kurt Austin machte sich keine Illusionen. Drei Angehörige der NUMA waren verschwunden und hatten wahrscheinlich den Tod gefunden. So etwas nahmen Dirk Pitt und Kurt Austin persönlich.
»Was soll ich tun?«
»Zurzeit wird ein Bergungsteam auf den Malediven zusammengestellt«, sagte Pitt. »Ich möchte, dass du und Joe euch so schnell wie möglich zum Ort des Geschehens begebt. Das bedeutet, dass du in vier Stunden in einem Flugzeug sitzen müsstest.«
»Kein Problem«, sagte Kurt Austin. »Wird bereits nach ihnen gesucht?«
»Ein Rettungsflugzeug von den Malediven, zwei P-3 der Navy und eine Langstreckenstaffel aus Südindien nehmen die Region, in der das Boot gefunden wurde, unter die Lupe. Bisher allerdings ohne Ergebnis.«
»Demnach ist das Ganze keine Rettungsaktion.«
»Ich wünschte, sie wäre es«, sagte Pitt. »Aber solange wir keine positiven Rückmeldungen erhalten, mit denen ich offen gesagt auch nicht rechne, besteht euer Job darin zu ermitteln, was passiert ist und warum.«
Unsichtbar für Dirk Pitt stand Kurt Austin in der dunklen Werkstatt und nickte. »Verstanden.«
»Ich überlasse es dir, Mr. Zavala zu wecken«, sagte Pitt. »Halt mich auf dem Laufenden.«
Kurt Austin wiederholte die Anweisungen, und Dirk Pitt unterbrach die Verbindung.
Während Kurt das Telefon auf den Tisch legte, beschäftigte er sich in Gedanken bereits mit der bevorstehenden Mission. Er hoffte gegen jede Vernunft, dass die drei NUMA-Angehörigen lebendig in ihren Rettungswesten gefunden worden wären, sobald er den Atlantik überquert hatte, aber angesichts der beschriebenen Schäden am Katamaran und des langen Zeitraums, den das Forschungsteam bereits vermisst wurde, hatte er seine Zweifel.
Er steckte das Mobiltelefon in die Hosentasche und nahm mit einem letzten langen Blick Abschied von dem eleganten Boot, das er gebaut hatte.
Ohne zu zögern, schaltete er danach das Licht aus und ging hinaus.
Seine Rendezvouspartnerin würde leider warten müssen.
4
ZENTRALJEMEN
Eine in einen weißen Mantel gehüllte Gestalt stand auf einem Felsvorsprung, der über den Sand der ausgedehnten Wüste im Innern des Jemen hinausragte. Der Wind zerrte an ihrem Kaftan und erzeugte ein gedämpftes flappendes Geräusch, als der fließende Stoff im Luftzug flatterte.
Ein strahlend weißer Helikopter stand auf der Felsschulter hinter dem Mann. Ein grünes Emblem, das zwei Dattelpalmen zeigte, die einer Oase Schatten spendeten, verzierte seine Seitenflächen. Drei Stockwerke darunter befand sich der Eingang zu einer geräumigen Höhle.
In früheren Zeiten wäre die Höhle von ein paar Beduinen bewacht worden, die sich in den tiefen Spalten der Felsschulter versteckten, doch an diesem Tag waren ein Dutzend Männer mit Gewehren zu sehen, während ungefähr zwanzig weitere in Deckung geblieben waren.
Jinn al-Khalif setzte einen Feldstecher an die Augen und richtete ihn auf einen kleinen Konvoi von drei Humvees, die in seine Richtung durch die Wüste rollten. Sie pflügten die Dünen hinauf und hinunter wie kleine Boote, die gegen die Dünung des Ozeans kämpfen. In Pfeilformation kamen sie stetig näher.
»Sie folgen dem alten Weg«, sagte er zu einer männlichen Gestalt, die halblinks hinter ihm stand. »Zu Lebzeiten meines Vaters wären es Gewürzkarawanen und Händler gewesen, Sabah. Jetzt sind es nur noch Bankiers, die uns besuchen.«
»Du solltest dir über ihre Absichten im Klaren sein«, sagte Sabah. »Unser Kampf ist ihnen völlig gleichgültig. Sie kommen hierher, weil du ihnen Reichtum versprichst. Du musst liefern, ehe wir unsere Pläne in die Tat umsetzen können.«
»Ist Xhou bei ihnen?«
Sabah nickte. »Das ist er. Mit seiner Ankunft sind sämtliche Mitglieder des Konsortiums anwesend. Wir sollten sie nicht warten lassen.«
»Und was ist mit General Aziz, dem Ägypter?«, fragte Jinn. »Hält er weiterhin die Gelder zurück, die er uns versprochen hat?«
»Er wird sich in drei Tagen bei uns melden«, sagte Sabah. »Dann ist der Zeitpunkt für ihn günstiger.«
Jinn al-Khalif sog die reine Wüstenluft in einem tiefen Atemzug in seine Lunge. Im Auftrag einer Gruppe ägyptischer Geschäftsleute und des Militärs hatte Aziz dem Konsortium viele Millionen zugesagt, bisher jedoch noch keinen einzigen Cent gezahlt.
»Aziz verspottet uns«, sagte Jinn.
»Wir werden mit ihm reden und dafür sorgen, dass er unsere Interessen im Auge hat«, versuchte Sabah abzuwiegeln.
»Nein«, widersprach Jinn. »Er wird uns weiter hinhalten, weil er es kann. Weil er glaubt, dass wir nicht an ihn herankommen.«
Sabah sah Jinn fragend an.
»Das ist die Antwort auf das Rätsel des Lebens«, sagte Jinn. »Geld oder Reichtum oder Lust oder sogar Liebe sind nicht die wichtigen Dinge. Nichts von alldem konnte mich schützen, als die Banditen unser Lager überfielen. Es gibt nur eines, das wirklich zählt, und zwar heute wie auch damals schon: Macht. Reine, alles beherrschende Macht. Wer sie innehat, regiert. Und wer sie nicht besitzt, der ist zum Betteln verurteilt. Aziz hat uns in die Position des Bittenden gedrängt, aber ich werde schon bald den Spieß umdrehen. Ich werde eine Macht erlangen, die zuvor noch nie ein Mensch besessen hat.«
Sabah nickte langsam, und ein Lächeln ließ seinen Bart zittern. »Du hast deine Lektion begriffen, Jinn. Sogar noch besser, als ich zu hoffen gewagt habe. Du hast deinen Lehrer wahrlich überflügelt.«
Unter ihnen bremsten die Humvees vor dem Höhleneingang.
»Du bist der Polarstern gewesen, der mich leitete«, sagte Jinn. »Deshalb hat mich mein Vater vertrauensvoll in deine Obhut gegeben.«
Sabah deutete eine Verbeugung an. »Ich danke dir für deine freundlichen Worte. Aber jetzt lass uns die Gäste begrüßen.«
Minuten später betraten sie die Höhle drei Stockwerke tiefer. Dort betrug die Temperatur siebenundzwanzig Grad Celsius im Gegensatz zu dem vierzig Grad heißen Wind, der draußen aufgekommen war und den Sand gegen die Felsen peitschte.
Trotz der primitiven Umgebung saßen die versammelten Gäste in bequemen Sesseln an einem schwarzen Konferenztisch. Der Raum war früher eine natürliche Höhle gewesen, die man aufwändig vergrößert und ausgebaut hatte. Jetzt war sie ein großer, modern eingerichteter Versammlungsraum.
Kleine Bildschirme waren vor den Konferenzteilnehmern in die Tischplatte eingelassen. An den Wänden standen Computer aufgereiht. In anderen Räumen außerhalb des Saals befanden sich Schlafgelegenheiten und Waffendepots.
Unter enormem Aufwand hatte Jinn diesen alten Beduinentreffpunkt von einer staubigen Felsenkammer in eine moderne Schaltzentrale umgewandelt. Es war ein langwieriges und kompliziertes Projekt gewesen, ähnlich der Entwicklung seiner Familie von einem Nomadenclan, der mit Kamelen und traditionellen Waren handelte, in ein modernes Wirtschaftsimperium, das in technologische Unternehmen, Ölförderung und Schifffahrtslinien investierte.
Verschwunden waren die Kamele und die Oase, die seit Jahrhunderten die wirtschaftliche Basis seiner Familie gebildet hatten. Ersetzt wurden sie durch kleine, überschaubare Beteiligungen an modernen Firmen. Alles, was sich aus jener Zeit erhalten hatte, waren die Worte seines Vaters: Du darfst niemals Mitleid haben… Ohne das Wasser bleibt uns nur noch, weiterzuwandern und… zu sterben.
Jinn hatte diese Botschaft oder die Notwendigkeit absoluter Skrupellosigkeit, um sich stets daran zu halten, nie vergessen. Mit Sabahs Hilfe und der finanziellen Unterstützung derer, die sich in seiner Höhle versammelt hatten, war er nur einen Schritt davon entfernt, die Kontrolle über die Wasservorräte der halben Welt an sich zu reißen, so wie sein Vater die Kontrolle über die Oase innegehabt hatte.
Mr. Xhou kam mit seinen Beratern im Schlepptau herein. Sabah begrüßte ihn und geleitete ihn zu seinem Platz. Neun wichtige Männer hatten sich eingefunden. Mr. Xhou aus China. Mustafa aus Pakistan. Scheich Abin da-Alhrama aus Saudi-Arabien. Aus dem Iran war Suthar gekommen, Attakari aus der Türkei und mehrere weniger gewichtige Gäste aus Nordafrika, den ehemaligen Sowjetrepubliken und aus anderen arabischen Ländern.
Sie waren keine Regierungsvertreter, sondern Geschäftsleute, Männer, die an Jinns Plan finanziell beteiligt waren.
»Dank der Gnade Allahs sind wir wieder vereint«, begann Jinn.
»Verschonen Sie uns mit religiösen Erklärungen«, sagte Mr. Xhou. »Berichten Sie lieber von Ihren Fortschritten. Sie haben uns hierhergebeten, um uns um weitere Gelder zu bitten, aber vorher würden wir gerne etwas von den Auswirkungen sehen, die Sie uns bereits angekündigt haben.«
Xhous unverhohlenes Misstrauen ärgerte Jinn, aber er war der bedeutendste Investor, sowohl hinsichtlich der Summen, die er Jinn zur Verfügung stellte, als auch seiner Beteiligungen, für die er sich den von Jinn angekündigten Profit versprach. Deshalb hatte er von Anfang an kein Hehl aus seiner Ungeduld gemacht, endlich Erfolge zu sehen. Er konnte es kaum erwarten, mit seinen Investitionen in die Gewinnzone zu gelangen. Und da Aziz sie im Augenblick regelrecht zappeln ließ, brauchte Jinn die Unterstützung Zhous mehr denn je.
»Wie Sie wissen, konnte General Aziz die versprochenen Mittel nicht beibringen.«
»Vielleicht klugerweise«, sagte Xhou. »Bisher haben wir Milliarden ausgegeben und nur wenig dafür erhalten. Ich besitze zurzeit gut achthunderttausend Hektar wertloser mongolischer Wüste. Wenn sich Ihre vollmundigen Ankündigungen nicht bald bewahrheiten, ist meine Geduld erschöpft.«
»Ich versichere Ihnen«, erwiderte Jinn, »dass die Fortschritte schon in Kürze sichtbar sein werden.«
Er ergriff eine Fernbedienung, drückte auf den Einschaltknopf, und die kleinen Bildschirme vor den versammelten Gästen wurden hell. Ein größeres Display an der Wand zeigte das gleiche Bild: eine farbige Darstellung der Arabischen See und des Indischen Ozeans. Rote, orangefarbene und gelbe Sektoren zeigten Regionen unterschiedlicher Wassertemperatur. Zirkulierende Pfeile repräsentierten sowohl Richtung als auch Geschwindigkeit der Meeresströmungen.
»Dies ist das derzeitige Strömungsmuster des Indischen Ozeans, basierend auf den Durchschnittsdaten der letzten dreißig Jahre«, erklärte Jinn. »Im Winter und im Frühling verlaufen die Strömungen in diesem Muster von Osten nach Westen, also entgegen dem Uhrzeigersinn, angetrieben von kalten trockenen Hochdruckwinden aus Indien und China. Aber im Sommer verändert sich das Muster. Die Kontinente erwärmen sich schneller als das Meer. Die Luft steigt auf und erzeugt einen landeinwärts gerichteten Wind. Das Strömungssystem kehrt sich um, fließt im Uhrzeigersinn und bringt den Monsun nach Indien.«
Jinn drückte auf einen Knopf der Fernbedienung, um seinen Gästen die Umkehrung des Strömungssystems zu demonstrieren.
»Wie Sie wissen, entstehen die Winde durch Temperatur- und Luftdruckgefälle. Die Winde wiederum bestimmen die Meeresströmungen, und zusammen erzeugen sie entweder trockene Luftmassen oder Monsunregen. In diesem Fall schieben sie feuchte Luft nach Indien und Südostasien und sorgen für die Monsunregen, welche diese Länder bewässern und ihnen überhaupt erst ermöglichen, ihre Bevölkerung zu ernähren.«
Eine weitere Bildschirmanimation zeigte Wolkengebirge, die über Indien hinweg und weiter nach Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und Thailand zogen.
»Das alles wissen wir doch«, meinte Mustafa aus Pakistan unwirsch. »Wir haben diesen Film schon früher gesehen. Während Sie reiche Ernten einfahren können, bleiben unsere Anbauflächen trocken, und Ihre Sandwüsten glühen vor Hitze. Wir sind hierhergekommen, um uns anzusehen, ob Sie diesen Kreislauf verändern können, denn schließlich haben wir ein Vermögen in Ihren Plan investiert.«
»Ja, das ist richtig«, bestätigte ein anderer Firmenvertreter.
»Meinen Sie, ich hätte Sie hierher eingeladen, wenn ich keinen entsprechenden Beweis hätte?«
»Wenn Sie ihn haben, dann zeigen Sie ihn her«, verlangte Xhou.
Jinn betätigte die Fernbedienung, und das Bild wechselte abermals.
»Vor drei Jahren haben wir damit angefangen, den Schwarm im östlichen Quadranten des Indischen Ozeans auszusäen.«
Auf dem Bildschirm erschien in der Nähe des Äquators ein unregelmäßiges Dreieck.
»Jedes Jahr konnten wir – dank Ihrer Geldmittel – weitere Bereiche besetzen. Und jedes Jahr ist der Schwarm, wie angekündigt, eigenständig gewachsen. Vor zwei Jahren bedeckte er zehn Prozent der Fläche des Zielgebiets.«
Das unregelmäßige Dreieck wurde länger und streckte sich in Strömungsrichtung. Der Ausläufer einer zweiten unregelmäßig geformten Fläche näherte sich dem Dreieck von Westen.
»Vor einem Jahr betrug die Abdeckung dreißig Prozent.«
Ein weiterer Klick, ein weiteres Diagramm. Die beiden dunklen Flecken vereinigten sich und breiteten sich auf dem südlichen Arm des Agulhasstroms aus, der kalten Hauptströmung des Indischen Ozeans.
»Wir wissen längst, dass die Intensität der Monsunregen in Indien deutlich abgenommen hat. Die Ernte im vergangenen Jahr war die geringste seit einigen Jahrzehnten. Dieses Jahr werden sie auf Regenwolken warten, die allerdings nicht kommen werden.«
Er betätigte die Fernbedienung ein letztes Mal. Die wenigen schwarzen Streifen hatten abgenommen, aber ein breiteres, dunkles Muster in der Mitte des Indischen Ozeans war gewachsen. Dank der Wirkung der Meeresströmungen und Jinns gezielter Manipulation sammelte sich der Schwarm in einem Bereich, den Ozeanographen als Driftströmung im Zentrum des Great Whirl kennen. In dieser konzentrierten Form übte er eine weitaus stärkere Wirkung auf die Wassertemperatur aus – und damit auch auf das Wetter, das dort seinen Ursprung hatte.
»Die Wassertemperaturen sinken, während die Lufttemperaturen über dem Meer ansteigen, wodurch die Luftmassen in Bewegung geraten, wie man es vom Festland kennt«, sagte Jinn. »Das Wettergeschehen ändert den Kurs und verlagert sich. Schon jetzt regnet es im Hochland von Äthiopien und des Sudan häufiger und stärker als je zuvor. Nach Jahren der Dürre muss man mittlerweile damit rechnen, dass der Nassersee seinen Höchststand überschreiten wird.«
Die Versammelten waren sichtlich beeindruckt. Außer Xhou jedoch.
»Hungersnöte in Indien nutzen niemandem von uns«, stellte er fest. »Es sei denn, vielleicht, Mustafa, der sie als alte Feinde betrachtet. Wir wollen eigentlich nichts anderes als ihnen Getreide verkaufen, wenn ihre eigenen Silos leer sind. Was nicht der Fall sein kann, wenn die Niederschlagsmenge in unseren Ländern nicht entsprechend zunimmt.«
»Das ist richtig«, räumte Jinn ein. »Aber die sekundären Auswirkungen treten erst ein, wenn das erste Ziel erreicht wurde. Bei Ihnen wird es regnen, Ihr bislang wertloses trockenes Land wird Früchte tragen, und Sie werden, indem Sie Milliarden hungernden Menschen Ihre Reisernten verkaufen, einen noch höheren Profit machen als bisher.«
Xhou lehnte sich mit einem missbilligenden Knurren zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Er war offensichtlich nicht zufrieden.
»Die wissenschaftliche Erklärung ist recht simpel«, sagte Jinn. »Vor sechstausend Jahren bestanden der Mittlere Osten, die Arabische Halbinsel und Nordafrika aus fruchtbarem Land, das sich nicht über mangelnden Niederschlag beklagen musste. Es gab ausgedehnte Grasfluren, Savannen und weite mit Bäumen bewachsene Ebenen. Dann veränderte sich das Wetter und verwandelte das Land in Wüste. Die Ursache waren ein Wechsel der Meeresströmungen und die Temperaturunterschiede dieser Strömungen. So gut wie jeder Wissenschaftler vertritt diese Auffassung. Zurzeit ist wieder ein Prozess der Veränderung im Gange, der zurück zu diesen Verhältnissen führt. Die ersten Anzeichen waren bereits im vergangenen Jahr zu beobachten. Dieses Jahr wird er sich schon nicht mehr verleugnen lassen.«
Scheich Alhrama aus Saudi-Arabien ergriff als Nächster das Wort. »Wie kommt es, dass bisher noch niemand Ihren Schwarm entdeckt hat? Eine derart ausgedehnte auffällige Erscheinung kann Beobachtungssatelliten doch unmöglich verborgen bleiben.«
»Der Schwarm bleibt tagsüber unterhalb der Wasseroberfläche. Er absorbiert die Sonneneinstrahlung und verhindert, dass sich die tiefer gelegenen Wasserschichten des Ozeans erwärmen. Während der Nacht steigt er dann auf und strahlt die aufgestaute Wärme ab. Davon ist jedoch nichts zu sehen. Ein normales Satellitenbild würde eine gleichförmige Wasserfläche zeigen. Erst auf einem Wärmebild wäre eine merkwürdige Strahlung zu erkennen.«
»Was ist mit Wasserproben?«, fragte Xhou.





























