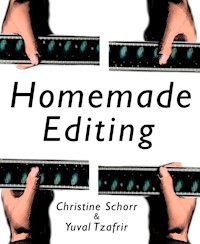
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Ebook "Homemade Editing" gibt eine Einführung in den digitalen Filmschnitt für interessierte Laien und angehende Profis. Von Bild-Basics über Continuity Editing bis zur Schnittpraxis. Dramaturgische Konzepte, technische Basics, Sound-Editing und praktische To-do Listen gehören ebenfalls zum Gesamtpaket dieses umfassenden E-Book Tutorials. Alle Themen sind mit Bildern illustriert und zeigen so konkret, was gemeint ist, wenn von Achssprüngen, Anschlussfehlern, Bewegungsschnitten etc. die Rede ist. Unter homemade-editing.com/ kann man die zugehörige Website aufrufen und sich einen Überblick über den Inhalt verschaffen. Das Buch konzentriert sich auf die handwerklich, dramaturgischen Aspekte des Schnitts und ist damit auch geeignet für Menschen, die sich sonst eher mit anderen Aspekten der Filmproduktion beschäftigen. Es klärt viele der Fragen, die erst im Schnitt auftreten: Warum passen bestimmte Einstellungen und andere nicht, wir kann ich vermeiden, dass mir nötige Einstellungen fehlen und welche technischen Fehler sollte ich unbedingt vermeiden. Es bietet damit eine umfassende Sammlung wissenswerter Informationen rund um die Filmproduktion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
1.SCHNITT-MONTAGE-EDITING
Jeder tut es. Wir alle haben unzählige Filme gesehen und unzähli-ge Bilder und Gefühle aus Filmen im Kopf. Jedes Smartphone, jeder Tablet PC und jede kleine Digitalkamera besitzt heute die Möglichkeit, Filme zu drehen. Es gibt unzählige Apps um diese Aufnahmen zu be-arbeiten, zu verfremden und zu schneiden. Mit wenigen Klicks können Geschichten erzählt und mit ebenso wenig Aufwand veröffentlicht wer-den. Bewegte Bilder bestimmen die heutige Welt.
Im Schnitt findet die eigentliche Erzählung eines Films statt. So indivi-duell das ist, was erzählt werden soll, gibt es trotzdem einige Grund-lagen dafür, dass eine solche Erzählung funktioniert und verstanden wird. Weil es kaum praktische und einführende Texte zu dem Thema gibt, wollen wir mit diesem ebook die Grundlagen des „Handwerks“ zusammenstellen.
Es ist nicht ganz leicht, das Thema Schnitt oder Montage zu erfassen.Oft sind mit „Schnitt“ ganz unterschiedliche Aspekte gemeint. Man redet davon, wie dynamisch die Schnitte wirken, ob der Rhythmus stimmt oder wie stringent der Film erzählt ist. Manchmal sind aber auch nur besonders auffällige Schnitte oder Effekte gemeint. Auch die Qualitäten von Schnittprogrammen oder deren technische Angebote werden diskutiert.
Welche Einstellungen funktionieren miteinander? Wie kann ich hand-werklich gute Schnitte erzeugen und welche Grundlagen gibt es da-für? Was ist der „unsichtbare Schnitt“? Was ist Kontinuität und wie erzeugt man sie? Wie kann ich Ton zur Unterstützung einsetzen? Wie kann ich spannend erzählen? Für all diese Aspekte tragen wir in den folgenden Kapiteln die Basics zusammen. Außerdem wird die Arbeit im professionellen Schneideraum dargestellt. Wir geben eine kleine Einführung in die Begriffe, die beim Dreh verwendet werden und ver-suchen einen Überblick zu geben, welche Anforderungen ein Schnitt-programm erfüllen muss. Auch die technisch korrekte Verarbeitung von verschiedenen Bildformaten und Kompressionen wird im Über-blick angesprochen, ebenso wie die sinnvolle Planung von
Dreharbeiten.
Bei der konkreten Arbeit im Schnitt gibt es häufig Fragen, die sich auf das jeweilige Schnittprogramm beziehen.
Spezielle Tools werden benötigt, es gibt Fehlermeldungen, oder auch Fragen zur Bedienung. Hier ist man allerdings in den einschlägigen Foren, die es für die jeweiligen Schnittprogramme gibt, meist besser bedient. Wir wollen hier stattdessen eine ganz praktische Auflistung der handwerklichen Basics zu geben.
Read Me
Einmal anders verstanden: Aus der Perspektive des Schneideraums, vom Ende des Prozesses also betrachten wir die verschiedenen As-pekte der Filmproduktion.
Durch den Schnitt wird die Erzählung der Geschichte oder des The-mas herausgearbeitet. Das Bildmaterial wird danach ausgewählt, dass die Arbeit der Regie, der Kamera und der Darsteller die beste Wirkung erzielen.
Dies ist kein Buch über Kamera- oder Regiearbeit. Trotzdem benötigt man im Schnitt ein Grundverständnis beider Tätigkeiten. Außerdem gehen wir davon aus, dass unsere Leserinnen und Leser häufig alles in einer Person sind. Wir stellen also die einzelnen praktischen
Arbeitsprozesse bei der Produktion eines Filmes zunächst chronolo-gisch dar - immer aus der Sicht des Schneideraums.
Nach einem kurzen Umweg über die speziellen Herausforderungen des Schnitts geht es dann in Kapitel 3 und 4um die Grundbegriffe der Kameraarbeit.
In den Kapiteln 5 – 9behandeln wir klassisch- handwerkliche Schnitt-grundlagen.
Im Kapitel 10wenden wir uns dann der Schnittdramaturgie zu.
Eine Beschreibung der Arbeitsabläufe im professionellen Schneide-raum schließt sich in Kapitel 11an und Kapitel 12 und 13widmen sich einigen technischen Grundlagen.
In Kapitel 14findet sich noch eine praktische To-do Liste für die Pla-nung und Abwicklung eines Drehs, alle Fachbegriffe finden sich im anschließenden Glossar.
We‘ll fix it in the Post Grad Regel
Sprache ist wichtig. In einer Welt, in der es nur Regisseure, Ka-meramänner, Drehbuchautoren usw. gibt, werden es die Regis-seurinnen, Kamerafrauen, Editorinnen immer schwerer haben. Um die hässlichen und zeitraubenden Wortungetüme zu ver-meiden, die sich daraus ergeben, dass wir beide Geschlechter gleichberechtigt nennen möchten, haben wir uns dafür entschie-den, möglichst abwechselnd die weibliche und die männliche Form zu verwenden.
Auch ist es vielleicht am Anfang sinnvoll zu klären, welche Be-rufsbezeichnung wir für den Schnitt (in der deutschen Sprache) verwenden. Es gibt im Deutschen neben dem alltäglich verwen-deten Begriff Cutterauch noch den des Filmschnittmeisters, und den des Editors. Die Tätigkeit selbst heißt Schnittoder Monta-geund so steht im Abspann abwechselnd Montage oder Schnitt und manchmal Editor.
Weil alle Bezeichnungen unterschiedliche Assoziationen hervor-rufen, haben wir den Begriff gewählt, der die Tätigkeit unserer Meinung nach am besten beschreibt, den des Editing. Während ein Cutter jemand ist, der etwas abschneidet und der französi-sche Begriff Montage im Deutschen am ehesten nach einer rein handwerklichen Tätigkeit klingt, beschreibt Editing am besten einen Arbeitsprozess, der auswählt und strukturiert. Im Schneide-raum wird die Form eines Films erarbeitet und herausgegeben.
Political Correctness
Yuval Tzafrir und Christine Schorr sind langjährige Kollegen an der Filmhochschule München. Beide sind dort seit 17 Jahren für die Schnittbetreuung der studentischen Filmproduktionen zuständig. Da-neben arbeiten beide freiberuflich als Editoren und Filmemacher.
Christine Schorr hat eine Ausbildung zur Editorin im Filmschneideraum gemacht, und anschließend Kommunikationswissenschaft mit Schwer-punkt Journalismus an der LMU München studiert. Christine Schorr hat den Text zu diesem Buch geschrieben.
Yuval Tzafrir hat Regie, Schnitt und Dramaturgie an der Sam Spiegel School for Film and Television in Jerusalem studiert. Yuval Tzafrir hat für das e-book sämtliche Grafiken und Filme produziert.
Das Konzept für dieses ebook haben beide gemeinsam auf Basis ihrer Arbeit entwickelt.
Der Filmschnitt hat eine handwerklich-technische und eine inhaltlich dramaturgische Seite. Er ist extrem wichtig für einen spannenden und gut erzählten Film. Gleichzeitig leistet er seinen Beitrag zum Film aber sehr leise und zurückhaltend. Die Filmhochschule München bildet Regisseure, Kameraleute, Produzenten und Drehbuchautoren, aber keine Editoren aus.
Die Arbeit der Schnittbetreuung an der HFF München umfasst deshalb sowohl die inhaltliche, als auch die technische und handwerkliche Be-treuung der Studierenden bei ihrer Arbeit im Schnitt. Das How-to der jeweiligen Arbeitsprozesse in den verschiedenen Schnittprogrammen muss geklärt werden, wie unterschiedliche Workflows für verschie-denste Filmformate vom Kinofilm über die Fernsehproduktion bis zum Werbetrailer.
Aus diesen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Perspektiven der Studierenden auf den Schnitt entstand die Idee, alle Grund-begriffe, die den Montageprozess betreffen, zusammenzustellen. Sozusagen ein ABC für alle Bereiche, mit denen man in Berüh-rung kommt, wenn man sich mit Schnitt befasst.
Die Autoren
Dank an unsere vier ehrenamtlichen Lektorinnen:Jessika Goldbergfür ihre Übersetzung ins Englische. In wochenlanger Arbeit ist Jessika für dieses Buch in unbezahlte Vorausleistung getre-ten. Zwischen unzähligen Projekten und ihrer Arbeit als Admin/Editorin in der Postproduktion hat sie zusätzlich noch alle Seiten dieses Buches übersetzt. Weil wir das Buch komplett in Eigenleistung erstellt haben, konnten wir nur mit ihrer Hilfe diesen zusätzlichen Arbeitsschritt noch be-werkstelligen.
Claudia Gleisner, eine sehr geschätzte Kollegin und langjähriger Vorstand des Bundesverband Filmschnitt/ BFS hat an vielen Tagen jede Zei-le lektoriert und auf fachliche Mängel überprüft. Ihre sehr wertvollen Hinweise zur Verständlichkeit und Vollständigkeit sind an vielen Stellen in den Text eingegangen. Ihr professioneller Blick auf die Themenauswahl und deren Bearbeitung war außerdem nötig, um sicher zu stellen, dass nicht zuviel subjektive Wahrnehmung in die Zusammenstellung der Themen eingegangen ist.
Dr. Elke Reinhard, Germanistin und Fernsehredakteurin hat den Inhalt sowohl auf sprachliche Mängel als auch auf die Verständlichkeit aus der Perspektive eines anderen Medienberufs geprüft. Und das akribisch, fachkundig und freundschaftlich auf jeder einzelnen der fast 150 Text-seiten noch bevor es die schönen, bunten Illustrationen dazu gab.
Regina Schröder, Lehrerin an einer Gesamtschule, deren Schüler sich in vielen Workshops und Projekten mit der Filmherstellung befassen, hat sich neben zwei halbwüchsigen Töchtern und einem wirklich anstrengenden Fulltimejob noch an etlichen Feierabenden die Zeit genom-men, diesen Text durch zu arbeiten. Dabei hat sie neben den Rechtschreibfehlern vor allem auch die Verständlichkeitsprobleme aus der Pers-pektive des Nichtfilmemachers gefunden. Auch ihr Feedback zu interessanten und weniger interessanten Themenbereichen hat uns sehr ge-holfen.
Sie alle haben viel mehr Zeit, Interesse und Arbeit investiert, als man es eigentlich von Freunden erwarten darf und uns außerdem mit Feed-back in der zweijährigen Produktionsphase immer wieder ermuntert. Ganz vielen Dank dafür!
Danksagung
2.HANDWERK/ TECHNIK/ KUNST
Anders als bei den anderen Gewerken, die an der Filmproduktion beteiligt sind, geschieht der Schnitt nahezu unter Ausschluss der Öf-fentlichkeit. Nur der Regisseur und die Editorin sind im Schneideraum anwesend. Der Schnittprozess zieht sich oft über Monate hin, dabei werden unzählige Entscheidung getroffen und auch wieder revidiert.
Bis vor ungefähr 25 Jahren war der Filmschnitt eine recht exklusive Angelegenheit. Es wurde mit teurem Material, dem Celluloid gedreht und der Film anschließend an sperrigen und teuren Filmschneideti-schen wie dem Steenbeck oder der Moviola geschnitten, manchmal hinter einem verschlossenen Vorhang. Für jeden Schnitt musste das Filmmaterial physikalisch zerschnitten und anschließend wieder zu-sammen geklebt werden. Die Schneidetische konnten nur das Bild und zwei Tonspuren handhaben, die vorwärts und rückwärts gespult wurden. Sie machten Lärm und erforderten körperlichen Einsatz.
Für die Verwaltung der Materialmengen waren Schnittassistenten zu-ständig, die kreative Arbeit dagegen Sache der Editoren. Nicht einmal die Schnittassistenz bekam oft Gelegenheit, auf die Arbeit der Editorin zu schauen. Vieles wurde dem individuellen Können, der Handschrift des jeweiligen Schnittmeisters zugeschrieben.
Obwohl diese Schneidetische eine sehr überschaubare Anzahl von Schaltern hatten und nie kaputt gingen, nötigten sie allen Außenste-henden viel Respekt ab. Sie waren das uneingeschränkte Hoheitsge-biet des Editors oder der Editorin.
Auch die öffentliche Beschäftigung mit dem Thema, in Form von Arti-keln, Aufsätzen oder Büchern bewegte sich lange in sehr engen Gren-zen. Es gab kaum Publikationen denen man verbindliche „Regeln“ hätte entnehmen können.
Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Nur zehn Jahre später war der Computer zu Hause inklusive Schnitt-programm eine Selbstverständlichkeit. Jeder ambitionierte User kann dort heute sein Videomaterial selbst bearbeiten. Und obwohl das Ar-beitsgerät um ein Vielfaches komplizierter geworden ist und weit mehr an Möglichkeiten bietet, gehen wir nun alle mit größter Selbstverständ-lichkeit mit ihm um.
Digitale Bilder können ohne sichtbare Kosten produziert werden, was meistens dementsprechend viel Material zur Folge hat. An der eigent-lichen Situation hat sich damit aber wenig geändert: Verbindliche Re-geln gibt es nur wenige - und je mehr Material vorhanden ist, umso stärker steigt die Anzahl der möglichen Schnittfolgen.
Wenn man in einem Seminar mehreren Menschen die gleichen Auf-nahmen gibt, um daraus einen Film zu montieren, wird es sicher nicht zwei gleiche Ergebnisse geben.
Carol Littleton, die unter anderem E-T. - der Außerirdische, Body Heat und The Mandschurian Candidate geschnitten hat, sagte zu dem Thema in einem Interview: „I was involved in arbitrating a film cre-dit. Two editors worked on the same material, with the same director, same shots, same script. It was interpreted by two different editors, and the two versions were radically different....actually seeing the dif-ference was so amazing to me. The editors influence on the material was extraordinary.“(Gabriella Oldham/ „FirstCut-Conversations with Film Editors“/1995, p 66)
Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass man dem fertigen Film nicht an-sehen kann, welches Material verwendet wurde, und welches nicht. Warum also die Entscheidung getroffen wurde, etwas so und nicht anders zu machen, ist am fertigen Produkt nur noch schwer zu be-urteilen.
Anders als bei der Kameraführung oder der schauspielerischen Leistung, wo das Ergebnis deutlich sichtbar ist und jeder darüber diskutieren kann, ist beim Schnitt eine Beurteilung sehr schwie-rig. Wenn das Timing im fertigen Film nicht stimmt, die Erzählung nicht voran kommt oder unverständlich bleibt, kann man vermu-ten, dass der Schnitt nicht optimal ist. Man weiss dann aber im-mer noch nicht, ob das entsprechende Material für bessere Lö-sungen vorhanden war.
Im Meer der Möglichkeiten
Als echter Meilenstein in der Geschichte der Montage wird „The Life of an American Fireman“ aus dem Jahr 1903 von Edwin S. Porter betrachtet. Es ist interessant, sich den Film aus heutiger Perspektive im Netz einmal anzuschauen.
Porter inszenierte erstmals ein Ereignis in verschiedenen Einstel-lungen. Er nutzt das Filmaterial um in einzelnen Einstellungen eine Geschichte zu erzählen. Er setzte „Schauspieler“ ein und nutzt auch Möglichkeiten der Trickbearbeitung. https://www.youtube.com/watch?v=6ym7-QW_GWo
Während bis dahin das kostbare Filmmaterial immer vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kamera gezeigt wurde, kürzte Porter und wählte nur die wichtigen Passagen aus.
Irritierend wirkt heute die Dopplung einzelner Handlungen, vermutlich sollte deren Bedeutung betont und das Verständnis erleichtert werden.
Die erste Einstellung zeigt eine „Traumsequenz“. Im gleichen Bild wer-den der Feuerwehrmann und - vergleichbar einer Gedankenblase im Comic, sein Traum gezeigt. Der Abstand der Kamera zum Motiv blieb bei Porter aber noch unverändert, fast alle Einstellungen wurden als Totale gedreht. Lediglich eine Naheinstellung des Feuermelders zeig-te, dass Porter sich schon mit anderen Erzählmöglichkeiten befasste.
The Life of an American Fireman
Die Kunst des Erzählens im Film wird in den folgenden Jahren wei-
ter perfektioniert. Vor allem D.W. Griffith gilt als Pionier der Montage. Er arbeitete mit verschiedenen Einstellungsgrößen, als Pendant zum Opernglas führte er die Naheinstellung ein.
Als in dieser Hinsicht herausragend gilt Griffith ansonsten zutiefst rassistischer Film „The Birth of a Nation” von 1915 https://www.you-tube.com/watch?v=N_yU8rRQKoA.Trotz seines höchst fragwürdigen Inhalts hat er sich auf Grund seiner herausragenden filmischen Quali-tät einen Platz in der Geschichte erobert.
Griffith nimmt hier Einstellungswechsel aus dramaturgischen Gründen vor. Die Haupthandlung wird wiederholt unterbrochen, um andere Cha-raktere oder Nebenstränge darzustellen. Griffith arbeitet auch schon mit der Parallelmontage. Er zerlegt die Handlung in einzelne Abschnit-te und montiert nach seinen Bedürfnissen: Unwichtiges wird weg ge-lassen, Wichtiges betont. Auch Rhythmus und Timing der einzelnen Schnitte scheint Griffith bereits absichtsvoll eingesetzt zu haben.
Einige der frühesten Experimente zur Erzählweise im Film stammen von Lew Kuleschow https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc
Kuleshow stellte die These auf, dass die Wirkung eines Filmes nicht durch die einzelnen Kameraaufnahmen entsteht, sondern durch die Verbindung mehrerer Aufnahmen. Nicht allein der Inhalt der einzelnen Einstellung erzielt die Wirkung, sondern die Verknüpfung und die zeit-liche Abfolge der Einstellungen.
Er bewies, dass wir Zuschauer zwischen zwei aufeinander folgenden Aufnahmen ein Bezug herstellen.
Wir konstruieren einen Sinn-Zusammenhang und verleihen dem Ge-sehenen eine Bedeutung, die über das tatsächlichen Gezeigte
hinaus geht.
In einem Experiment montierte Kuleschow beispielsweise einzelne Aufnahmen von Armen und Beinen verschiedener weiblicher Körper hinter einander. Ganz selbstverständlich nahmen die Zuschauer an, in jedem Bild den gleichen Körpers gesehen zu haben.
Das Kuleschow Experiment
Der Einfluss der Motage auf die Bilder
Kuleschow Effekt
6
5
4
3
2
1
Ein weiteres Experiment von 1918, heute als Kuleschow Experiment bekannt, bestand darin,dass einem neutralen Publikum drei mal die gleiche Großaufnahme eines Mannes mit unbewegtem Gesicht vorge-führt wurde, dem dann unterschiedliche Motive folgten: Ein Teller Sup-pe, ein Sarg mit einem Frauenkörper und eine schöne Frau (hier Kind mit Puppe) wurden jeweils hinter das gleiche Close-Up des Schau-spielers gehängt.
Obwohl das Gesicht des Schauspielers immer gleichermaßen starr und emotionslos war, schwärmte das befragte Publikum von der Aus-druckskraft der schauspielerischen Darstellung. Es hatte Hunger, Trauer und Freude erkannt.
Kuleschow kam durch seine Experimente zu dem Schluss, dass sich die Wirkung eines Films durch die Konstruktion seiner Montage vor-hersagen liesse. Der „Kuleschow-Effekt“gilt bis heute als eines der wichtigsten Experimente der Filmgeschichte.
Stell dir vor, du sitzt mit deinem besten Freund im Kino. Ihr verfolgt ge-rade gespannt einen Überfall auf eine Tankstelle, der maskierte Täter hat die Pistole schon gezückt. Plötzlich ertönt ein röchelnder Schrei irgendwo hinter Dir. Du suchst die Leinwand nach der Ursache des Schreis ab. Erst nach einiger Zeit fällt dir die Unruhe im Zuschauer-raum auf. Weitere Laute von schräg hinten links ertönen.
Köpfe drehen sich, es wird getuschelt. Du reckst den Hals und ver-suchst zu erkennen, was gerade passiert. Es stellt sich heraus, dass ein Mann im Kinosaal einen Anfall erlitten hat. Nach einiger Zeit kom-men Sanitäter, die Vorführung des Films wird fortgesetzt.
In Szene gesetzt
Diese kleine Situation soll in einem Film erzählt werden. Dazu werden verschiedene Einstellungen gedreht, die die Situation im Kino aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen.
Die Aufgabe im Schnitt besteht nun darin, sowohl den Vorfall an sich zu erzählen, als auch die Reaktionen der Beteiligten möglichst authen-tisch und emotional wiederzugeben. Die Erzählung muss plausibel und nachvollziehbar sein. Es können Fragen nach den Gründen und Hintergründen des Ereignisses beantwortet werden.
Die kleine Geschichte muss, wie alle anderen Geschichten dieser Welt, eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss bekommen. Zeit muss gerafft werden. Bild muss ebenso wie Ton berücksichtigt werden. All diese Fragen können sehr unterschiedlich beantwortet werden und bieten damit unendlich viel Raum für Kreativität.
Der Dreh ist beendet und wir sitzen vor unserem Rechner vor sehr vielen Aufnahmen. Das ist das Gegenteil des berühmten weißen Blat-tes vor dem ein Autor zu Beginn seiner Arbeit sitzt. Wie bei einem Text, der sich aus Wörtern, Sätzen, Absätzen und Kapiteln zusammensetzt, wird der Film aus einzelnen Aufnahmen zu Sequenzen und Szenen und einer kompletter Erzählung zusammengebaut.
Der Schnitt findet oft erst nach Beendigung der Dreharbeiten statt. Das Rohmaterial ist dann mehr oder manchmal auch weniger vollständig, weitere Dreharbeiten sind aber aus Kostengründen meist nicht mög-lich.
Zu den zentralen Aufgaben des Schnittes zählt die Auswahl und Be-wertung der einzelnen Bilder. Welche Takes werden verwendet – und fast ebenso wichtig - welche werden nicht verwendet? Womit beginnt die Erzählung? Wie lange steht eine Einstellung und bei welchem Frame findet der Umschnitt in das nächste Bild statt? Was haben eigentlich zwei Einstellungen miteinander zu tun?
Für jede einzelne Szene müssen viele Entscheidungen getroffen wer-den. Die sind abhängig von den künstlerischen Vorstellungen des Edi-tors, auch seine Erfahrung und sein Lebensweg beeinflussen die
Montage. Trotzdem gibt es handwerkliche Grundlagen, die wir zeigen und erläutern wollen.
Noch einmal zurück zu unserem Beispiel. Die Protagonistin sitzt im Kino und hört seltsame Geräusche, die sie nicht zuordnen kann. Um zu erzählen wie sie herausfindet, was vorgefallen ist, gibt es Einstel-lungen von ihr, der Umgebung und den Reaktionen des Publikums.
Alleine vor dem Rechner
Zum Beispiel könnte man mit der halb nahen Einstellung der Frau im Kinosessel anfangen zu erzählen. Wenn wir annehmen, dass diese Frau eine zentrale Rolle spielt, dann bekommen die Zuschauer damit bereits einige Informationen. Sie erfahren, wie sie aussieht, wie alt sie ist, welche Kleidung sie trägt und wo sie sich befindet. Auch ihre Mimik gibt bereits Auskunft über die Situation. Wie lange hat man jetzt Inte-resse daran, diese Frau zu betrachten und wann will man mehr über die Situation erfahren?
Ein natürlicher, nächster Schnitt wäre zu zeigen, wohin sie schaut, also die Kinoleinwand. Dort sehen und hören wir Schüsse, dazu neh-men wir ein lautes Röcheln wahr. Das Röcheln ist ein irritierendes Ge-räusch, das nicht so richtig zur Situation zu passen scheint. Wir kön-nen jetzt direkt darauf schneiden, woher das Röcheln kommt (nicht so spannend), oder wie unsere Protagonistin reagiert (spannender). Wie lange soll die Spannung, die Klärung der Frage woher dieses Röcheln kommt, aufrecht erhalten werden? Was zeigt man, um die Situation aufzulösen?
Wir hätten jetzt die Möglichkeit, den Kranken oder die Rettungshelfer zu zeigen, alternativ kann das Ereignis auch indirekt auf dem Gesicht der Protagonistin gespiegelt sein. Um ihre Reaktion etwas genauer betrachten zu können, wäre eine nähere Aufnahme jetzt schön. Sie schaut hin und her und versucht ebenfalls etwas heraus zu finden.
Die Geräusche aus dem Hintergrund werden lauter. Man kann jetzt auf ihrem Gesicht bleiben und abwarten, was sie heraus findet, oder man schneidet in eine Aufnahme um, die mehr von der Umgebung zeigt und vielleicht eine Erklärung bietet.
Der Zuschauer soll durch die fertig geschnittene Szene den Schreck und die Unruhe im Kinosaal mit erleben können. Außerdem muss er alle wichtigen Informationen erhalten. Wenn das Ganze zu langatmig oder zu vorhersehbar erzählt wird, wird er anfangen sich zu langwei-len. Zu wenige Informationen oder eine unplausible Erzählung führen zum gleichen Ergebnis.
Im Schnitt geht es darum entscheiden zu können, wie eine Ge-schichte am spannendsten erzählt wird und ebenso darum, die einzelnen Aufnahmen möglichst elegant miteinander zu verbin-den. Es geht also darum die Bilder sowohl in ihrer inhaltlichen, als auch ihrer ästhetischen Wirkung zu verstehen und einzuset-zen. In den folgenden Kapiteln schauen wir uns das genauer an, und zwar in der Reihenfolge einer Filmproduktion. Im nächsten Kapitel geht es um die Basics bei der Gestaltung des einzelnen Filmbildes.





























