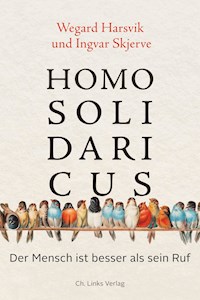
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung beruht in weiten Teilen auf dem Glauben, der Mensch sei im Grunde egoistisch und faul. Vom Bildungswesen über den Sozialstaat bis zum Lohn- und Gehaltssystem – stets wird vorausgesetzt, dass wir entweder Zuckerbrot oder Peitsche brauchen. Aber sind wir wirklich so einfach gestrickt? Und trifft die wirkmächtige Vorstellung zu, es diene am Ende sogar dem Allgemeinwohl, wenn jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist?
Keineswegs, wie dieses Buch überzeugend darlegt. Gestützt auf übereinstimmende Erkenntnisse aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen zeigen die Autoren, dass Eigenschaften wie Fairness, Empathie und Kooperationsbereitschaft dem Menschen angeboren sind. Und sie gehen der Frage nach, welche sozialen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die guten Anlagen des Menschen zur Entfaltung kommen. Denn eine bessere Gesellschaft ist nicht nur möglich – sie entspricht auch unserem Wesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wegard Harsvik und Ingvar Skjerve
Homo solidaricus
Der Mensch ist besser als sein Ruf
Wegard Harsvik und Ingvar Skjerve
HOMO SOLIDARICUS
Der Mensch ist besser als sein Ruf
Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob
Ch. Links Verlag
Diese Übersetzung wird mit finanzieller Unterstützung von NORLA veröffentlicht.
Die norwegische Ausgabe erschien 2018 unter dem Titel»HOMO SOLIDARICUS – et oppgjør med myten om det egoistiske mennesket« bei Res Publica, Oslo© Wegard Harsvik & Ingvar Skjerve, 2018Die deutsche Ausgabe erscheint durch freundliche Vermittlung von Immaterial Agents in Verbindung mit 2 Seas Literary Agency
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Ch. Links Verlag ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
1. Auflage, März 2021 entspricht der 1. Printauflage vom März 2021 © Aufbau Verlag GmbH & Co. KGwww.christoph-links-verlag.de Prinzenstraße 85, 10969 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0 Umschlaggestaltung: Hannah Kolling, Kuzin & Kolling – Büro für Gestaltung, unter Verwendung eines Bildes von Rawpixel (471561) Satz: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag
ISBN 978-3-96289-114-5 eISBN 978-3-86284-494-4
INHALT
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
DIE MENSCHEN SIND IN ORDNUNG
KONSERVATISMUS UND NATUR
Die große Frage
DER HOMO OECONOMICUS
Taylorismus — Behaviorismus — Der innere Antrieb wird eingeschläfert — Gerechtigkeit einfordern — Gleicher Lohn für gleiche Arbeit — Eine neue Sicht auf den Menschen — Das Prinzip der Gegenseitigkeit
DER EGOISTISCHE MENSCH – DAS BEISPIEL AYN RAND
Wer war Ayn Rand? — Fantasy für die Wirtschaft — Gegen jede Regulierung — Der Kollektivkult
DER HOMO SOLIDARICUS UND DIE NATUR
Zwei Formen natürlicher Auswahl — Anpassung und äußerer Druck — Stabile Strategien — Die Entwicklung des Hundes — Unsere freundlichen Verwandten
ES GEHT UM DAS »WIR«
Zusammenarbeit gibt es überall — Zusammenarbeit mit Verwandten — Schwärme und Rudel — Solidarität unter Vampiren — Aus der Reihe tanzen wird nicht geduldet — Alles hängt mit allem zusammen — Gegenseitige Abhängigkeit
DER MENSCH IST KÖRPER UND BIOLOGIE (UND KULTUR)
Das Gehirn – der Star — Begrenzte Rationalität — Das Gehirn ist nicht allein — Solidarität in unseren Genen? — Das Kopieren — Empathie und Sympathie — Empathie ist ein Bauwerk — Gibt es Altruismus? — Gerechtigkeit — Alleine einen Hasen jagen oder gemeinsam den Hirsch — Der Ursprung der Sprache — Ist so oder sollte so sein? — Kultur — Revolution in der Schimpansengruppe? — Die Macht der Meme — Einzigartige Anpassungsfähigkeit
DIE WELT VON GESTERN
Woher kommt der Altruismus? — Versöhnung — Kindergärten
POLITIK UND ZUKUNFT
Von jedem nach seiner Fähigkeit – jedem nach seinen Bedürfnissen — Ungleichheit und Armut kommen uns teuer zu stehen — Hummer und das organisierte Arbeitsleben — Der Preis der Ungleichheit — Die meisten Menschen lieben Gleichheit — Knappheit macht den Menschen dumm — Vertrauen als Ursache und Wirkung — Ein Engelskreis — Das Supermodell — Das Janusgesicht der Gemeinschaft — Adolf Hitler und das Bedürfnis nach Wärme und Freundschaft — Das Volksheim bekommt Risse — Die Zukunft gehört dem Homo solidaricus
ANHANG
Anmerkungen — Literatur — Dank — Das Autorenteam
VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE
Über den Homo solidaricus und sein Handeln in Zeiten von Corona
Dieses Buch stammt aus den Federn zweier Autoren, die bisher in Frieden, Stabilität und Wohlstand gelebt haben. Eine wirkliche Krise wie die, in der wir uns jetzt befinden, haben wir in unserer sicheren, nordischen Region noch nicht erlebt. Es gab Rezessionen und schwere Unglücke, zum Beispiel in der Ölindustrie. Wir haben nationale Traumata erlebt, wie die schrecklichen Terroranschläge in Oslo und Utøya 2011. Trotzdem sind wir bisher noch nie mit einer Situation konfrontiert worden, die die gesamte Gesellschaft und die Menschen, die in ihr leben, längerfristig auf die Probe gestellt hat. Einige unserer Mitbürger, die aus anderen Ländern hierhergekommen sind, haben solche Erfahrungen durchaus gemacht – ansonsten gilt dies wohl nur noch für die wenigen Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs.
Dann kam die Corona-Krise. In vielerlei Hinsicht ist sie ein Prüfstein, ob das vorsichtig optimistische Bild, das wir in diesem Buch von den Menschen zeichnen, hält. Niemand weiß, wann und wie die Pandemie enden wird. Die größten Herausforderungen liegen vermutlich noch vor uns. Trotzdem: Nachdem dieses Buch 2018 in Norwegen erschienen war, ist die Corona-Epidemie aufgetaucht und hat unsere Leben geprägt, sodass wir seither beobachten konnten, wie die Menschen mit der Situation umgegangen sind. Viele kleine und große Geschichten, die mittlerweile publik geworden sind, zeigen, dass Hilfsbereitschaft und Solidarität unser zwischenmenschliches Handeln prägen.
Einige Menschen haben sich zum freiwilligen Dienst im Gesundheitssektor gemeldet, Nachbarn helfen älteren und anderen Menschen, die zur Risikogruppe gehören, und die allermeisten von uns akzeptieren die Einschränkungen ihres Sozial- und Berufslebens ohne Murren. Menschen in Quarantäne erhalten Hilfe und Unterstützung von Nachbarn und Freunden. Auf dem norwegischen Kleinanzeigenportal Finn.no, auf dem alles von Autos bis hin zu Wellensittichen gehandelt wird, gibt es nun eine neue Rubrik, unter der Menschen anderen ihre Hilfe anbieten, damit diese ihren Alltag meistern können. Vollkommen gratis. Die wenigen, die hamstern oder gegen die Regeln verstoßen, sind die Ausnahmen.
Dieses Verhalten findet sich derzeit nicht nur in Norwegen oder Skandinavien. In den Favelas in Brasilien hat man sich spontan organisiert und Solidaritätsprojekte aufgegleist, damit Maßnahmen und Vorkehrungen umgesetzt werden, für die eigentlich der »abwesende« Staat verantwortlich wäre. Sogar die Drogenkartelle schreiten positiv zur Tat.1 In Kasachstan, New York und in Spanien – überall auf der Welt organisieren sich Freiwillige, um zu helfen.
In ihrem Buch A Paradise Built in Hell2 beschreibt Rebecca Solnit, wie Katastrophen und Krisen das Beste in der menschlichen Natur zum Vorschein bringen. Der natürliche Zustand, zu dem wir zurückfinden, wenn die gewöhnlichen Gesellschaftsstrukturen nicht mehr greifen, ist nicht der Kampf jeder gegen jeden. Belege dafür findet Solnit in Zusammenhang mit den verschiedensten Katastrophen der letzten hundert Jahre: dem Erdbeben und dem nachfolgenden Großfeuer in San Francisco 1906, der bis dato schlimmsten menschengemachten, unfallbedingten Explosion im kanadischen Halifax 1917, dem Erdbeben in Mexico City 1985, dem Terroranschlag am 11. September 2001 in den USA und bei den Verwüstungen durch den Wirbelsturm Katrina in New Orleans im August 2005. Des Weiteren bei den Bombenangriffen auf London im Zweiten Weltkrieg und bei der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl.
In der Populärkultur wird es oft so dargestellt, als führten katastrophale Geschehnisse zu Kriminalität, Anarchie und Massenpanik. Glaubt man dem politischen Philosophen Thomas Hobbes, sind die Menschen von Natur aus böse, gierig und egoistisch. Für ihn ist die Zivilisation nur eine dünne Hülle, die sich über unsere wahre Natur spannt. Bekommt sie Risse, erwarten uns Der Herr der Fliegen oder The Walking Dead. Solnits Meinung könnte nicht gegensätzlicher sein. »In Katastrophen«, schreibt sie, »brechen Hierarchien auf. Verwaltung und Institutionen wirken nicht mehr. Dafür entsteht aber eine Selbstorganisation (…), in der Menschen sich zu gemeinsamen Handlungen zusammenschließen, um damit die nicht mehr funktionierenden Strukturen zu ersetzen und zu verhindern, dass es zu chaotischem, barbarischem Chaos kommt. Es werden Suppenküchen gebaut, Notunterkünfte errichtet, die Kinder werden betreut und es wird aufgeräumt. Die Mehrzahl der Menschen ist ruhig, voller Einfallsreichtum und bereit, altruistisch und alles andere als egoistisch zu handeln. Wir improvisieren das Überleben auf fantastische Weise.«
Offensichtlich ist das nicht das gesamte Bild. Es gibt auch zahlreiche Beispiele dafür, dass eine Bedrohung von außen die Bevölkerung dazu bringen kann, nach Sündenböcken zu suchen; häufig handelt es sich bei diesen um Außenstehende oder Randgruppen der eigenen Gesellschaft. Als die Pest nach Europa kam, führte das in verschiedenen Ländern zu Angriffen auf die Juden, es kam zu Pogromen. Die Juden wurden bezichtigt, hinter der Seuche zu stecken. Heute treiben die Klimaveränderungen viele Menschen in die Flucht und in einen Kampf um knappe Ressourcen. Dabei kann unsere Kerngruppen-Solidarität schnell zu eskalierenden Konflikten führen.
Manche Forscher argumentieren, dass Krisen zu Diskriminierung und Verfolgung führen können, wenn die politische Elite dies beabsichtigt. Indem die Schuld Außenstehenden in die Schuhe geschoben wird, können die wirklich Verantwortlichen ungeschoren davonkommen.
Vielleicht geht es aber um etwas viel Grundlegenderes. Große Krisen, die alle Menschen wie aus dem Nichts treffen, lassen uns nicht selten zu dem Schluss kommen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. In unserem Alltag haben wir eine Reihe von psychologischen Bollwerken aufgebaut, die es uns leichter machen, mit dem Elend um uns herum zu leben. Was weit entfernt ist – mental oder physisch –, kann man leichter verdrängen. Breitet sich aber so etwas wie eine Pandemie aus, ist es nahezu unmöglich, diese Bollwerke aufrechtzuerhalten. Wir identifizieren uns mit den Betroffenen, sie leben in unserem engsten Umfeld. Ob es nun Menschen sind, die selbst erkranken oder nur mit starken Einschränkungen ihres Alltags zurechtkommen müssen. Große Waldbrände, Überschwemmungen, ein neues Virus – das kann uns alle treffen. Wir spüren, dass wir als Menschen verwundbar sind, und das führt zu Solidarität und Verantwortungsgefühl.
Kann diese Solidarität Bestand haben, wenn die Krise vorbei ist? Wir wissen es noch nicht. Einige Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass große Krisen nicht dauerhaft zu mehr Solidarität und Zusammenhalt führen: Nach einiger Zeit wird selbst das krisenbewusste Alltagsleben zur neuen Normalität, und dann richtet sich der Fokus wieder auf die eigenen Sorgen und Bedürfnisse. Vermutlich hängt es davon ab, wie wir auf die Krise antworten. Der Slogan Build Back Better wird häufig verwendet, wenn wir an die Welt nach Corona denken.
Corona hat uns zu einer Wegscheide geführt. Über lange Zeiten hinweg haben wir unsere westlichen Gesellschaften auf dem Prinzip aufgebaut, dass die Souveränität des Individuums gewährleistet sein muss. Das hat den Menschen Rechte und Schutz vor Übergriffen durch die Mächtigen gegeben. Wir haben die alten, von Sippenbindung geprägten Gesellschaften hinter uns gelassen, in denen Scham-und Ehrgefühl wichtige Regulative und Lehrer, Pastor und Ämter noch Autoritäten waren – also das Sagen hatten. Heute sind Lehrer und Pastoren so etwas wie Life-Coaches, die uns gerne Ratschläge geben und uns motivieren dürfen statt zu rügen, zu strafen und zu ermahnen. Wir haben dadurch das Recht erhalten, uns selbst zu definieren.
Die Kehrseite der Medaille ist dabei vielleicht, dass wir etwas ganz Banales aus den Augen verloren haben, nämlich die Tatsache, dass wir primär Rudeltiere sind. Wir sind blind geworden für die guten und schlechten Seiten davon. Es ist fantastisch, die Freiheit zu haben, sich selbst zu definieren, andererseits ist es keine leichte und mitunter eine beängstigende Aufgabe, selbst zu bestimmen, wer man in dieser Welt ist und welche Rolle man einnehmen möchte. Seinen Platz zu finden, war schon immer schwer. Die Aufgabe wird aber noch komplizierter, wenn man unendlich viele Möglichkeiten, jedoch nur wenige Momente der Entscheidung hat. Wie wir es auch drehen und wenden, wir sind voneinander abhängig. Dass die eigene Freiheit dabei von der Freiheit der anderen abhängt, ist nur ein Schlagwort – eine simple Beschreibung, wie die Welt funktioniert. Wenn ein aggressives, lebensbedrohliches Virus im Umlauf ist, versteht man das sehr gut. Dann ist es absolut entscheidend, darauf vertrauen zu können, dass jeder tut, was er kann, und dass auch die großen Institutionen so funktionieren, wie sie sollen. Sollte jemand wirklich an die Devise geglaubt haben, dass es keine Gesellschaft gibt, wird er jetzt eines Besseren belehrt.
Es ist dabei allerdings dumm und gefährlich zu denken, dass die Corona-Krise die Ermahnung ist, die wir brauchten. Eine positive Konsequenz dieser Pandemie könnte aber sein, dass wir uns auf einige der Werkzeuge besinnen, mittels derer wir eine freie, sichere Gesellschaft aufbauen können – eine Gesellschaft, die der solidarischen Natur des Menschen entspricht und diese fördert.
DIE MENSCHEN SIND IN ORDNUNG
Im Großen und Ganzen sind die Menschen in Ordnung. So lautet die frohe Botschaft, die immer mehr Wissenschaftler verkünden. In der Biologie, Gehirnforschung, Wirtschaftswissenschaft, Anthropologie und Psychologie wächst, basierend auf wissenschaftlichen Fortschritten der letzten Jahrzehnte, die Kenntnis über die Natur des Menschen. Überraschend viele Publikationen zeichnen dabei ein Bild vom Menschen, wonach dieser die angeborene Fähigkeit hat, andere Menschen gut zu behandeln, mit ihnen zusammenzuarbeiten und zu teilen, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. In Gesellschaften, die auf diesen Erkenntnissen aufgebaut sind, lässt sich gut leben.
Eine der Geschichten, die uns motiviert haben, dieses Buch zu schreiben, wirkt auf den ersten Blick ziemlich trivial. Ein gemeinsamer Bekannter hat seine Geldbörse beim Joggen um den See Sognsvann am Stadtrand von Oslo verloren. Sie enthielt Kreditkarte, Führerschein und eine Reihe anderer Dinge, die essentiell sind, will man in Norwegen einigermaßen normal leben. Zum Glück fand ein anderer Sportler noch am selben Tag die verlorene Börse, googelte den Besitzer, rief ihn an und vereinbarte mit ihm, die Geldbörse in einem benachbarten Supermarkt abzugeben. Unserem Bekannten blieben so einige Probleme erspart.
Die Geschichte mag auf den ersten Blick nicht sonderlich erstaunen. Viele Menschen haben ähnlich Positives erlebt und denken vielleicht, dass man deshalb nicht gleich vor Glück aufschreien muss. Ist so viel Begeisterung gerechtfertigt, nur weil ein Mensch sich anständig verhalten hat? Wir vergessen dabei aber, dass die Geschichte auch ganz anders hätte ausgehen können. Zum Beispiel, wenn unser Bekannter seine Geldbörse in einer amerikanischen Großstadt oder im Slum von Kalkutta verloren hätte.
Gesellschaften, in der die Menschen dafür sorgen, dass man verlorene Geldbörsen zurückerhält, ohne dass jemand zuvor das Geld und die Karten entnimmt und zu einem Hacker geht, sind nicht selbstverständlich. Im Grunde haben wir Glück, in einer solchen Gesellschaft leben, arbeiten und unsere Kinder erziehen zu dürfen.
Die Wissenschaft hat auch dies genau untersucht. In einem großen Projekt wurden 17 000 Geldbörsen in 355 Städten in 40 verschiedenen Ländern platziert und das weitere Geschehen verfolgt. Etwas überraschend fanden die Forscher dabei heraus, dass die Chancen, die Börsen zurückzuerhalten, größer waren, wenn viel Geld in ihnen enthalten war. Börsen ohne Geld darin fanden nur selten den Weg zurück. Weniger überraschend war das Ergebnis, dass die Chance, die Börse zurückzuerhalten, in den Ländern am größten war, deren Gesellschaften auf Werten wie Vertrauen und Gleichheit beruhten. Am größten waren die Chancen in der Schweiz, gefolgt von Norwegen, den Niederlanden, Dänemark und Schweden. Die Resultate wurden im Sommer 2019 in der renommierten Zeitschrift Science unter dem Titel »Civic honesty around the globe« publiziert.
Natürlich finden auch bei uns nicht alle verlorenen Geldbörsen ihren Weg zurück zum Besitzer. Der Punkt ist aber, dass die Chance dafür bei uns viel größer ist als in anderen Teilen der Welt. Und dafür gibt es mehrere Ursachen.
Erstens ist das Risiko, dass der Finder ein verzweifelter Mensch ist, der das Geld dringend benötigt, bei uns deutlich geringer als im Slum von Kalkutta.
Zweitens haben wir es bei uns geschafft, eine Gesellschaft aufzubauen, in der das gegenseitige Vertrauen recht groß ist. Der freundliche Mann, der die Geldbörse unseres Bekannten gefunden hat, vertraute zuerst darauf, dass die Person am anderen Ende der Telefonleitung anständig ist und ihn nicht des Diebstahls bezichtigt. Und beide vertrauten darauf, dass das Personal im Supermarkt nicht die Börse klaut oder das Geld herausnimmt. Diese Überzeugungen motivierten ihn, die Mühe auf sich zu nehmen und den Besitzer ausfindig zu machen.
Hinzu kommt noch, dass bei uns so gut wie jeder ein Smartphone hat. Findet man eine Geldbörse, ist es in der Regel kein Problem, den Armen ausfindig zu machen, der sie verloren hat. Es ist ziemlich einfach, ein anständiger Bürger zu sein, wenn man in wohlhabenden, egalitären Gesellschaften mit hohem Vertrauensgrad und leicht zugänglicher Technologie lebt.
Wir wissen inzwischen recht genau, was es braucht, um eine solche Gesellschaft aufzubauen. Aus den unterschiedlichsten Perspektiven haben wir, die wir dieses Buch geschrieben haben, Befunde zusammengetragen, die uns gezeigt haben, dass Menschen, gibt man ihnen die richtigen Voraussetzungen, angenehm, hilfsbereit, kooperativ und freigebig sein können. Forschungsergebnisse sowohl der evolutionären Psychologie als auch der Anthropologie, der Verhaltensökonomik und der Spieltheorie zeichnen ein positives Bild, aus dem abzulesen ist, dass der Homo sapiens auch ein Homo solidaricus sein kann (und ja, wir wissen, dass das kein korrektes Latein ist. Romanes eunt domus!).
Als wir diese Dinge zu diskutieren begannen, bemerkten wir, dass es ein paar Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft gibt, die wenig bekannt sind. Wir sollten in diesem Zusammenhang vielleicht darauf hinweisen, dass wir weder Biologen noch Psychologen oder Verhaltensökonomen sind. Wir kommen beide aus der Politik, gehören zur Gattung Zoon politikon, wie der griechische Philosoph Aristoteles das nannte, mit reichlich Erfahrung in Gewerkschaften und langer Mitgliedschaft in Parteien links der Mitte. Durch diese Brillen blicken wir, wenn wir schreiben und Ergebnisse aus all den unterschiedlichen Fachgebieten auswählen und interpretieren.
Wir haben weder die Voraussetzungen noch die Absicht, ein Standardwerk über den Menschen, die Natur und die Gesellschaft zu schreiben. Wir hoffen aber trotzdem darauf, vielen Menschen diese neuen und spannenden Perspektiven aufzeigen zu können, um dann gemeinsam und in ehrenamtlicher Arbeit – darauf verstehen wir uns ja – herauszufinden, wie wir dafür sorgen können, dass es in unserer Gesellschaft weiterhin nicht so schlimm ist, wenn man beim Joggen seine Geldbörse verliert. In einem Punkt sind wir uns nämlich ganz sicher: Die große Mehrheit von uns Menschen lebt lieber in einer solchen Gesellschaft.
KONSERVATISMUS UND NATUR
Zu Beginn möchten wir aufzeigen, wie einige verbreitete Vorstellungen von der menschlichen Natur entscheidende politische Konsequenzen haben und hatten.
Wer als junger Mensch nicht radikal sei, habe kein Herz, und wer als Erwachsener nicht konservativ sei, kein Hirn, heißt es sinngemäß in einem Ausspruch von Georges Clemenceau. Dieser Satz illustriert die verbreitete Annahme, dass politischer Konservatismus sachlich und realistisch sei. Die linke politische Seite werde von Herzenswärme und Idealismus angetrieben, während die konservative auf kühler Logik und dem sachlichen Verständnis der menschlichen Natur fuße. Die optimistische Sicht der Linken auf die Menschheit und ihre Möglichkeiten zu einer friedlichen, gerechten Gesellschaft zerschellen dieser Meinung nach an der harten Realität und den wissenschaftlichen Erkenntnissen über das wahre Wesen des Menschen.
Gegen diese Meinung gibt es einiges einzuwenden. Erstens zeichnet die Wissenschaft beileibe kein so düsteres Bild von der Entwicklung des Menschen und seiner Vernunft, wie viele es glauben. Zweitens entspringt der Wunsch nach einer friedlichen, gerechten Gesellschaft nicht notwendigerweise allein aus der Herzenswärme der Linken, sondern mindestens ebenso sehr aus intelligentem, vitalem Eigeninteresse. In solidarischen Gesellschaften lebt es sich nämlich gut und das für alle, die in ihnen leben. Darauf kommen wir im letzten Teil des Buches noch einmal zu sprechen.
Drittens darf in Frage gestellt werden, ob die Denker der Konservativen mit ihrer Meinung über das Wesen des Menschen wirklich Recht haben. Sehen wir uns das mal genauer an.
»Tatsächlich fördert er [der Einzelne] in der Regel nicht bewusst das Allgemeinwohl, noch weiß er, wie hoch der eigene Beitrag ist. Wenn er es vorzieht, die eigene nationale Wirtschaft anstatt die ausländische zu unterstützen, denkt er nur an die eigene Sicherheit, und wenn er dadurch die Erwerbstätigkeit so fördert, daß ihr Ertrag den höchsten Wert erzielen kann, strebt er lediglich nach eigenem Gewinn. Er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, der keineswegs in seiner Absicht lag. Es ist auch nicht immer das Schlechteste für die Gesellschaft, daß dieser nicht beabsichtigt gewesen ist. Indem er seine eigenen Interessen verfolgt, fördert er oft diejenigen der Gesellschaft auf wirksamere Weise, als wenn er tatsächlich beabsichtigt, sie zu fördern.«3
So lautet eine Kernidee des schottischen Moralphilosophen Adam Smith, der gemeinhin als Begründer der klassischen Nationalökonomie angesehen wird. Seine Theorien – wie sie wiedergegeben werden – haben enormen Einfluss auf den Aufbau der westlichen Gesellschaften gehabt. In Smiths Theorien geht es nicht darum, wie der Mensch sein sollte, sondern wie er seiner Meinung nach faktisch ist, und in der Folge um die Frage, wie wir unsere Gesellschaft entsprechend anpassen. Adam Smith schrieb sein Hauptwerk Der Wohlstand der Nationen (1776) noch vor der Geburt Darwins und hatte damit keinerlei Zugang zu den Einsichten, die wir in den letzten zweihundert Jahren über unsere biologische Natur gewonnen haben.
Einige Politiker sind trotzdem noch der Auffassung, dass sich der Aufbau der Gesellschaft nach den veralteten Theorien und Schlussfolgerungen von Adam Smith richten sollte. So liegen auch der Gründung der rechtsnationalen, norwegischen Fremskrittspartiet die Ideale der liberalistischen Marktökonomie nach Der Wohlstand der Nationen zugrunde. Dabei ist es alles andere als klar, was Smith wirklich gemeint hat. Häufig wird in diesem Zusammenhang auch auf das Buch Theorie der ethischen Gefühle (1759) verwiesen, in dem Smith ein ganz anderes Bild des Menschen zeichnet. Trotzdem ist Smith ohne Zweifel die wichtigste Quelle der Annahme, dass hinter jedem Dienst für die Allgemeinheit ein Eigeninteresse steckt. Wir werden versuchen aufzuzeigen, dass diese Ideen aus dem 18. Jahrhundert im Widerspruch zu dem stehen, was wir heute über uns Menschen und unsere engsten Verwandten wissen.
Die große Frage
In seinem Bestseller Das Prinzip Empathie, auf den wir uns in diesem Buch häufig beziehen, stellt der Biologe Frans de Waal zu Beginn wichtige Fragen. So zum Beispiel: »Warum sind wir auf der Erde?« Oder: »Was ist der Sinn des Lebens?«4 Zwei der wichtigsten Antworten – mal abgesehen von den rein religiösen Herangehensweisen – sind laut de Waal die Postulate der Wirtschaftswissenschaftler, dass wir hier sind, um zu konsumieren und zu produzieren, sowie die Behauptung der Biologen, dass wir hier sind, um zu überleben und unsere Gene weiterzugeben. Nach de Waal ist es kein Zufall, dass diese beiden Antworten sich gleichen und beide andeuten, dass der Sinn des Lebens ein Konkurrieren um Ressourcen sei, bei dem es letztlich darum gehe, sich so viele Nachkommen wie nur möglich zu sichern. Beide Antworten entspringen dem Zeitgeist der industriellen Revolution in England. Eine Zeit, die uns schließlich Denker wie Adam Smith bescherte.
Die Wendung Survival of the fittest kam zuerst von dem britischen Philosophen Herbert Spencer, fünf Jahre nach der Veröffentlichung von Darwins Über die Entstehung der Arten (1859). Der Ausdruck wurde sinngemäß auch von Darwin genutzt, er verwendete allerdings die Worte »natürliche Auslese«5 für den Mechanismus, der bestimmt, welche Eigenschaften an neue Generationen weitergegeben werden und welche nicht. Ausgehend von der Beobachtung, dass die am besten angepasste Art überlebt, schloss Spencer, dass dies auch ein gutes Modell für den Aufbau einer Gesellschaft sei. Seine Gedanken über das Recht des Stärkeren weckten insbesondere bei der damaligen Industriebürgerschaft großes Interesse. Die Oberklasse früherer Epochen hatte ihre Stellung mit der Religion begründet: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Dasselbe galt für die Verteilung der Güter. Ein König galt als König von Gottes Gnaden, und die Kirche predigte, dass ein jeder sich an seinen Stand halten solle. Der Mythos des blauen Blutes deutet an, dass man bis zu einem gewissen Grad tatsächlich von reellen, biologischen Unterschieden ausging.
Mit der industriellen Revolution entstand eine neue Art von Oberschicht. Nicht selten war diese neue Bürgerschicht erst vor Kurzem aus der Masse der Bevölkerung aufgestiegen. Die Weltsicht, aufgestiegen zu sein, weil sie es verdiente, und keine Verpflichtungen denen gegenüber zu haben, die sich weiter unten befanden, kam ihr deshalb sehr gelegen. In den USA gab es einen Überschuss an Menschen, die auf der Suche nach Glück bereit waren, ein hohes, persönliches Risiko einzugehen. Die Reise von der Alten in die Neue Welt war im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich und bedeutete für viele den endgültigen Abschied von Freunden und Familie in ihrem Heimatland. Da die meisten es darauf abgesehen hatten, sich mit ihrer Hände Arbeit ein besseres Leben zu schaffen, war auch die daraus entstehende Gesellschaft von dieser Mentalität gekennzeichnet. Es ist deshalb keine Überraschung, dass Spencers Gedanken laut de Waal in den USA auf fruchtbaren Boden fielen.
Seit den Tagen von Darwin und Spencer haben die Menschen oft auf die »Natur« verwiesen und dort nach Beweisen gesucht, dass ihr bevorzugtes Gesellschaftsmodell seinen Ursprung in der wahren Natur des Menschen habe. Erstaunlich ist das nicht. Nachdem sich das Wissen über die Ähnlichkeit von uns Menschen mit anderen Tieren verbreitet hatte, suchte man zunehmend auch nach Parallelen, die zeigen konnten, wie die Gesellschaft ausgerichtet werden musste. Gerade die Anhänger von größtmöglicher, freier Konkurrenz und großen sozialen Unterschieden berufen sich immer wieder auf die biologische Entwicklungslehre und die Evolution. Sie nutzen diese sowohl als Erklärung für die großen Unterschiede als auch als Begründung, warum dies so sein müsse. Wenn der frühere Vorsitzende des schwedischen Arbeitgeberverbandes Leif Østling argumentiert, dass die Reichsten des Landes das Recht haben müssen, sich Plätze in Seniorenresidenzen zu kaufen, von deren Standard normale Rentner nur träumen können, begründet er dies mit Darwin. Über die Zeitung Expressen hat er eine klare Botschaft an die ärmeren Rentner gerichtet: »Ich pflege zu sagen, dass ja auch die Natur nicht gleichgestellt ist. Die Natur hat uns mit unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen ausgestattet. Die Gleichstellung ist ein theoretischer Begriff und widerspricht Darwin und seinen Theorien. Die wahre Antwort auf die soziale Frage liegt in unserer Biologie.«6
Es ist kein Zufall, meint de Waal, dass dieses Argument auch in der berüchtigten »Greed is good«-Rede der Hauptfigur Gordon Gekko im Film Wall Street aus dem Jahre 1987 genutzt wird:
»Entscheidend ist, meine Damen und Herren, dass Gier – um dieses Wort mangels eines besseren zu benutzen – gut ist. Gier ist richtig. Gier funktioniert. Gier klärt die Dinge, durchdringt sie und erfasst das Wesen des evolutionären Geistes.«
Neuere Forschungsergebnisse zeigen hingegen, dass die Evolution bei Weitem nicht nur auf Gier und Eigeninteresse aufbaut. Die Konservativen und ihre Ökonomen dürfen die Biologie und die Entwicklungslehre nicht einseitig für ihre Argumente nutzen. Im Gegenteil: Sowohl die Leben unserer nächsten tierischen Verwandten als auch anderer Tierarten sind in aufsehenerregender Weise gekennzeichnet von Zusammenarbeit und Gerechtigkeit, sie kümmern sich um ihre schwächeren Artgenossen und zeigen Empathie.





























