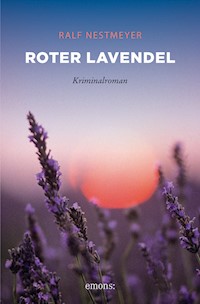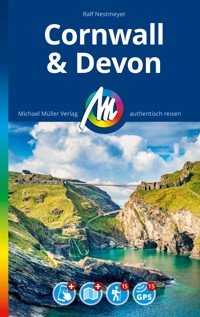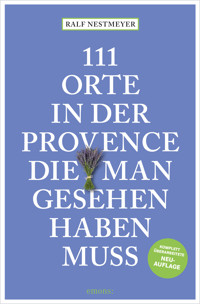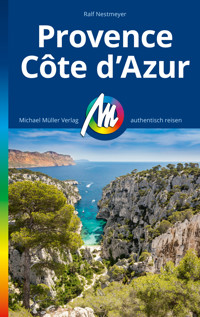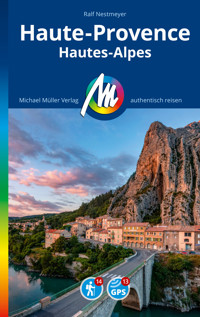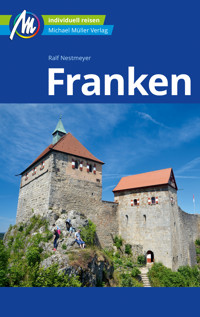6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Glanz, Luxus und internationales Flair, Urlaub, Freiheit und Unbeschwertheit – das Hotel ist Sehnsuchtsort, Ort des Rückzugs, aber auch Raum künstlerischen Schaffens und nicht zuletzt Schauplatz der Literatur. Ralf Nestmeyer begibt sich in diesem Buch auf die Spur des Phänomens Hotel: Er zeigt seine Entwicklung von den frühen Pilgerherbergen über das klassische Grand Hotel bis hin zu den Traumpalästen in Las Vegas und schildert den »Luxus durch Technik«, die immer prunkvoller werdende Ausstattung, vom Aufzug bis zum Pool auf dem Dach. Er charakterisiert das Personal und seine Rollen, vom Liftboy bis zum Direktor, porträtiert die Hotelier-Legende César Ritz und widmet sich schließlich denen, für die der ganze Aufwand betrieben wird: den Gästen – den Zuflucht suchenden Autoren, den Hochstaplern und Dieben, den Stammgästen mit ihren Marotten, und denen, die niemals mehr auschecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ralf Nestmeyer
Hotelwelten
Luxus Liftboys Literaten
Inhaltsverzeichnis
Das Hotel – eine große Welt im Kleinen
Hotelgeschichte
Pilgerherbergen und Postgasthöfe
Schauderhafte Zustände
Ein Lob auf die englischen Unterkünfte
Ein „garniertes“ Bett
Vom Gasthof zum Hotel
Die Schweiz – ein Kursaal mit Panorama
Groß, Größer, Amerika
Das Grand Hotel
Das Bürgerschloss
Bröckelnde Fassaden
Zeremonienmeister und Komparsen
Grand Hotel und Eisenbahn
Luxus durch Technik
Der Hotelaufzug als Juwel eines Vestibüls
Soziale Hierarchien
César Ritz, der König der Hoteliers
Schwimmende Hotelpaläste
Kofferaufkleber (Konfetti für den Koffer)
Moderne Hotelformen (Motel, Kettenhotel und Design-Hotel).
Segen und Fluch des Immergleichen: Das Kettenhotel
Das Motel – ein Symbol des American Way of Life
Hotelgigantomanie
In Bäumen, Gefängnissen und Betonröhren übernachten
Abgedrehte Hotels
Hotelwelten: Zwischen Lobby und Pool
Sakrale Welten: Die Hotelhalle
Die Rezeption, ein Ort der Distinktion
Die Hotelbar
Der Hotelpool
Stammgäste
Gäste, die niemals auschecken
Zimmersuche
Die Inbesitznahme des Zimmers
Hotelpersonal: Vom Portier zum Zimmermädchen
Der Liftboy (Felix Krull und seine Kollegen)
Portiers – Hohepriester der Hotelhalle
Vom Pagen zum Direktor
Hochstapler, Diebe und Detektive
Tod, Schicksal und Leidenschaften
Zuflucht Hotel (Exilautoren)
Das Hotel als Ort der Diplomatie
Begehren im Hotel
Klopf- und Wühlgeister
Wanzen, Küchenschaben, Kakerlaken und anderes wirbelloses Getier
Zimmermissbrauch
Literaturverzeichnis
Impressum
Hotelkultur
Ralf Nestmeyer
Text Copyright © 2023 Ralf Nestmeyer
Alle Rechte vorbehalten
Das Hotel – eine große Welt im Kleinen
Allein der Name „Hotel“ ruft Assoziationen hervor. Man denkt an Glanz, Luxus und internationales Flair, an Urlaub, Freiheit und Unbeschwertheit. Hotels sind kulturgeschichtlich verankerter Müßiggang, sie beschwören Nostalgie und Noblesse, sie sind ein Ort der Verzauberung und Verwandlung. Hotels sind möblierte Sehnsuchtslandschaften, sind Sehnsuchtsorte, die sich nicht nur von einem Wunschbild und dem Glauben an eine besondere Atmosphäre speisen, sondern auch von der Hoffnung, dass man, der eigenen Wirklichkeit entrückt, allein durch den Aufenthalt verändert, schwereloser wird. Das Hotel symbolisiert die Trennung von den Sorgen und der Tristesse des Alltags. Hotelluft macht frei, unangenehme Arbeiten werden delegiert, die Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung scheinen grenzenlos. Ein Hotelaufenthalt verspricht Glücksgefühle zu mobilisieren, weshalb sich viele Paare von einem romantischen Hotelwochenende eine Vertiefung und Belebung ihrer Beziehung erhoffen. Das Hotel ist eine „Heterotopie“ im Sinne Michel Foucaults, da das Hotel beispielsweise bei einer Hochzeitsreise als lokalisierte Utopie die Phantasie anregt und so bestimmte Vorstellungen, Wünsche und Träume projiziert werden. Das Hotel symbolisiert gleichermaßen Ordnung und Ruhe, Sinnlichkeit und Weltflucht. „Wenn das Wort Hotel fällt, werden diese Menschen in ihrem Innersten berührt, eine geheime Saite der Seele beginnt zu schwingen. Es ist, als ob an das Hotel alles delegiert sei, was ein ökonomisch abgesichertes Leben an außerordentlichen Zuständen noch erwarten darf“, schreibt Martin Mosebach in seinem Roman Das Beben.
Hotels sind aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Sie haben die tropische Strände und aussichtsreichen Bergkuppen genauso erobert wie die historischen Fachwerkzentren verträumter Kleinstädte, sie umlagern Flughäfen wie Trabanten einen Planeten, breiten sich an Autobahnausfahrten und Messezentren wie Geschwüre aus und sind in ihren unterschiedlichsten Formen und qualitativen Abstufungen auf jedem Kontinent zu finden. Die "Hotelisierung der Welt" (Martin Mosebach) ist längst im Gange. Sobald über den Wiederaufbau oder die Renovierung irgendeines historischen Gebäudes nachgedacht wird, – egal, ob es sich um ein säkularisiertes Kloster, ein Barockschloss, eine mittelalterliche Scheune oder einen stillgelegten Bahnhof handelt – steht auch immer die Frage nach einer kommerziellen Nutzung als Hotel im Raum. Man hat den Eindruck, dass inzwischen in jedem Gebäude und an jedem beliebigen Ort der Welt ein Hotel eröffnet werden kann – ein Umstand, der in den letzten Jahren durch Hotels in unterirdischen Bunkern oder ehemaligen Gefängnissen überstrapaziert wurde. Doch diese vermeintliche Lösung birgt ein Problem, denn nicht jeder Pferdestall und jedes Turmzimmer gewinnt durch seinen Umbau zum Hotel, allzu oft verlieren die Burgen und Schlösser ihre Seele und ihre geheimnisvolle Aura, wenn sie zur schnöden Kulisse der Wohlfühlindustrie degradiert werden.
Das Hotel ist ein universelles Identifikationssymbol, das meist mit einer Vorstellung von Luxus und Wohnkomfort verbunden ist. Mit seinen Raumkonzepten und technischen Innovation muss das Hotel nicht nur eine Antwort auf die Wünsche der Reisenden bereithalten, sondern diese gewissermaßen vorwegnehmen. Dies war in den Glanzzeiten der Grand Hotels genauso wie bei der „Erfindung“ des standardisierten Kettenhotels und den Design-Hotels moderner Prägung. Die Entwicklung und der Wandel im Beherbergungsgewerbe spiegeln die diesbezüglichen gesellschaftlichen Ansprüche und Vorstellungen als eine Art Blaupause wider, wobei sich das Hotel auch zu einer beliebten Spielwiese für Designer jeder Couleur entwickelt hat.
Jeder Reisende hat eine eigene Hotelbiographie, hat seine persönlichen Lieblingshotels. Es gibt Hotels, deren Stil und Atmosphäre den Gast schon nach wenigen Minuten gefangen nehmen, ihm manchmal auch regelrecht den Atem rauben. An manche Hotels erinnert man sich noch Jahrzehnte später, weil der Aufenthalt mit besonders schönen oder schrecklichen Erlebnissen verbunden war. Der Schriftsteller und große Reisende Cees Nooteboom wusste: „Es gibt zwei Arten von Hotelzimmern – die, in welche man nur einmal kommt, und die, in welche man, warum auch immer, stets wieder zurückkehrt.“ In der einen Kategorie ist man ständig von einer unsichtbaren Menschenmasse umgeben, die koitierend, weinend, rauchend, denkend auf dem Bett liegt, das deshalb stets fremd bleibt. „Du darfst da sein, das ist alles.“ Dann gibt es die anderen Zimmer, in die man immer wieder zurückkehrt. Man weiß, an welcher Stelle der Boden knarrt, wie die Tür des Kleiderschranks einrastet. In diesem Zimmer ist es unvorstellbar, dass jemand anderes dort schlafen könnte. Selbst nach Jahren sieht man den Raum noch ganz deutlich vor sich, er ist zum Teil eines eigenen Territoriums geworden, den man sich erobert hat.
"Die Geschichte des Tourismus ist auch eine Geschichte der Hotels", hatte Hans Magnus Enzensberger bereits 1958 in seinem gesellschaftskritischen Aufsatz „Eine Theorie des Tourismus“ geschrieben. Eine Kulturgeschichte des Hotels ist nicht nur eine Geschichte des Reisens in seinen unterschiedlichsten Spielarten, sie behandelt auch Aspekte der Alltags- und Technikgeschichte. Angefangen von den einfachen Gasthöfen der Frühen Neuzeit über das Grand Hotel bis hin zu seinen modernsten Ausprägungen wie dem Motel sowie den Ketten- oder Boutiquehotel korrespondieren die verschiedenen Hotelformen immer mit den aktuellen sozialen, mentalen und gesellschaftlichen Veränderungen und Wünschen. Im Hotel wird nicht nur die Nacht verwaltet, die Hotelarchitektur ist eingebettet in die Träume und Vorstellungen des modernen Wohnens, Hotels dienten als Experimentierfelder für technische Errungenschaften wie den Fahrstuhl oder postmoderne Designentwürfe.
Spätestens mit der Eröffnung der ersten Palasthotels war das Hotel weit mehr als eine Etappenstation, die das Reisen erleichterte, das Hotel verwandelte sich in einen eigenen Kosmos, so vielgestaltig wie faszinierend. „Ein Hotel ist eine Welt für sich, ein umgrenztes Territorium, ein claustrum, ein Ort, den man freiwillig betritt. Die Gäste halten sich hier nicht zufällig auf, sie sind Mitglieder eines Ordens. Ihr Zimmer, ob ärmlich oder luxuriös, ist ihre Zelle. Wenn sie die Tür dieses Zimmers hinter sich schließen und sich an deren Innenseite befinden, dann haben sie sich aus der Welt zurückgezogen“, befand Cees Nooteboom. Dieses Eintauchen in eine andere Welt, dieses Gefühl, Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein, dazuzugehören, ist ein besonderer Reiz des Hotellebens. Noch heute gibt es Menschen, die ihren Urlaub nicht in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Stadt verbringen wollen, sondern in einem bestimmten Hotel. Das Hotel dient nicht als Zwischenstopp auf einer Reise, sondern das Hotel selbst wird zum Ziel. Überspitzt betrachtet, reist man nicht nach Berlin, um im Adlon zu übernachten, sondern man ist zufällig in Berlin, da sich dort das Adlon befindet.
Wer Hotels baut, erntet Tourismus. Dies war in der Schweiz im 19. Jahrhundert nicht anders, als die spanische Mittelmeerküste im Zeitalter des Massentourismus mit gesichtslosen Bettenburgen gepflastert wurde. Jedes Hotel besitzt eine ökonomische, soziokulturelle und eine geographische Komponente. In vielen Teilen der Welt regte der Bau eines Hotels nicht nur den Reiseverkehr an, sondern auch die gesamte Infrastruktur einer Stadt, einer Region oder einer Insel wurde dadurch nachhaltig geprägt, angefangen vom Straßenbau bis hin zu konkreten sozialen und politischen Veränderungen. Zu den Begleiterscheinungen des Tourismus gehört oft Frieden, meist aber auch zunehmender Wohlstand und soziale Ungleichheit innerhalb der Region. Sobald ein Land in den letzten zwei Jahrhunderten wirtschaftlich prosperierte, ging diese Entwicklung einher mit einem deutlichen Anstieg des Reise- und Geschäftsverkehrs, was wiederum neue Straßen- und Verkehrswege sowie Übernachtungsmöglichkeiten notwendig machte. Schon der wirtschaftliche Aufstieg Nordamerikas korrespondierte mit einem zunehmenden Reiseverhalten und Hotelboom. Wie bei anderen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen, so übernahm Amerika auch bei den Hotels eine Vorreiterrolle. Selbstverständlich waren auch die Hotels im Land der unbegrenzten Möglichkeiten größer und besser ausgestattet als in Europa, bereits die ersten Wolkenkratzer beherbergten Hotels und das Hotelzimmer wurde zu einem standarisierten Produkt. Zuletzt entstand mit dem Motel eine Übernachtungsform, die zu einem Symbol des American Way of Life wurde.
In den europäischen Grand Hotels wiederum bildete sich im Laufe der Zeit ein komplexes System mit zahlreichen sozialen Interaktionen zwischen den Gästen und den Angestellten eines Hotels heraus, das bis heute das Hotelleben prägt. Dazu gehören Begegnungen an der Rezeption und Bekanntschaften in der Hotelhalle oder an der Hotelbar ebenso wie das ihrer jeweiligen Rolle entsprechende Auftreten der Portiers, Zimmermädchen oder Pagen. Ein Hotel ist ein Mikrokosmos der Gesellschaft, so prall wie das Leben. "Wenn man in einem eleganten Hotel sitzt, ist man selber elegant." – lautet nach Kurt Tucholsky einer der „Glaubenssätze der Bourgeoisie“. Und Paul Theroux befand so salopp wie treffend: „Ein Hotel ist ein Treibhaus.“
Dieses Hotelleben mit all seinem Glanz und seinen Schattenseiten, mit all seinen Geheimnissen ist ein schier unerschöpfliches Thema und hat zahllose Schriftsteller inspiriert. Vor allem Joseph Roth, Stefan Zweig und Thomas Mann haben sich durch eine besondere Affinität zum Hotelleben ausgezeichnet. Joseph Roth hat – wie beispielsweise auch Vladimir Nabokov – einen großen Teil seines Lebens im Hotel verbracht. Wer nur in Hotelzimmern lebt, erreicht einen Zustand des Seins, der sich nicht auf materiellen Besitz gründet. Die eigenen Habseligkeiten passen in einen oder zwei Koffer. „Nomadisch wandernd von Hotel zu Hotel, von Stadt zu Stadt mit einem kleinen Koffer, einem Dutzend feingespitzter Bleistifte und dreißig oder vierzig Blättern Papier in seinem unwandelbaren grauen Mäntelchen...“ – so beschrieb Stefan Zweig in seinem Nachruf das Leben von Joseph Roth, der wie kein anderer Schriftsteller zum „Hotelbürger“ avancierte. Andere Schriftsteller wie Klaus Mann oder auch Jean-Philippe Toussaint haben immer wieder Szenen ihrer Bücher ins Hotel verlegt. Viele Romane und Filme nutzten das Hotel als einen besonderen Schauplatz, an dem Lebensentwürfe auf die Probe gestellt werden und sich der Einzelne seiner brüchigen Identität bewusst wird. „Die Wahrheit liegt am Ende des Korridors“, hat der Filmkritiker Andreas Kilb einmal geschrieben. Ein Hotel ist wie für einen Roman geschaffen: Hinter jeder Zimmertür scheinen sich Geheimnisse zu verbergen und sich Schicksale von ungeahnter Tragweite zu offenbaren.
Als in Franz Werfels 1927 veröffentlichter Erzählung Die Hoteltreppe eine junge Frau namens Francine in einem norditalienischen Luxushotel die Treppe in den fünften Stock hochsteigt, erkennt sie, dass es nicht allein den Raum zu überwinden galt. Mit jedem Schritt wird ihr die Leere ihres Lebens bewusster, einsam und verzweifelt schämt sie sich, eine Liebesnacht mit einem Hotelgast verbracht zu haben, der ihr im Nachhinein nichts bedeutet: „Warum erbarmte sich in den weiten Gängen des Hotels auch nicht ein Schritt mit menschlichem Hall?“ Und auch Bertolt Brecht wusste: „Im Hotel führt man ein Leben wie im Roman.“ Der seiner gewohnten Umgebung beraubte Gast ist von seinen Gefühlen überwältigt, die Stille des Hotelzimmers wird zu einem literarischen Resonanz- und Reflektionsboden. Im Hotel kreuzen sich die unterschiedlichsten Lebensgeschichten, Hoffnungen und Ängste treffen aufeinander, das gesamte menschliche Dasein verdichtet sich, die Lobby wird zum Kristallisationspunkt moderner Schicksale. Vicki Baums Menschen im Hotel gehört ebenso wie Joseph Roths Hotel Savoy und Thomas Manns Bekenntnisse des HochstaplersFelix Krull zu den Klassikern der Hotelliteratur, da alle drei Autoren es meisterhaft verstanden haben, das Hotelleben zu sezieren, es bis in seine letzten Winkel zu erhellen. Selbst James Joyce bemüßigte in Finn’s Hotel die Hotel-Metapher, um einen Ort zu schildern, an dem Menschen kommen und gehen.
Die Hotelatmosphäre gilt als inspirierend. Die ungewohnten Räumlichkeiten, der beschränkte Platz und die wenigen Dinge, die Ablenkung verheißen, befreien die Kreativität. Zahlreiche Künstler haben während ihres Hotelaufenthalts an ihren Werken gearbeitet, so soll Richard Wagner in einem Hotel in La Spezia die Ur-Idee zum musikalischen Beginn des Rings des Nibelungen eingefallen sein und im Hotel Schweizerhof in Luzern seinen Tristan vollendet haben, während Claude Debussy im Grand Hotel in Eastbourne seine Symphonie La Mer zu Ende komponiert hat. Maurice Utrillo, der ja eigentlich mit seinen Bildern über die trostlosen Pariser Vororte bekannt wurde, mietete in den 1950-er Jahren alljährlich die oberste Etage des Réserve de Beaulieu an der Côte d'Azur, wobei er das Badezimmer zum Atelier umfunktionierte. Als Künstlerhotel war das New Yorker Chelsea Hotel sowieso ein Musenhort, und Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Joseph Roth und William Burroughs gehören zu dem prominenten Kreis von Schriftstellern, die einen großen Teil ihrer Werke in einem Hotelzimmer geschrieben haben.
Wie der Bahnhof oder der Strand, so ist auch das Hotel ein Ort der Moderne, ein Ort, an dem sich die Mechanismen und Funktionalitäten moderner Lebenswelten offenbaren, ein Grenzort, an dem sich das öffentliche und private Leben wie auf einer Bühne begegnet. Mit seiner zweckorientierten Architektur vereint das Hotel gesellschaftliche und kulturelle Prozesse der Modernisierung wie auch der Urbanisierung in besonderer Weise. Das Hotel ist gewissermaßen ein Ort des Übergangs zwischen Privatsphäre und öffentlicher Repräsentation, weshalb sich nicht nur der Name Hotel, sondern auch das Hotel in seiner heutigen Form in jener Epoche herausbildete, als das Bürgertum an Bedeutung gewann und sich in entsprechenden Räumlichkeiten (re-) präsentieren wollte.
Das Hotel ist „ein neutraler Ort, ohne Verpflichtung, Ort des Übergangs und der Ungewißheit“ – so hat es der Literaturnobelpreisträger José Saramago in seinem Roman Das Todesjahr des Ricardo Reiss formuliert. Der Dichter Camille Bryen hat das Hotel auch als Ort des fließenden Übergangs beschrieben: N’être qu’entre – nirgendwo sein als im Dazwischen. Andererseits ist das Hotel aber auch ein Ort der Grenzüberschreitung, der geradezu für ungewöhnliche Erlebnisse prädestiniert scheint. Bereits in der Hotelhalle existiert ein besonderes Spannungsverhältnis, ebenso beim ersten Betreten des Zimmers sowie bei der Abreise – Siegfried Kracauer hat die Hotelhalle gar mit einem Gotteshaus verglichen. Ein Hotel ist ein kultivierter Ort des Fremdseins, der einem alle Freiheiten verspricht, weil man nicht auf das Wohlwollen eines Gastgebers angewiesen ist. Dies nehmen manche Gäste allerdings allzu wörtlich, wobei es nicht nur Rockstars sind, die verwüstete Zimmer hinterlassen und die Hotelbar plündern, ohne dafür zu bezahlen. Wie die Damen des horizontalen Gewerbes sind auch Hotelzimmer käuflich – alles ist nur eine Frage des Preises, der Verfügbarkeit und der persönlichen Vorlieben, und zur Not ist man auch zu Zugeständnissen bereit. Niemand gibt sich der Illusion von Dauer und Beständigkeit hin. Versiegen die Geldmittel, so bleibt einem fortan die Gunst des Hotellebens verwehrt – eine bittere Erfahrung, die schon viele Reisende machen mussten.
Ein Hotelzimmer ist aber stets auch ein besonderer Ort der Diskretion gewesen, der sich zum erotischen Erfahrungsaustausch geradezu anbietet. Ein Hotelzimmer gilt als „ein Altar der Intimität“ (Paul Theroux). Das Hotelzimmer ist ein geschützter Raum, der vorübergehend eine Privatsphäre bietet, in die außer dem Hotelpersonal kein Fremder eindringen darf. Dieses Wissen kann die Einsamkeit erträglicher, aber auch schmerzlicher machen. Viele Reisende und Autoren haben Erfahrungen in heruntergekommenen Absteigen gemacht, die statt der erhofften Nachtruhe vom ersten Augenblick an nur den Wunsch weckten, das Zimmer am Morgen so schnell wie möglich verlassen zu können. Für manche Schriftsteller wie Anton Tschechow, Oscar Wilde, Raymond Roussel oder Cesare Pavese war das Hotel die letzte Lebensstation, ein letzter Rückzugsort vor den Unbilden des Lebens.
Ähnlich wie die Wolkenkratzer und die Kaufhäuser des frühen 20. Jahrhunderts wurde auch das Hotel weltweit zu einem architektonischen Symbol. Und das ideale Hotel ist die Summe seiner Projektionen. Der Dichter Raoul Schrott hat Hotels als „die eigentlichen tempel unseres jahrhunderts“ bezeichnet. Hotels „sind monumente von epochen, die an den ornamenten ihrer architektur erkennbar werden und sich an den bröckelnden fassaden verraten“. Manche Hotels wie das Pariser Ritz oder das Oriental in Bangkok werden selbst zur Sehenswürdigkeit, wobei die eigene Vergangenheit stets Teil der Gegenwart ist. Nicht nur Thomas Mann liebte „die feierliche Stille, die zum Ehrgeiz der großen Hotels“ gehört.
Letztlich gleicht kein Hotel dem anderen, manche sind mit edelsten Antiquitäten möbliert, andere unterscheiden sich durch ihr altertümliches Tapetenmuster oder durch das Konzert ihrer Wasserrohre. Wahre Hotelliebhaber vergleichen den Charakter eines Hotels mit dem eines Menschen. Es gibt elegante und verträumte, es gibt spießige und heruntergekommene Unterkünfte. Es gibt Hotels nur für Frauen wie das 1903 eröffnete Martha Washington Hotel in New York, es gibt Hotels für Schwule, für die Flitterwochen und für Hunde. Es gibt Hotels für die schönsten Tage des Jahres und für gewisse Stunden. Andere Hotels führen als Wintersporthotel, Strandhotel, Parkhotel oder Golfhotel ihre Bestimmung oder ihren besonderen Reiz bereits im Namen mit. Ergänzt wird das Angebot durch selbsternannte Design- und Themenhotels, die in der Beleibtheitsskala inzwischen aber durch Wellnesshotels in diversen Ausprägungen verdrängt werden. Jedes Hotelzimmer enthält eine Botschaft an den Gast. Und die 200-Quadratmeter-Luxussuite spricht eine andere Sprache als das standarisierte Kettenhotel an der Autobahnausfahrt. Letzteres besitzt den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass man sich, egal, ob in Mailand, Marseille oder Mönchengladbach, sofort zurechtfindet und auch im Dunkeln ohne große Anstrengung die Toilettenspülung betätigen kann. Andererseits hat man in dem ewig gleichen Interieur das tröstliche Gefühl, sich das Fremde vom Leib zu halten und letztlich gar nicht verreist zu sein.
Mehr als zwei Jahrhunderte sind vergangen, seitdem die ersten Hotels ihre Gäste empfingen. Zwei Jahrhunderte, in denen das Hotelgewerbe einem steten Wandel unterworfen war, sich in vielfacher Weise verändert und neu erfunden, aber keinen Augenblick von seiner Faszination verloren hat. Zwischen Grand Hotel und Stundenhotel öffnet sich ein ganzer Themenkosmos, der mit seinen vom Kofferaufkleber bis zum Hochstapler, vom Hotelpool bis zum Portier reichenden Ingredienzien noch immer den Reiz und die große Anziehungskraft des Hotellebens ausmacht. Das Hotel strahlt auf seine Gäste aus, stellt eine Beziehung her, die manchmal so innig ist, dass es Gäste gibt, die sich ein Leben außerhalb der bunten Hotelwelt gar nicht mehr vorstellen können. Oder, um mit Vicki Baum zu sprechen: „Großartiger Betrieb in so einem Hotel. ... Immer ist was los. Einer wird verhaftet, einer geht tot, einer reist ab, einer kommt. ... Hochinteressant, aber so ist das Leben.“
Hotelgeschichte
Wenn jemand eine Reise tut, so braucht er ein Bett zum Übernachten – ließe sich in Anlehnung an Matthias Claudius behaupten. Seit Jahrtausenden stellte sich jedem Reisenden die Frage, ob und wo er am Abend eine Unterkunft finden würde. Wer Glück hatte, konnte auf dem Land oder in der Stadt auf die sprichwörtliche Gastfreundschaft zählen, was wiederum am einfachsten war, wenn man sich auf eine Empfehlung von einem gemeinsamen Bekannten berufen konnte oder zur gleichen Schicht oder Berufsgruppe gehörte. Als letzte Zuflucht blieb den Reisenden oft nur ein Stall oder ein Lagerplatz unter freiem Himmel.
Erst ein dichtes Unterkunftsnetz erleichterte das Reisen und erhöhte die Reisegeschwindigkeit. Bereits in der Antike richtete man daher entlang der Fernstraßen in regelmäßigen Abständen Raststationen und Herbergen ein, um Pferde wechseln und Wagen reparieren, aber auch um Reisende versorgen und ihnen eine Schlafstatt bieten zu können. Die Griechen kannten das pandocheion, im Römischen Reich unterschied man zwischen den mansiones genannten größeren staatlichen Versorgungs- und Übernachtungsstationen und den kleineren, ebenfalls vom Staat unterhaltenen mutationes, bei denen jeweils auch Zugtiere bereitstanden. Daneben gab es noch private Gasthäuser, die entweder als tabernae, stabula, deversoria, hospitia oder cauponae bezeichnet wurden. Manche Ortsnamen wie Tafers und Tawern oder Saverne (Zabern) gehen auf eine römische tabernae zurück. Im Orient und Zentralasien ermöglichten – neben kleineren hane genannten Gasthäusern – vor allem die wehrhaften Karawansereien einen regen Reiseverkehr auf der wirtschaftlich bedeutenden Seidenstraße.
Pilgerherbergen und Postgasthöfe
Nach dem Ende des Römischen Reiches lag auch das Beherbergungswesen in Europa darnieder. Soweit die spärliche Quellenlage Rückschlüsse zulässt, dürfte es im Mittelalter kaum Gasthöfe im heutigen Sinne gegeben haben. Die zahlreichen Pilger übernachteten in eigens für sie bestimmten Herbergen, Kaufleute bei ihren Geschäftspartnern, Handwerker in eigenen Gilde- und Zunftstuben, reisende Adelige und Kleriker bei ihresgleichen in Burgen und Schlössern, Klöstern oder Pfarrhäusern. Gekrönte Herrscher zogen mit ihrem Tross von Pfalz zu Pfalz, von Königshof zu Königshof. In größeren Städten wie Köln, Lübeck oder München standen noch Spitäler mit großen, nach Geschlechtern getrennten Schlafsälen zur Verfügung, jedoch bargen sie auch das Risiko, sich mit einer Krankheit anzustecken. Eine besondere (Schutz-) Rolle kam den Hospizen zu, die auf den Passhöhen der Alpen zu finden waren. Meist hatten die Wirtshäuser nicht viel mehr zu bieten als das Stroh in ihren Ställen oder die blanken Bänke in der stickigen Gaststube; in den Hafenstädten schliefen die ärmsten Quartiersuchenden im Sitzen, den Oberkörper und die Achseln über einem Tau hängend. Erst im Laufe des Spätmittelalters entstanden in Europa die ersten kommerziellen Gasthäuser, die Fremden gegen Bezahlung ein komfortableres Nachtquartier und eine einfache Verköstigung anboten. Eine Vorreiterrolle nahmen die Hafen- und Messestädte ein, wobei in den dortigen Herbergen oft auch Geschäfte abgeschlossen wurden.
Zwar gab es in größeren und von Reisenden gut frequentierten Städten wie in London, Paris oder im päpstlichen Avignon Dutzende von Herbergen, doch griffen die meisten Reisenden und Kaufleute auf private Unterkünfte zurück. Infolge der allmählichen Verbesserung des Straßenbaus und der Zunahme des Handelsumschlags schwoll der Reiseverkehr an, so dass es immer schwieriger wurde, in einem Privathaus mit Kost und Logis versorgt zu werden. Durch das wachsende Bedürfnis reisender Bürger nach einer bequemen Unterkunft entstanden in den größeren Städten und an Orten, die vom Durchgangsverkehr lebten, zahlreiche mehr oder weniger stattliche Gasthöfe, wobei in den ländlichen Regionen die Trennung zwischen Küche, Gastraum und Schlafgelegenheiten oft fließend war. Der Wandel der Reisegewohnheiten, -bedürfnisse und -zwecke veränderte in der Frühen Neuzeit auch die Funktion und Eigenart der Wirtshäuser in den Städten sowie auf dem flachen Land. So konnte man in Mitteleuropa etwa alle dreißig Kilometer – was einer Tagesreise entsprach – mit einem Gasthaus oder einer Poststation mit Unterkunftsmöglichkeiten rechnen. In den Städten befand sich der Gasthof meist in zentraler Lage am Marktplatz und damit in unmittelbarer Nachbarschaft von Rathaus und Kirche.
Bereits damals gab es in Europa landestypische Unterschiede und Gepflogenheiten. Als Michel de Montaigne 1580 und 1581 eine Bäderkur unternahm, die ihn bis nach Italien führte, notierte der berühmte Essayist in seinem Reisetagebuch: „Man muss schon heikel sein, wenn man sich über das Übernachten in Deutschland beschwert. Wer in seinen Reisekoffern eine Matratze, die man dort nicht kennt, und einen Betthimmel mitnehmen würde, könnte nichts mehr aussetzen. Der Deutsche kann es nicht aushalten, auf einer Matratze zu schlafen, der Italiener nicht auf Federn und der Franzose nicht ohne Vorhang und Feuerung.“
Schauderhafte Zustände
Montaignes Lob gehört eher zu den Ausnahmen. Die Wirklichkeit, die die Reisenden in den Wirtshäusern vorfanden, war meist eine andere. Die Reiseberichte und Tagebücher der Postkutschenzeit sind voll von Klagen über das schlechte Essen, betrunkene und lärmende Tischgenossen sowie sich prostituierende Frauen. In den Räumen, in denen man sich zur Ruhe bettete, erwarteten die Reisenden stinkende Nachtgeschirre und anderer Unflat. Erasmus von Rotterdam erwiderte auf die Frage, ob die Nachtlager in Deutschland sauber wären: „Es ist dieselbe Sauberkeit wie beim Essen. Die Bettlaken sind ungefähr vor einem halben Jahr gewaschen worden.“ Und der 1571 in Trient geborene Hippolyt Guarinonius klagte über die „verpestete Luft in den Schlafkammern“, in denen „die Wand neben den Bettstatten mit großpatzetem Rotzschlegel und Speychel gezeichnet“ sind. Als Arzt befürchtete er, sich „Räuden, Geschwör, Schlier, ... Frantzosen und dergleichen Feg-Täuflein“ zu holen.
Oftmals gab es in den Herbergen nicht einmal Betten für die Reisenden. Als der Freiherr Carl Ludwig von Pöllnitz im Jahre 1730 von Nürnberg nach Württemberg reiste, sah er sich „gezwungen, in einem kleinen, gewöhnlichen Städtchen unterzukommen. Das Gasthaus machte einen guten Eindruck, das Abendessen erwies sich als leidlich und der Wein war hervorragend. Dann baten wir das Zimmermädchen, uns die Betten zu zeigen. Sie führte uns in einen langen, großen Raum; an den Wänden lang ringsum ein Strohteppich, dessen Funktion wir nicht recht verstanden, da ihre Ställe unmöglich so hoch oben liegen konnten. Zu unserem großen Erstaunen teilte uns das Mädchen mit, daß eben dieser der Raum sei, in dem wir schlafen sollten, da es im ganzen Haus nur ein einziges Bett gab, welches von den Wirtsleuten belegt war. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns, angekleidet wie wir waren, auf dem Stroh niederzulassen, als ob wir Pferde wären. Wenig später kam ein Dutzend gut gekleideter Reisender hinzu, die mit den örtlichen Gepflogenheiten vertraut waren und sich glücklich und zufrieden auf das Stroh warfen, um bald wie Murmeltiere zu schlafen. Was mich betraf, so schlief ich beherzt wenig und war froh, als ich den Morgen anbrechen sah.“
Da es keine Telekommunikation gab, war es so gut wie unmöglich, eine Unterkunft zu reservieren. Selbst gutsituierte Reisende mussten daher meist mit dem nächstbesten Quartier vorliebnehmen, das ihnen angeboten wurde. Daher rechnete man damit, seine Kammer mit Fremden teilen zu müssen; ein Bettvorhang mochte einen gewissen Sichtschutz bieten. Unter weniger vermögenden Reisenden war es nicht unüblich, sich mit mehreren Personen ein Bett zu teilen, so dass es in der stockdunklen Nacht oft zu peinlichen Begegnungen kam – was Komödien- und Novellenschreiber gerne als Inspirationsquelle nutzten. Im Winter galt die bewährte biblische Maxime: "Wenn man zu zweit schläft, kommt die Wärme; aber allein, wie soll einem da warm werden?!" Doch selbst wer über das nötige Kleingeld verfügte, musste zusammenrücken, wenn es nicht genug Betten gab: „Des Abends, als man schlafen gehen wollte, fanden sich nur drei Betten für fünf Personen. Sie losten, welche zwei und zwei beisammen schlafen sollten, und da fielen die zwei Burschen zusammen, der Leutnant auf eins allein, und der fremde Herr mit Stilling bekamen das beste“, erinnerte sich Johann Heinrich Jung-Stilling. Auch Johann Gottfried Seume blieb auf seinem Spaziergang nach Syracus in Böhmen nichts anderes übrig, als sich das Nachtlager mit mehreren fremden Personen zu teilen: Man schichtete „uns mit den Hebräern so enge auf das Stroh, daß ich auf dem britischen Transport nach Kolumbia kaum gedrückter eingelegt war. Solche Abende und Nächte mußten schon mit eingerechnet werden, als wir den Reisesack schnallten.“ Im Laufe seiner Reise wurde Seume immer genügsamer. "Übrigens ist mir so ziemlich einerlei, ob ich mich auf Eiderdaunen oder Bohnenstroh wälze.“ Von der Qualität der Wirtshäuser ließ er sich kaum beeindrucken: „Das beste ist mir nicht zu gut, und mit dem schlechtesten weiß ich noch fertig zu werden. Ich denke, es ist noch lange nicht so schlimm als auf einem englischen Transportschiffe, wo man uns wie die schwedischen Heringe einpökelte, oder im Zelte, oder auf der Brandwache, wo ich einen Stein zum Kopfkissen nahm, sanft schlief und das Donnerwetter ruhig über mir wegziehen ließ.“
Einen besonders schlechten Ruf genossen damals die italienischen Gasthöfe. Und je weiter man den Stiefel hinabfuhr, desto schlimmer wurden die Zustände. Roland de la Platière, der 1777 in Kalabrien und Sizilien unterwegs war, schilderte eine dieser Unterkünfte: „Das Ganze ist nichts weiter als ein geräumiger Stall, an dessen hinterem Ende ein offenes Feuer brennt und ohne Rauchabzug oder Herd gekocht wird; hier ißt man und legt sich hin, oder man schläft auf einer Art Lager aus Ziegelsteinen, die in der Mitte des Stalls hinter den Pferden aufrecht gestellt werden. Wenn noch Platz ist, kann man auch in der Futterkrippe schlafen.“ Auch Goethe und Seume klagten über die Unwirtlichkeit der italienischen Gastzimmer: Während Goethe im sizilianischen Caltanisetta auf einem mit „Häckerling“ angefüllten Jutesack vorliebnehmen musste, wurde Seume auf dem Weg nach Palermo „aus Höflichkeit die beste Schlafstelle“ zugewiesen: „diese war auf einem steinernen Absatze neben der Krippe; die andern Herren legten sich unten zu den Schweinen. Mein Mauleseltreiber trug zärtliche Sorge für mich und gab mir seine Kapuze: und man begriff überhaupt nicht, wie ich es habe wagen können ohne Kapuze zu reisen.“
Doch auch in den deutschen Herbergen stand es um die Reinlichkeit nicht immer zum Besten: Ungeziefer, Mäuse und Dreck störten den nächtlichen Schlaf. Selbst adelige Reisende blieben von diesen Unbilden nicht verschont. So mokierte sich 1786 der Herzog Carl Eugen von Württemberg über ein Wirtshaus in Rastatt, wo man vor der Nachtruhe erst „noch Ratten aus den Zimmern fangen“ musste. Die zahlreichen Reiseanleitungen und reisetheoretischen Abhandlungen – damals erlebte die heute nahezu vergessene Literaturgattung der Apodemik ihren letzten Höhenflug – künden nicht nur von einer Zunahme des Reiseverkehrs gegen Ende des 19. Jahrhunderts, sondern auch von einem Wunsch nach Orientierung und praktischen Ratschlägen. Neben Verhaltenshinweisen, wie man sein Hab und Gut in den nicht abschließbaren Zimmern vor Diebstahl und sich selbst auf den Landstraßen vor Überfällen schützen könne, widmeten sich die Autoren vor allem hygienischen Problemen.
Dem Reisenden von einigem Vermögen wurde 1795 von dem Bibliothekar Franz Posselt in seiner Apodemik oder die Kunst zu reisen empfohlen, ein "Reisebett" mitzuführen, um den untragbaren Zuständen in den Wirtshäuser und den in den Gästebetten lebenden "beisenden und stechenden Insekten" zu entgehen. Das Mitführen eigener Bettwäsche wurde als unabdingbar angesehen. Notfalls solle man sich lieber mit dem eigenen Reisemantel zudecken, „als mit einem schweren Feldbette, unter welchem vielleicht mancher ungesunde Schwelger und Wollüstling geschwitzt hat“. Andere Autoren empfahlen, eine Reihe von Substanzen ins Reisenecessaire zu packen, die den Parasiten den Garaus machen sollten. Beliebt und häufig zum Einsatz kamen insbesondere Schwefelsäure und diverse ätherische Öle, so beispielsweise Lavendel-Essenzen. Im Allgemeinen dürften die sanitären Verhältnisse in den Gasthäusern denen der Gesamtgesellschaft entsprochen haben, so dass es hier wie dort weder Bäder noch eigene Toiletten gab. Mehr als einen Nachttopf und eine Schüssel mit Wasser konnte man in den meisten Herbergen nicht erwarten. Heinrich August Ottokar Reichard, der mehrere Reisehandbücher geschrieben hatte, richtete sein Augenmerk vor allem auf die „Reinlichkeit“ der Nachtquartiere. In seinem 1801 veröffentlichten Passagier auf der Reise empfahl er seinen Lesern, sich selbst um die größtmögliche Sauberkeit zu bemühen; dies gelte für die „Reinlichkeit des Bettes und frisches Ueberziehen desselben“ ebenso wie für die Beschaffenheit des Abtritts, bei dessen Verunreinigung „man zur Befriedigung des Naturbedürfnisses lieber das Feld ... wählt“.
Gastungen und Wirthshäuser
Der Dreißigjährige Krieg bereitete dem aufstrebenden Beherbergungswesen ein jähes Ende, die allgegenwärtigen Gefahren für Leib und Seele führten dazu, dass sich in Mitteleuropa kaum mehr jemand freiwillig auf Reisen begab. Vor allem auf dem Land und in den kleineren Dörfern war kein Gasthof vor den marodierenden Landsknechten sicher, die sich oft wochenlang einquartierten, die Zeche prellten, den Weinkeller plünderten oder gleich Haus und Hof einäscherten. In Chemnitz beschwerten sich die Wirte beim Stadtrat: „Die Gastung liegt darnieder, Handel und Wandel stocken, niemand reist oder fährt oder kehrt ein. Alle Welt läßt uns im Stiche. Mancher Wirt hat 8 oder 14 Tage nicht einen Gast und kommt einmal ein Reiter, so muß er mehr aufwenden, als er verdient und müssen Wirt und Gesinde jämmerlich dörren.“ Auch nach Kriegsende dauerte es lange, bis der Reiseverkehr wieder in Schwung kam, da jegliche Infrastruktur fehlte. Um Handel und Verkehr zu beleben, ließ der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg nicht nur die Straßen und Brücken in Preußen reparieren, er sorgte auch dafür, dass in regelmäßigen Abständen Wirtshäuser errichtet wurden. Zusammen mit dem Aufbau eines schnellen und zuverlässigen Postwesens verbesserten sich nicht nur in Preußen, sondern in ganz Mitteleuropa die Reise- und Übernachtungsmöglichkeiten.
In Deutschland stieg die Zahl der Wirtshäuser innerhalb von drei Jahrhunderten von ein paar Tausend auf rund 80.000 im Jahr 1800, wobei das Spektrum der Gast- und Wirtshäuser, die den Reisenden Verpflegung und Unterkunft anboten, weitgefächert war. Der nach Gästen ausschauhaltende Wirt war ein beliebtes Bildmotiv jener Zeit. Der Göttinger Professor August Ludwig Schlözer bezeichnete 1795 die Mehrzahl der deutschen Gasthöfe und Schenken als „cultiviert“ und „halbcultiviert“. Nur wenige Herbergen, die er in Frankfurt, Hannover oder Hamburg vorgefunden hatte, lobte er als „hochcultiviert“. Die Bedeutung der Gasthöfe als sozialer Treffpunkt für Fremde und Einheimische wuchs ebenso wie die gesellschaftliche Stellung vieler Gastwirte. Denn es war vor allem die Person des Wirtes, die ein bestimmtes Maß an Qualität und Komfort garantierte. Manchen Wirten gelang damals der soziale Aufstieg, so auch Goethes Großvater Friedrich Georg Göthe, der mit dem Weidenhof eines der vornehmsten Frankfurter Gasthäuser führte und den Grundstock für das Familienvermögen legte. In den vornehmeren Herbergen konnten Gäste „von Stand“ darauf vertrauen, Kutschen oder Pferde bereitgestellt zu bekommen sowie Personal von der Aushilfszofe bis zum Reitknecht vorzufinden. Der Wirt übernahm Verantwortung, versorgte seine Gäste nicht nur mit Essen und Trinken, sondern er besaß auch Informationen über die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Stadt und bemühte sich um die ärztliche Betreuung, falls jemand krank wurde. Die Kosten für „Logis“ betrugen dabei häufig nur einen Bruchteil der Kosten für Speis und Trank, „Wachslichter“ und andere Sonderwünsche wurden zusätzlich berechnet. Wer geschäftstüchtig war, konnte es als Wirt schnell zu Reichtum und Ansehen bringen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass beispielsweise in den neugegründeten Residenzstädten Ludwigsburg und Karlsruhe die ersten Bürgermeister Gastwirte waren.
In größeren Städten deckte das Beherbergungsgewerbe ein breites Spektrum ab. Frankfurt wird in einem Reisebericht aus dem Jahre 1795 gar als „Eldorado der Gastwirthe“ bezeichnet. Vor allem während der Messezeit strömten die Fremden in Scharen herbei. „Das Rothe Haus verdient, nebst den drey Mohren zu Augsburg, vielleicht unter die prächtigsten und vortrefflichsten Gasthöfe in Europa gerechnet zu werden ... Zimmer und Bewirtung sind fürstlich“, befand ein unbekannter Autor. Die meisten Gasthöfe konnten nicht mehr als zwei Dutzend Übernachtungsgäste beherbergen. Der Wirt herrschte als Patron über die Gäste, weshalb auch in der zeitgenössischen Literatur geraten wurde, den Wirt nicht zu reizen oder lautstark Kritik zu üben, da man sonst kurzerhand hinausgeworfen werden könnte; der Wirt kümmerte sich in der Regel um den Empfang, wies die Zimmer zu, verteilte die Arbeit und erledigte die Abrechnung; eine Magd oder ein Kammermädchen hielt die Zimmer sauber und ein Hausknecht versorgte die Pferde der Reisenden, zudem gab es noch Köche und Küchenhilfen, wobei vorwiegend Familienangehörige beschäftigt wurden, nur in den vornehmeren Häusern gab es einen Kellner.