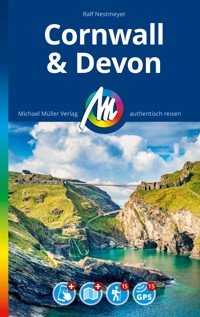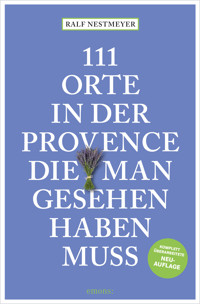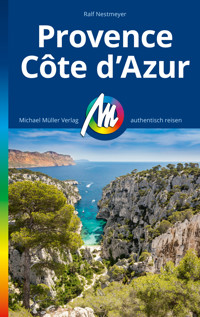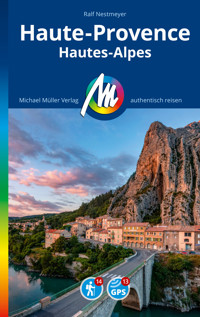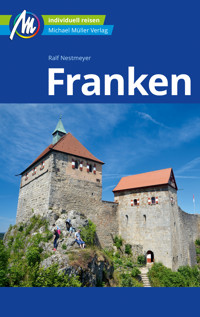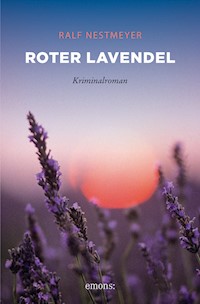
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Provence Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Fotograf und der Wunsch nach einer Auszeit in der traumhaft schönen Provence. Doch die Lavendelmotive rücken schnell in den Hintergrund, als er in Avignon von einem Hotelgast einige historische Dokumente anvertraut bekommt. Kurz darauf ist der Mann verschwunden und der Fotograf gerät bei seinen Nachforschungen immer mehr in den Sog einer mysteriösen Geschichte, deren Schatten bis in die Vergangenheit reicht. Detail für Detail, Schicht für Schicht deckt er ein ungeheuerliches Geheimnis auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Ralf Nestmeyer ist Historiker und lebt in Nürnberg. Er gehört zu den renommiertesten deutschen Reisejournalisten. Nach zahlreichen Reiseführern und Sachbüchern – vor allem zu Südfrankreich– erfolgt nun sein Krimidebüt. Schauplatz: selbstverständlich die Provence. www.nestmeyer.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: age fotostock/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne (CH) eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-795-6 Provence Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
EINS
Schweiß stand ihm in kleinen Perlen auf der Stirn. Er schnappte hektisch nach Luft, während er mit einer Hand an seinem Krawattenknoten nestelte und immer wieder ein rasselndes Pfeifen ausstieß. Von einem Moment zum anderen wurden seine Bewegungen fahriger, unkontrollierter. Seine Augen weiteten sich und fixierten einen imaginären Punkt an der Wand des Abteils, so als suche er Halt. Zwei Mitreisende begannen bereits unruhig mit den Füßen zu scharren. Wie gelähmt verfolgte ich, wie sich der ältere Herr am Fensterplatz vergeblich gegen sein Unwohlsein aufbäumte, seinen Rücken gegen die Lehne presste und nach Atem rang, bevor er mit einem heftigen Zucken die Beine von sich streckte und zur Seite sackte. Sein Kopf war an die vibrierende Fensterscheibe gedrückt, wodurch sich seine Gesichtszüge verzerrten. Ein dünner Speichelfaden rann aus seinem leicht geöffneten Mund, der rechte Brillenbügel ragte schräg hinter dem Ohr in die Luft, und die Zeitschrift, die er gelesen hatte, rutschte wie ein verzögerter Schlussakkord mit einem dumpfen Laut zu Boden.
Nach einem kurzen Moment der Stille, der mir durch das gleichmäßige Rattern des Zuges umso eindringlicher erschien, ging die lähmende Betroffenheit meiner Mitreisenden nahtlos in fieberhafte Nervosität über. Niemand wollte sich so recht um den Mann kümmern, niemand wollte sich aus der schweigenden Anonymität des Beobachters lösen.
»Monsieur, ist Ihnen nicht gut?«, stammelte sein Sitznachbar.
»Ist er tot?«
»Nein, ich glaube, nur bewusstlos.«
»Er braucht einen Arzt! Schnell!«
»Hat er einen Herzinfarkt?«
»Keine Ahnung.«
»Vielleicht ist es ein Asthmaanfall?«
»Kann sein, ich weiß es nicht.«
»Mein Mann verständigt den Schaffner.«– Erst das energische Eingreifen eines Ehepaares, das im Nachbarabteil gesessen haben musste, ließ die Diskussion verstummen. Als vermutlich einziger Ausländer unter lauter Franzosen hielt ich mich zurück, blieb wortkarg, half aber, den bewusstlosen Mann über seinen Nachbarsitz hinweg in eine stabile Seitenlage zu bringen. Er atmete kaum wahrnehmbar, aber er atmete. Jemand hatte ihm Stirn und Mund abgetupft, so dass er friedlich zu schlafen schien.
Er war allein in Valence in den Zug gestiegen und hatte sich mir direkt gegenüber ans Fenster gesetzt. Er hatte bemerkt, dass ich ein deutsches Magazin studierte, und fragte mich, ob ich denn noch an einen deutschen Erfolg bei der Europameisterschaft in Portugal glaube. Dann tauschten wir uns ein wenig über die französischen und deutschen Chancen aus. Er war sich sicher, dass Frankreich seinen Titel erfolgreich verteidigen würde. Woraufhin ich mir einen ironischen Seitenhieb auf die misslungene französische Titelverteidigung bei der letzten Weltmeisterschaft nicht verkneifen konnte.
Quälende Minuten verstrichen, in denen ich immer wieder einen Blick auf den reglosen Mann warf. Er hatte eine Halbglatze; die Haare über seinen Schläfen waren weitestgehend ergraut und bildeten einen auffälligen Kontrast zu den Augenbrauen, die noch immer in einem kräftigen Schwarz leuchteten. Trotz seiner misslichen Lage strahlte er eine gewisse Würde aus, sein Anzug und seine Schuhe waren zeitlos, aber nicht ohne Stil; seine Brille hatte ihm jemand fürsorglich in die Brusttasche gesteckt.
Die sommerliche Hitze drückte mit Wucht durch die Fensterscheiben und machte die Situation noch unerträglicher. Es war ein alter Regionalzug, eine Klimaanlage existierte nicht.
Ich konnte mich nicht mehr auf meine Lektüre konzentrieren und sah zum wiederholten Male aus dem Fenster. Die Landschaft hatte sich verändert, die grünen Maulbeersträucher wurden durch die silbrig glänzenden Olivenbäume verdrängt, die vom Eintritt in die mediterrane Welt kündeten. Der Himmel leuchtete in seinem kräftigsten Blau, nur die Türme des Kernkraftwerks von Tricastin störten die Harmonie.
Offiziell befand ich mich auf einer Recherchereise. Doch die Gründe, die mich in die Provence geführt hatten, waren vielfältiger.
Ganz bewusst hatte ich mich gegen den schnellsten Weg entschieden. Statt nach Marseille zu fliegen, fuhr ich mit der Eisenbahn in Etappen nach Südfrankreich, ließ Landschaften und Orte gemächlich an mir vorüberziehen. Wer mit dem Zug fährt, reist erdverbunden, verankert sich im Diesseits. Erst hatte ich in Lyon Station gemacht, war auf den Spuren der Weber durch die Traboules der labyrinthischen Altstadt geirrt, dann hatte ich das römische Vienne erkundet und mich an den satten Farben der Provinz erfreut. Ich wollte mir Zeit lassen, Abstand gewinnen, mich beruflich und privat neu orientieren. Ersteres aus eigenem Wunsch, Letzteres zwangsweise, nachdem meine Beziehung mit Bettina, meiner langjährigen Freundin, vor wenigen Wochen in die Brüche gegangen war.
Nach mehr als zehn Jahren, in denen ich mir als Mode- und Werbefotograf einen gewissen Namen gemacht hatte, verspürte ich immer weniger Lust, mich in der kreativen Scheinwelt der Werbebranche zu verlieren. Mein vierzigster Geburtstag nahte, und meine Abneigung gegen jegliche Form von Meetings und launische Artdirectors, gegen coole Locationscouts und zickige Models wuchs von Tag zu Tag, breitete sich über mein Leben aus wie ein roter Weinfleck auf einer Tischdecke. Ich fühlte mich ausgebrannt und war trotz der mitunter üppigen Honorare nicht gewillt, mein weiteres Leben im Scheinwerferlicht eines Studios zu verbringen und von Shooting zu Shooting zu hetzen.
Ein Zufall hatte mich in die Provence geführt. Vor ein paar Tagen, an einem der ersten warmen Frühsommerabende, hatte ich mich mit Lars Thonstedt, einem Fotografen, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin, in einem lauschigen Biergarten verabredet. Wir trafen uns alle paar Wochen, um ein wenig zu plaudern und ein paar lockere Stunden miteinander zu verbringen. Lars kam ein wenig zu spät und stöhnte über den Ärger, der ihm durch seine gestohlene Kreditkarte entstanden war. Während ich ihm ein wenig von meiner wachsenden beruflichen Unzufriedenheit berichtete – über Bettina schwieg ich mich aus–, sprühte Lars geradezu vor Tatendrang.
Im Gegensatz zu mir erlebte er gerade einen beruflichen Höhenflug. Überraschend hatte ihn jetzt auch noch »National Geographic« beauftragt, eine Reportage über mongolische Nomaden zu machen. Das verlockende Angebot versetzte ihn allerdings in die missliche Lage, dass er einen anderen, längst zugesagten Auftrag für einen Kalender mit Lavendelmotiven nicht würde erfüllen können. Und just Anfang Juli, wenn der Lavendel in den kräftigsten Farben zu blühen beginnt, sollte sein Expeditionsteam in Dalandsadgad starten. Statt mit dem Auto über das Plateau de Valensole zu kurven, wollte er verständlicherweise lieber mit Kamelen durch die Wüste Gobi ziehen.
Als Lars mir scherzhaft vorschlug, er würde die Zeche übernehmen, wenn ich an seiner Stelle die Fotos machen würde, sagte ich zu seiner – und auch meiner– Verwunderung spontan zu. Er sah mich so ungläubig an, dass ich mein Angebot noch zweimal bekräftigte. Der Abend endete feuchtfröhlich, und wir verständigten uns darauf, dass ich an seiner Stelle durch die Lavendelfelder der Provence streifen würde. Eine bereits vorbereitete Motivliste würde er mir noch zufaxen.
Am nächsten Morgen erzählte ich meinem Assistenten Christian, meine Mutter sei im Urlaub schwer verunglückt, so dass ich in die Provence fahren müsse. Ich bat ihn, einen dringenden Produktionsauftrag für mich zu erledigen, die Post zu bearbeiten und mich bei meinen Kunden bis auf Weiteres zu entschuldigen. Um Christian nicht ohne jegliche Beschäftigung zurückzulassen, besprach ich mit ihm, dass er beginnen solle, die besten Modeaufnahmen der letzten Jahre zu scannen, da ich mein Archiv Stück für Stück digitalisieren wollte. Drei Tage später war ich reisefertig.
Er stöhnte zweimal kurz, dann schlug er die Augen wieder auf und schaute ein wenig orientierungslos in die Runde. Ich half ihm, sich aufzusetzen. Jemand reichte ihm ein feuchtes Tuch und eine Flasche Wasser. Er trank in großen Schlucken, dann murmelte er ein paar Dankesworte und eine Entschuldigung vor sich hin und verwies auf die Hitze und eine Kreislaufschwäche, die ihm seit Jahren zu schaffen mache. Das Angebot des Schaffners, einen Arzt in Avignon zu benachrichtigen, schlug er mit einem »non, ça va« aus. Die Stimmung im Abteil blieb gedämpft, eine Kommunikation kam nicht mehr richtig in Gang. Meine Mitreisenden vermieden es, sei es aus Höflichkeit oder Selbstschutz, zu dem älteren Herrn zu blicken, obwohl sich dieser schon wieder sichtlich erholt hatte.
Der Schatten der Bahnhofshalle hüllte das Abteil in mildes Licht. Alle schienen froh, dass der Zug endlich in Avignon angekommen war. Eile und Betriebsamkeit machten sich breit, vor den Ausgangstüren hatte sich schon eine Warteschlange gebildet. Mit einem fast klagend hohen Ton kam der Zug zum Stehen. Als der Mann aufstand, bemerkte ich, dass er doch noch etwas wackelig auf den Beinen war.
»Sind Sie sich sicher, dass Sie keine Hilfe brauchen?«, fragte ich ihn.
»Ja, aber Sie könnten mir vielleicht helfen, meinen Koffer aus der Ablage zu heben.«
Wir waren die Letzten, die das Abteil verließen. Obwohl er sich kurz dagegen verwehrte, trug ich ihm sein Gepäck auf den Bahnsteig.
»Danke. Das ist sehr nett von Ihnen.«
»Keine Ursache, wo wollen Sie denn hin?«
»Bitte?«– Ich musste meine Frage wiederholen, da er sie im Lärm der krächzenden Lautsprecherdurchsagen nicht verstanden hatte.
»Zum Taxistand. Ich habe ein Zimmer reserviert. Mein Hotel befindet sich in der Nähe des Papstpalastes.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht, könnte ich mir mit Ihnen ein Taxi teilen, da ich mir noch ein Zimmer suchen muss«, schlug ich ihm vor.
Wir gingen langsam zum Ausgang und stiegen in eines der wartenden Taxis. Die Gasse lag schon im Schatten, als das Auto in einer engen Einfahrt vor dem Hotel hielt. Da mir die Fassade gefiel und es kein Kettenhotel war, erkundigte ich mich nach einem freien Zimmer.
Als mir Lars vorschlug, seinen Lavendelauftrag zu übernehmen, hatte ich mich spontan, doch nicht ohne Hintergedanken, zusagen hören. Ich kannte die Provence gut. Carla, eine Freundin aus meiner Zeit an der Münchener Fotoschule, hatte sich vor Jahren von ihrem väterlichen Erbe ein Mas am Rande der Haute-Provence gekauft. Der Kontakt zu ihr war nie abgerissen. Ich hatte sie seither mehrfach besucht und ihr bei der Renovierung des alten Gehöfts geholfen, anfangs das Dach mitgedeckt, später an der Fassade mitgestrichen und die Bruchsteine zu einer die Terrasse begrenzenden Balustrade aufgeschichtet. Auch jetzt war ich auf dem – wenn auch nicht direkten– Weg nach Raboux, zu Carla.
Zuvor wollte ich noch ein paar Tage in Avignon bleiben, denn ich mochte den morbiden Charakter der alten Papstmetropole, ihre fahlen Mauern, ihre versteckten Plätze und abweisenden Fassaden. Avignon ist eine Stadt für Melancholiker. Wer jemals die von parkenden Autos gesäumte Stadtbefestigung abgeschritten hat, weiß, was Monotonie bedeutet.
Der Aufzug ruckelte kurz, bevor sich die Tür öffnete und ich im dunklen Gang stand und nach meinem Zimmer suchte, das sich in einer Ecke am Ende des Flurs befand. Das Zimmer war größer als gedacht, allerdings war die Luft ein wenig stickig, so dass ich das Fenster und die Fensterläden sofort weit öffnete. Dann sah ich mich um: In der Mitte des Raumes stand ein breites, aber schlichtes Doppelbett. Der Bettüberwurf korrespondierte mit den Vorhängen, der Schreibtisch war dreieckig und in die Zimmerecke gerückt, gerade so, als wolle man jemanden dadurch abhalten, hier zu arbeiten. Das Bad wiederum war großzügig und überraschte mich mit einer offenen, begehbaren Dusche. Ich warf meinen Koffer auf die dafür vorgesehene Ablage, dann zog ich mein verschwitztes Hemd aus, duschte und streckte mich auf dem Bett aus.
Als sich die Nacht sanft über die Stadt gesenkt hatte, verließ ich das Hotel und schlenderte noch ein wenig ziellos umher, bis ich, versteckt hinter einer Kirche, ein kleines Restaurant mit einer einladenden Terrasse und sorgsam eingedeckten Tischen fand. Ohne die Menükarte studiert zu haben, entschied ich mich, hier zu Abend zu essen. Die Bedienung war charmant, der Service zuvorkommend. Entspannt lehnte ich mich zurück, beobachtete die anderen Gäste und sinnierte darüber, warum in Frankreich niemand abends allein zum Essen ausging. Ich war ein Exot unter Paaren und Familien. Vom Wein beschwert, zahlte ich und ging.
ZWEI
Das Fenster meines Hotelzimmers war noch immer weit geöffnet und ließ den Lärm der Straße herein. Ein beruhigender Geräuschteppich, der Geborgenheit ausstrahlt und das Alleinsein erträglicher macht.
Immer wenn ich allein in einem Hotel absteige, gehört es zu meinen ersten Handgriffen, das Fenster zu öffnen. Jede Stadt, jedes Viertel besitzt seine eigene Akustik, ein Lautprofil, das ins Zimmer fließt, manchmal als sanfte Kulisse, welche die Sinne betört, manchmal als Stakkato, das sich hämmernd in den Schlaf drängt. Die Erinnerungen an Städte und Ortschaften sind fest verwurzelt mit den Klangszenarien, die mich die Nacht hindurch begleiten und sich tief in meinem Gedächtnis eingebrannt haben. Selbst die verschiedenen Wochentage lassen sich im morgendlichen Halbschlaf ausmachen: das geschäftige Glück des Samstags, die feierliche Steifheit des Sonntags, der Montag mit seinem trägen Eifer, der sich nahtlos in hastige Betriebsamkeit verwandelt.
Ist das Fenster geschlossen, so überfällt mich ein bedrückendes Gefühl, das mich unruhig werden lässt. Auch das Gerumpel eines Aufzugs, zufallende Türen oder das Klackern der Absätze auf dem Hotelflur sind nur ein schwacher Trost, ein Surrogat wie die gesprächige Leere des Fernsehers. Es gibt nichts Schlimmeres als ein Zimmer zum Hinterhof in einem Neubauviertel; die Grabesruhe der monotonen Fassaden droht jeden Gedankenfluss zu ersticken. Sogar im Winter muss ich eine Verbindung zur Außenwelt herstellen. Weder Straßenlärm noch das unaufhörliche Quaken eines Frosches können mich davon abhalten; selbst schlaflose Nächte nehme ich dafür in Kauf.
Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als ich die dicken Vorhänge zur Seite schob, die das Zimmer ins Halbdunkel getaucht hatten. Ich war verwundert, wie lange ich geschlafen hatte. Das Zimmermädchen klopfte, ich stand auf und beeilte mich, das Hotel zu verlassen. Unbeschwert hangelte ich mich von einem Café zum nächsten und lebte zwanglos in den Tag hinein. Nur einmal, als ich zufällig an einem Internetcafé vorbeikam, war ich versucht, hineinzugehen, um meine E-Mails abzurufen. Minutenlang stand ich unentschlossen vor den großen Fensterscheiben, auf denen eine halbe Stunde Internet für einen Euro angepriesen wurde, dann machte ich auf dem Absatz kehrt, schließlich hatte ich meinen Laptop absichtlich zu Hause gelassen, um Distanz zu schaffen, Freiräume zu gewinnen.
Im Office de Tourisme besorgte ich mir einen Stadtplan und erkundigte mich nach einem Schwimmbad. Dann ging ich in eine Buchhandlung, blätterte in ein paar Provence-Bildbänden und machte mir Notizen. Um den Papstpalast machte ich einen weiten Bogen; seine harsche Fassade schreckte mich ab, ließ mich frösteln. Weitaus besser gefiel es mir, im Schatten der Platanen auf dem holprigen Pflaster durch die Rue des Teinturiers zu flanieren. Die Straße der Färber hatte sich längst zu einem alternativen Zentrum entwickelt. Die moosbefleckten Wasserräder standen still, und in die alten Färberhäuser waren Antiquariate und Trödelläden, Restaurants und Cafés eingezogen. Am Abend saß ich in einer zum Szenetreffpunkt avancierten ehemaligen Druckerei, auf einer Bank mit zerschlissenen Lederpolstern. Auf ein einsames Dîner in einem vornehmen Restaurant hatte ich keine Lust, lieber sah ich mir selbst in einem mit stumpfen Flecken besprenkelten Wandspiegel beim Essen zu.
Es ist nur ein schmaler Grat, der das Alleinsein von der Einsamkeit trennt. Schon eine flüchtige Geste am Nachbartisch kann genügen, um die eigene Unvollkommenheit zu realisieren, den Schutzpanzer aufzusprengen. Wenn man längere Zeit alleine unterwegs ist, gewöhnt man sich seltsame Verhaltensweisen an. Manche führen Selbstgespräche, andere ritualisieren ihren Tagesablauf und erklären die Monotonie zum engsten Vertrauten. Das Schweigen wird zur Last, die Gedanken erstarren, vor allem abends, wenn niemand da ist, mit dem man Erlebnisse und Erfahrungen teilen kann. Allein der Umstand, sich mehrmals hintereinander ein Restaurant für das Abendessen suchen zu müssen, wird zu einer steten Herausforderung. In den letzten Jahren hatte ich meine imaginären Zwiegespräche immer mit Bettina geführt, hatte ihr meine Sorgen und Nöte gebeichtet, sie an meinem Leben Anteil haben lassen; und dies oft schonungsloser und offener, als wenn sie mir gegenübergesessen hätte.
***
Am nächsten Morgen stand ich früh auf und ging hinunter zur Hotellobby. Ich überlegte, ob ich das Hotelfrühstück verschmähen und mich mit einem Café crème und einem Pain au chocolat in das nächstbeste Straßencafé setzen sollte. Unschlüssig blickte ich in den Frühstücksraum und musterte das Buffet samt Croissants und obligatorischer Orangensaftkaraffe.
»Monsieur«– ich sah mich suchend um, als mir der Mann aus dem Zug freudestrahlend entgegenkam, mich begrüßte und sich als Michel Perras vorstellte. »Ich wollte mich noch einmal bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken.«
»Keine Ursache.«
»Doch, doch, das war sehr nett von Ihnen. Es freut mich, dass Sie auch in diesem Hotel abgestiegen sind«, sagte er und forderte mich auf, mich zu ihm zu setzen.
Obwohl ich zu jenen Menschen gehöre, die eine Zeitungslektüre jeder morgendlichen Kommunikation vorziehen, nahm ich sein Angebot nach einem kurzen Moment des Zögerns an.
Die Fußballeuropameisterschaft bildete den Einstieg zu einer angeregten Konversation, die auch private Themen berührte. Er lobte mein Französisch, was aber bei Weitem nicht so gut war, wie er behauptete, und erzählte, dass er wegen seiner Kreislaufprobleme vorsorglich mit dem Zug gefahren sei. Seine Frage, ob ich in der Provence Urlaub machen wollte, verneinte ich und berichtete ihm von meinem Kalenderauftrag und der Auszeit, die ich mir in Südfrankreich gönnen wollte. Er, so ließ er mich mit leicht gesenkter Stimme wissen, sei in einer familiären Angelegenheit unterwegs. Aus diesem Grund wolle er sich in Avignon mit einem Bekannten treffen.
Dann sah er mich an, sein Oberkörper schwankte fast unmerklich vor und zurück, bevor er sich nach einem kurzen Moment des Zögerns aufraffte, mich zu fragen, ob ich heute Abend Zeit hätte. Ich bejahte, woraufhin er sagte, er würde sich freuen, wenn er mich zum Essen einladen dürfte.
Die Hoteltür öffnete sich. Geblendet blinzelte ich in die warmen Sonnenstrahlen und griff nach meiner Sonnenbrille. Ich hatte alle Zeit der Welt, um durch Avignon zu streifen. Carla weilte in Nîmes, um eine Ausstellung vorzubereiten. Erst in zwei Tagen wollte sie mich auf dem Rückweg nach Raboux auflesen und mitnehmen. Ich ließ mich treiben, lief an protzigen Stadtpalästen und versteckten Kirchen vorbei, deren Simse mit Vogelexkrementen übersät waren.
Zufällig stand ich vor einer breiten Rampe, die mich im Zickzack hinauf zum Rocher des Doms führte. Auf dem mächtigen Felsklotz erstreckten sich die hängenden Gärten, eine ruhige Oase mit Bäumen und Wasserspielen. Ich setzte mich auf eine schattige Bank und ließ mir eine Schale Erdbeeren schmecken. Ich drehte eine Runde durch den kleinen Park und stand vor ein paar Denkmälern und Büsten, die Verstorbene ehrten, deren Namen ich nicht einordnen konnte. Ich rätselte, was Jean Althen, einem 1709 in Armenien als Hovhannès Althounian geborenen Agrarwissenschaftler, zu dieser Ehre verholfen haben mochte. Von einer Aussichtsplattform blickte ich hinunter auf die Dächer der von ihrer Vergangenheit einbalsamierten Stadt.
***
Die Restaurantterrasse war bereits zur Hälfte gefüllt. Wir bekamen einen Platz im hinteren Bereich zugewiesen. Schon am Nachmittag hatte ich mir überlegt, weshalb sich Monsieur Perras mit mir zum Essen verabreden wollte. Dass ich ihm am Bahnhof mit seinem Gepäck geholfen hatte, konnte nicht allein der Grund sein. Ich beobachtete ihn, während ich in der Speisekarte blätterte. Er wirkte ein wenig nervös und erkundigte sich zweimal, ob ich wirklich keinen Aperitif trinken wollte.
Nachdem die Bedienung unsere Bestellung aufgenommen hatte – beide hatten wir uns für das günstigste Menü entschieden–, kam er relativ schnell auf sein Anliegen zu sprechen. »Vor zwei Monaten habe ich ein seltsames Päckchen zugesandt bekommen. Es enthielt ein Konvolut von Briefen und anderen Schriftstücken, ein paar Zeitungsausschnitte sowie ein paar Dutzend alte Schwarz-Weiß-Fotografien. Das Päckchen hatte keinen Absender, ebenso wie der Begleitbrief, in dem mir der anonyme Verfasser mitteilte, er habe die Unterlagen im Nachlass seines Onkels gefunden, der sie wohl seit Kriegsende verwahrt haben müsse. Er glaube und hoffe, die Dokumente fänden so den richtigen Empfänger. Gleichzeitig entschuldigte er sich dafür, dass er seinen Namen und seine Identität nicht preisgeben möchte. Zudem erwähnte er in seinem Brief zwei Namen, die im Zusammenhang mit dem Tod meines Vaters stehen könnten.«
Er machte eine kurze Pause, schenkte mir und sich ein Glas Wasser aus der Karaffe ein und fuhr fort: »Als ich die Fotos sah, war ich wie elektrisiert. Ich ahnte sofort, dass ich damit einen Mosaikstein in Händen hielt, durch den sich das Tor zu meiner eigenen Vergangenheit öffnen könnte. Sie müssen wissen, ich hatte von meinem Vater zuvor nie ein Bild gesehen. Nicht einmal seinen Namen hatte ich gekannt. Aber als ich die Bilder in Händen hielt, wusste ich sofort, dass es sich bei dem Mann, der als Einziger neben meiner Mutter mehrfach auf den Fotos zu sehen war, um meinen Vater handeln musste. Er war noch vor meiner Geburt gestorben. In der Familie wurde das Thema gemieden, denn über Fragen zu meiner Herkunft lag ein nebulöser Schleier– ich wusste weder wo noch wie mein Vater ums Leben gekommen war. So bin ich erst als Halb- und nach dem frühen Tod meiner Mutter als Vollwaise aufgewachsen. Die ganze Schulzeit über hegte ich insgeheim die Hoffnung, mein Vater sei noch am Leben und würde eines Tages kommen und mich zu sich holen.«
Ich wagte nicht, ihn zu unterbrechen, und nickte ihm aufmunternd zu. Nachdenklich begann er weiterzuerzählen: »Im Gegensatz zu meinem Vater besaß ich von meiner Mutter zahlreiche Bilder und Dokumente. Sie war mir vertrauter, wenngleich ich keinerlei Erinnerungen an sie habe. In den Ferien hatte ich oft in den dicken Familienalben mit den sorgfältig eingeklebten Bilderecken geblättert, die mein Großvater in einem Glasschrank seines Arbeitszimmers verwahrte. Aufnahmen von ihrer Kommunion, steife Klassenfotos, aber auch Bilder von Sonntagsausflügen, die die Familie an die Kreideküste von Étretat und nach Chartres zur Kathedrale unternommen hatte.
Aus Erzählungen wusste ich zudem, dass meine Mutter eine Zeit lang in der Provence gelebt haben soll. Kurz vor der Landung der Alliierten hatte sie unverhofft eines Tages abgemagert und ausgezehrt vor der elterlichen Tür gestanden. Mein Großvater soll sie fast nicht erkannt haben. Über die Gründe, weshalb sie zurückgekehrt war, schwieg sie sich hartnäckig aus. Auch später, als sich nicht mehr verheimlichen ließ, dass sie in anderen Umständen war, soll sie kein Wort darüber verloren haben, was sich in den zurückliegenden Monaten ereignet hatte. So weit es ging, vermied sie jeden Kontakt mit der Familie oder Freunden. Die meiste Zeit schloss sie sich in ihr Zimmer ein, nur selten erschien sie zu den Mahlzeiten.
Von ihrer Anwesenheit kündete nur ein hartnäckiges Hüsteln, das sich alsbald als Tuberkulose herausstellte. Ein paar Wochen lag meine Mutter im Krankenhaus von Caen und entging dort durch Zufall einem Bombenangriff, der am 18.Juni 1944 die Tuberkulosestation zerstörte. Sie wurde als geheilt entlassen, doch die Krankheit hatte ihre Kräfte aufgezehrt, und die Schwangerschaft schwächte sie zusätzlich. Man betrachtete es als ein kleines Wunder, dass sie ein gesundes Kind zur Welt brachte. Ich weiß nicht, ob sie sich selbst darüber gefreut hatte, aber ihr Mutterglück währte leider nur kurz: Im darauffolgenden Winter raffte sie eine schwere Grippe dahin.«
Gedankenverloren rückte Monsieur Perras sein Mineralwasserglas ein Stück zur Seite. Bis jetzt hatte er keinen Schluck getrunken, und auch jetzt schien er keinerlei Durst zu verspüren. Mit leiser, getragener Stimme, so dass ich mich ein Stück vorbeugen musste, berichtete er mir, dass er lange gebraucht habe, um den Mantel des Schweigens zu lüften. Gezeichnet mit dem Stigma, ein uneheliches Kind zu sein, wuchs er in einem Klima der Angst und Schuld auf. Den Großteil seiner Schulzeit verbrachte er in einem Klosterinternat in der Bretagne. Beten und Lernen, lautete das Motto, das die eifrigen Mönche mit strengem Regime und Nachdruck predigten. Doch wenn er nachts in den Schlaf zu flüchten versuchte, dachte er nicht an Gott, sondern sehnte sich danach, dass seine Mutter und sein Vater kämen, um ihn in den Arm zu nehmen.
Nur in den Ferien hatte er Kontakt zu seiner Familie, und jedes Mal, wenn er seine Großmutter ansah, hatte er den steten Verdacht, dass sie ihm vorwarf, überhaupt auf die Welt gekommen zu sein. Das Kainsmal der unehelichen Geburt lastete auf ihm. Und obwohl ihn Fragen nach seiner Mutter und seinem Vater quälten, war er zum Stillschweigen verdammt; man schärfte ihm ein, nicht darüber zu sprechen. Um das Ansehen einer Fille-mère, einer ledigen Mutter, war es in der Nachkriegszeit nicht zum Besten bestellt. Hin und wieder gab es von den Nachbarn ein paar spitze Bemerkungen, die sich zu dem unausgesprochenen Vorwurf verdichteten, sein Vater sei ein deutscher Soldat gewesen.
Noch weit über seine Kindheit hinaus litt er darunter, fühlte sich als Sohn eines »Boche« geschmäht und gedemütigt, selbst mit seiner ersten Frau habe er darüber nie geredet. Das mag aus heutiger Sicht verwundern, aber man darf nicht vergessen, dass es kurz nach Kriegsende links des Rheins kaum einen größeren Makel gab, als deutsches Blut in den Adern zu haben. Und niemand sprang ihm zur Seite, um die Vorwürfe zu entkräften.
Die Beziehung zu seiner Großmutter, die sich fortan um ihn kümmerte, war nicht einfach, allzu oft herrschte sie ihn an, ließ ihn ihren Unmut spüren. Wer weiß, hätte sein Großvater, den er als warmen und herzlichen Menschen in Erinnerung hatte, nicht seine schützende Hand über ihn gehalten, vielleicht hätte sie ihn einem Fürsorgeheim überantwortet. Nachdem sein Großvater wenige Wochen nach seiner Kommunion gestorben war, führte seine Großmutter ein strenges Regiment, wenngleich ihr hinsichtlich seiner Zukunft testamentarisch die Hände gebunden waren.
Es schien mir, dass er seine Kindheit, sein früheres Leben wie in einem Bilderbogen an sich vorbeiziehen ließ. Hin und wieder stockte er kurz, dann erzählte er eindringlich weiter: »Lange Zeit hatte ich es vermieden, Erkundigungen über meine Eltern einzuholen. Es mag seltsam klingen, aber allein der Gedanke daran verletzte mich. Jegliche Fragen blockte ich ab und fühlte mich so, als hätte mich der Zufall ins Leben geworfen. Erst später, als ich längst erwachsen war und als Anwalt in Paris arbeitete, habe ich begonnen, nach meiner Herkunft zu forschen. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir bewusst, wie sehr mich diese Ungewissheit bedrückte und an meiner Seele nagte. Doch meine Bemühungen blieben ergebnislos. Zu dürftig waren die Fakten.
In meiner Geburtsurkunde steht lapidar: ›Vater unbekannt‹. Ansonsten gab es nur Gerüchte und Heucheleien. Trotz wiederholten Nachfragens hatte mir meine Großmutter versichert, sie wisse nicht, wer mein Vater sei. Sie habe ihn niemals gesehen und besitze daher keinerlei Informationen über ihn. Ich sträubte mich gegen diese Vorstellung und wollte ihren Beteuerungen keinen Glauben schenken. Ich misstraute ihr und war davon überzeugt, dass sie mir, aus welchen Beweggründen auch immer, etwas verheimlichte.«
Das Essen war vollkommen in den Hintergrund gerückt. Gebannt lauschte ich seinen Ausführungen. »Jahrzehnte später kam dieses Päckchen, das alles veränderte. Als ich es öffnete und den Inhalt vor mir auf dem Tisch ausbreitete, begann sich der Boden unter meinen Füßen zu drehen. Wie ein gewaltiger Sog öffnete sich das Tor zu meiner Vergangenheit. Ich war hin und her gerissen zwischen Euphorie und Verbitterung. Ich konnte nicht verstehen, warum mich meine Familie belogen und mir die Lebensgeschichte meiner Eltern vorenthalten hatte. Können Sie sich vorstellen, wie man sich fühlt, wenn sich die eigene Vergangenheit vom einen auf den anderen Augenblick als ein Gebilde aus Lügen und Halbwahrheiten erweist und man mühsam um die eigene Identität ringen muss?
Tagelang war ich wie paralysiert. Dann trieb mich der Wunsch an, die Wahrheit zu erfahren, den wenigen Hinweisen zu folgen, um mehr über meinen Vater und seinen frühen Tod zu erfahren. Ich wusste weder, wie und wo sich meine Eltern kennengelernt hatten, noch, welche Beziehung sie geführt hatten.
Jahrzehntelang hatte ich mich gefragt, wer mein Vater war. Als ich dann seinen Vornamen erfuhr und erstmals Bilder von ihm sah, war ich überwältigt, suchte nach Ähnlichkeiten, versuchte mich wiederzuerkennen. Ich wollte mir vorstellen können, was für ein Mensch mein Vater gewesen war, was er gefühlt und gedacht hatte. Ich hatte die vorhandenen Bruchstücke zusammengesetzt, trotzdem blieben immer noch Fragen offen. Und so beschloss ich, in die Provence zu fahren und Licht in das Dunkel meiner Vergangenheit zu bringen.«
Es war spät geworden, als wir uns schweigend auf den Rückweg zum Hotel machten. Die Rezeption war noch besetzt, der Nachtportier nickte uns freundlich zu. Wir gingen zum Aufzug und fuhren mit dem Lift hinauf zu unseren Zimmern, die sich zufälligerweise auf der gleichen Etage befanden.
***
Der strahlend blaue Himmel kündigte einen herrlichen Sommertag an. Ich spazierte hinüber zur Kartause von Villeneuve an das andere Ufer der Rhône, die sich träge wie ein breites silbernes Band gen Süden schob, in der Ferne glänzend, von Nahem matt und brackig. Ein Ehepaar war mit seinem Hund unterwegs, der in seiner verspielten Laune einen Lastkahn aus voller Kehle anbellte. In Villeneuve-lès-Avignon war Markttag, die Stände säumten einen breiten Boulevard. Ich hatte den Trubel und die Menschenmassen hinter mir gelassen und genoss nun die Stille des verschachtelten Klosterkomplexes, der mir mit seinen drei Kreuzgängen fast wie eine kleine Stadt erschien.
Auf dem Rückweg trottete ich an einer verfallenen Einfriedung entlang, die hier und da notdürftig mit Draht geflickt war. Ich hielt inne und erspähte einen verwilderten Park. Am anderen Ende ragte ein doppelstöckiges Herrenhaus mit Türmchen auf, dessen Fenster mit Querlatten vernagelt waren. Die Bausubstanz schien unangetastet; nur die zugehörige Lebensart war verschwunden, als hätte man den Teppich darunter weggezogen. Der regenbereite Himmel, durch dessen Wolkendecke noch ab und an ein paar Sonnenstrahlen brachen, beschleunigte meine Schritte– es sollte mein einziger Ausflug über die Stadtgrenzen hinaus bleiben.
Zurück im Hotel schlug ich die blau-gelb gestreifte Tagesdecke zurück und knüllte die Kopfrolle zusammen, da es kein Kissen gab. Im Dämmerlicht der Holzjalousien schlief ich schon bald erschöpft auf dem breiten Bett ein. Es war seit Jahren das erste Mal, dass ich einen Mittagsschlaf machte. Ich schlief tief und traumlos.
Ein sachtes Klopfen an der Tür weckte mich.
»Monsieur?«
Ich brauchte zwei Sekunden, um mich zu orientieren, dann klopfte es erneut.
»Monsieur– sind Sie da?«, hörte ich jemanden undeutlich fragen.
»Oui!« Ich stand auf, streifte mir meine Jeans über und öffnete die Tür.
Zu meiner Verwunderung stand Monsieur Perras vor mir.
»Entschuldigen Sie bitte. Darf ich Sie kurz stören? Ich weiß, ich bin wahrscheinlich ein wenig aufdringlich, aber ich möchte Sie um einen kleinen Gefallen bitten.«
Ich bat ihn mit einer einladenden Geste herein. Als er in meinem Zimmer stand, bemerkte ich, dass er eine zusammengeschnürte Mappe unter dem Arm hielt. Er wirkte ein bisschen hektisch und nervös.
Ohne große Umschweife fragte er mich: »Wären Sie so nett, dieses Päckchen für mich zu verwahren, bis ich es mir morgen wieder abhole? Ich möchte es an einem sicheren Ort wissen.«
Verwundert blickte ich auf das zusammengeschnürte Paket.
»Selbstverständlich, warum nicht?«, sagte ich in einem ungezwungenen Ton.
»Seien Sie unbesorgt, ich will Ihnen keine Drogen unterschieben«, witzelte er. »Wir kennen uns zwar kaum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen vertrauen kann und diese Dokumente bei Ihnen gut aufgehoben sind.«
Ich blickte ihn aufmunternd an, und er erzählte mir von dem bevorstehenden Treffen mit einem Bekannten und erging sich in ein paar vagen Andeutungen von einem Verdachtsmoment, dessen Hintergrund ich nicht recht einordnen konnte. Etwas schien ihn aufzuwühlen, aber vielleicht täuschte ich mich auch. Schließlich ergriff er meine Hand, drückte sie fest und verabschiedete sich von mir.
Nachdenklich und etwas irritiert schloss ich die Tür und legte das Päckchen in die Schreibtischschublade.
Inzwischen kannte ich Avignon bis in den letzten Winkel hinein, es gab kaum eine Gasse, durch die ich nicht schon gelaufen war. Selbst eine Erkundung der Stadtmauer hatte gestern auf meinem Programm gestanden, obwohl mich parkende Autos und Straßenkreuzungen auf ganzer Strecke gängelten. Erst wollte ich mir nur einen kleinen Abschnitt der Stadtmauer ansehen, doch dann bin ich auf dem zugeschütteten Graben einfach weitergelaufen, immer weiter, getrieben von dem seltsamen Verlangen, die physische Präsenz dieses mächtigen Bauwerks einzuatmen, dessen Bedeutung mit dem Mauerschutt der einstigen Stadttore hinweggekarrt worden war.
***
Der Tag zog sich in die Länge. Ich hatte das Hotelzimmer bereits am späten Vormittag räumen müssen. Seither lief ich durch Avignon, in dessen Straßen es Stunde um Stunde schwüler wurde. Bunte Plakate kündeten vom Beginn des Festivals. Obwohl es noch zwei Wochen bis zur Eröffnung waren, hatte ich den Eindruck, dass sich die Stadt füllte, spürbar lebhafter wurde. Als ich an einem der vielen kleinen Theater vorbeikam, steckte ich ein Programm ein, wer weiß, vielleicht würde ich ja zusammen mit Carla einen abendlichen Ausflug zum Festival unternehmen.
Wir waren am frühen Nachmittag in einem Straßencafé auf der Place Crillon verabredet. Ich blickte zum wiederholten Mal auf die Uhr und musterte ungeduldig die Passanten, dann schlug ich meine Beine übereinander und vertiefte mich wieder in die »L’Équipe«, deren Berichte und Analysen hauptsächlich um die Fußballeuropameisterschaft kreisten. Einzig der in Kürze beginnenden Tour de France waren noch zwei Doppelseiten samt Etappenplan gewidmet. Lance Armstrong drohte auch dieses Jahr wieder keine ernsthafte Konkurrenz im Kampf um das Gelbe Trikot. Ich trank meinen Café noir in kleinen, langsamen Schlucken.
»Hallo, Lavendelfotograf!«
Carlas ironische Begrüßung riss mich aus meiner Zeitungslektüre. Wir umarmten uns herzlich. Carla – sie trug ihre schwarzen Haare jetzt kurz geschnitten, was ihr eine angenehm maskuline Note verlieh– brachte eine flüchtige Entschuldigung hervor, stöhnte aber noch im gleichen Atemzug über den Stau, in den sie auf der Autobahn geraten war. Aufgedreht von dem Treffen mit dem Museumsdirektor des Carré d’Art – in knapp zwei Wochen würde ihre Ausstellung »Public Sleeping« in Nîmes eröffnet–, ließ sie mich kaum zu Wort kommen. Ein Gewitter braute sich zusammen. Wir zahlten und gingen zu ihrem Auto, dann fuhren wir noch kurz zu meinem Hotel, um mein Gepäck zu holen.
Kaum hatten wir Avignon verlassen, verdunkelte sich der Himmel zusehends, Blitze zuckten in schneller Folge in das anschwellende Grollen hinein. Wir beeilten uns, das Verdeck ihres Cabrios zu schließen. Die ersten dicken Tropfen leuchteten schon auf den schwarzen Ledersitzen. Noch bevor wir die Stadtmauern verlassen hatten, prasselte ein heftiger Regenschauer auf uns herab. Der Scheibenwischer ackerte mühsam; seitwärts krochen die Regentropfen zu fahrigen Schlieren verzerrt über die beschlagenen Scheiben, während Häuser und Felder unter den tief hängenden Wolken schemenhaft vorüberjagten.
Schweigend steuerte Carla durch die Regenfront. Die schlechten Straßenverhältnisse erforderten ihre volle Konzentration, während ich die Zeit nutzte, meinen Gedanken nachzuhängen. Ich konnte mir keinen rechten Reim darauf machen, wie ich die Vorkommnisse der letzten Tage einzuschätzen hatte. Vor allem meine letzten Stunden in Avignon waren recht turbulent verlaufen.
Den letzten Abend hatte ich in einem Restaurant hinter dem Rocher des Doms verbracht, das ich durch Zufall bei meinen Spaziergängen entdeckt hatte. Ein Szenetreff mit angegliedertem Kino. Obwohl ich allein war, ließ ich mich von der lockeren Atmosphäre anstecken und flirtete ein wenig mit einer dunkelhaarigen Frau, die zu einer Gruppe am Nachbartisch gehörte. Als ich leicht angetrunken ins Hotel zurückkehrte, stand die Tür zu Monsieur Perras’ Zimmer einen Spalt breit offen, so dass ein schmaler Lichtstreifen in den dunklen Flur fiel. Da er sich bisher nicht mehr bei mir gemeldet hatte, wollte ich ihn fragen, ob ich ihm seine Unterlagen zurückbringen kann. Ich klopfte mehrmals, dann drückte ich die Tür sachte auf. Eine Wandleuchte brannte, doch zu meiner Verwunderung war das Zimmer leer, das Bett zerwühlt, der Mülleimer umgeworfen, aber keine Spur von Monsieur Perras. Weder sein Koffer noch irgendwelche Kleidungstücke erinnerten an seine Anwesenheit. Einzig eine zerfledderte Zeitung auf dem Nachttisch und zwei leere Plastikwasserflaschen zeugten davon, dass hier jemand gewohnt haben musste. Zur Sicherheit warf ich noch einen Blick ins Badezimmer, aber auch das Bad war bis auf zwei über den Boden verstreute Handtücher leer. Ich wunderte mich, warum Monsieur Perras gegangen war, ohne dass er seine Dokumente von mir zurückgefordert hatte. Dann zog ich die Tür ins Schloss und ging in mein Zimmer. Noch lange stand ich am Fenster und starrte in die dunkle Nacht.
Nach dem Aufstehen erkundigte ich mich an der Rezeption, doch auch das Hotelpersonal konnte mir nicht weiterhelfen. Niemand wusste, wieso und wann Monsieur Perras abgereist war. Da das Zimmer bereits im Voraus per Kreditkarte bezahlt worden war, bestand kein Interesse, irgendwelche Nachforschungen zu betreiben. Als ich mein Gepäck abholte, unternahm ich einen letzten vergeblichen Versuch, Erkundungen über sein Verbleiben einzuholen, und wurde von der Rezeptionistin mit einem charmanten »Je suis désolée« vertröstet.
DREI
Carla gehört zu meinen ältesten Freundinnen. Mit unserer Clique waren wir früher nächtelang durch die Münchener Szenekneipen gezogen, bei schönem Wetter hatten wir die Nachmittage im Englischen Garten verbracht, im Winter gingen wir oft zum Skilaufen. Nach Abschluss der Fotoschule hatte Carla anfangs wenige Jahre für ein – inzwischen legendäres, längst eingestelltes– Lifestylemagazin gearbeitet, sich dann aber zunehmend vom Tagesgeschäft zurückgezogen und eigene Projekte verfolgt, zumeist angesiedelt zwischen Kunst- und Reportagefotografie. Mit ihrem Bildband »Spuren der Ohnmacht«, in dem sie Menschen in Ostdeutschland porträtierte, die durch den Beginn und den Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit psychisch und physisch gezeichnet waren, hatte ihre Arbeit auch überregional Anerkennung gefunden. Die Kritik war begeistert von der subtilen Art und Weise, wie sie den Verlust des sozialen Status und das schwindende Selbstbewusstsein einfing, die sich unübersehbar in der Körperhaltung und Mimik der Porträtierten ausdrückten. Mit der Überschrift »Die hängenden Schultern der Wiedervereinigung« bejubelte die »Süddeutsche Zeitung« das Buch im Aufmacher ihres Feuilletons.
Doch dann wurde Carla durch private Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen: Erst starb ihre Mutter überraschend an Leukämie, wenig später verunglückte ihr Vater beim Gleitschirmfliegen. Vermutungen, er hätte bewusst den Tod gesucht, kursierten. Ob Unfall oder Selbstmord– die Frage konnte nie geklärt werden. Finanziell abgesichert – ihr Vater war ein erfolgreicher Unternehmensberater gewesen– verreiste Carla für längere Zeit, bevor sie mir eines Tages unverhofft schrieb, sie hätte einen alten Bauernhof in der Provence gekauft und werde fortan die meiste Zeit des Jahres in Südfrankreich leben. Ich wusste, dass sie als Kind fast jedes Jahr die Ferien mit ihren Eltern in der Provence verbracht hatte, und vermutete, sie wollte so ihre Erinnerungen nähren.
In der Ferne donnerte es noch immer dumpf, als wir in Raboux ankamen. Das Gewitter war ungewöhnlich heftig gewesen; die Straßen glänzten rotbraun von der feuchten, aus den Weinbergen gespülten Erde. Carlas Haus lag ein paar hundert Meter abseits vom Dorf, ein ungeteerter Feldweg führte in einem weiten Bogen den sanft ansteigenden Hang empor. Kaum waren wir von der Straße abgezweigt, spritzte das Wasser in einem breiten Schwall aus den knöcheltiefen Pfützen. Zwei Hunde stürmten vor Freude kläffend neben unserem Auto her, bis es mit einem Knirschen in der mit Kies bedeckten Einfahrt hielt.
»Wenn du möchtest, kannst du wie das letzte Mal im roten Zimmer wohnen. Ich habe dir ein paar Handtücher hingelegt, das Bett musst du allerdings noch beziehen. Ich versorge jetzt noch schnell die Hunde. Aber du kommst sicher zurecht?«, fragte Carla und verschwand um die Ecke, ohne meine Antwort abzuwarten. Ich nickte ihr stumm hinterher, ging auf die Terrasse und ließ meinen Blick über den breiten Talkessel schweifen, der nach Westen hin von einem karstigen Gebirgszug begrenzt ist, hinter dem die fahle Kuppe des Mont Ventoux am Horizont aufragt. Jedes Mal wenn ich zu Besuch in Raboux war, durchströmte mich ein tiefes Glücksgefühl. Die Erinnerungen an die feuchtfröhlichen Abende, die ich mit Carla und anderen Gästen an dem schmiedeeisernen Tisch verbracht hatte, stimmten mich wohlig auf die kommenden Wochen ein. Ich begann mich langsam auf meine Lavendelfelder zu freuen.
Das »rote Zimmer« war das schönste der drei Zimmer, die Carla ihren Gästen zur Verfügung stellte. Es lag im Obergeschoss des an einen Hang gekauerten Hauses und verfügte dadurch sogar über einen separaten Eingang und ein eigenes Bad mit einer abgemauerten Dusche. Es war ein Eckzimmer, bot genügend Platz und verbreitete durch zwei breite bodentiefe Fenster selbst an tristen Wintertagen eine heitere Atmosphäre. Vom Schreibtisch aus konnte man die Dächer von Raboux sehen, die sich um den Kirchturm scharten wie eine Herde um den Hirten. »Rot« gestrichen war nur eine einzige Wand, in deren Mitte ein breites Metallbett stand, dessen leicht gebogene Fußsäulen, gekrönt von versilberten Dekorkugeln, dominierend in den Raum ragten.