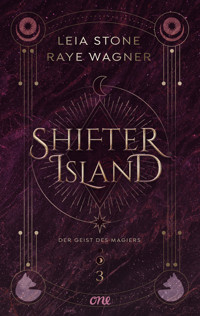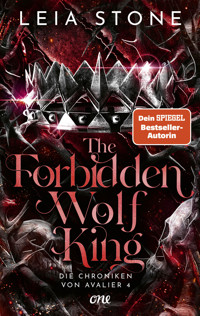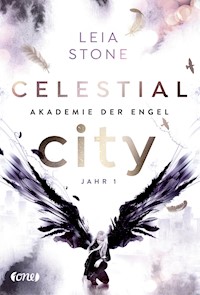9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die goldene Stadt
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt einer neuen Reihe von Bestsellerautorin Leia Stone!
Fallon Bane ist verflucht. Bei jeder Berührung erleidet sie unerträgliche Schmerzen, und selbst ihren Vater wird sie niemals umarmen können. Doch als dieser erkrankt, will Fallon alles dafür tun, um ihn zu retten. Sie reist in die goldene Stadt und trifft auf Heiler Ariyon Madden, der einwilligt, ihr zu helfen. Doch als er sie versehentlich berührt, ändert sich für Fallon alles: Der erwartete Schmerz bleibt aus. Zum ersten Mal träumt sie von einer besseren Zukunft. Aber dann flieht Ariyon vor ihr, und kurz darauf wird sie an eine magische Akademie verschleppt. Fallon wird hineingezogen in einen Strudel aus dunklen Geheimnissen, der nicht nur sie, sondern die gesamte Welt gefährden könnte ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Weitere Titel der Autorin
Titel
Leser:innenhinweis
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Triggerwarnung
Hat es dir gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Weitere Titel der Autorin:
Celestial City – Akademie der Engel: Jahr 1
Celestial City – Akademie der Engel: Jahr 2
Celestial City – Akademie der Engel: Jahr 3
Celestial City – Akademie der Engel: Jahr 3,5
Celestial City – Akademie der Engel: Jahr 4
The Last Dragon King – Die Chroniken von Avalier 1
The Broken Elf King – Die Chroniken von Avalier 2
The Ruthless Fae King – Die Chroniken von Avalier 3
The Forbidden Wolf King – Die Chroniken von Avalier 4
Shifter Island 1 – Die Akademie der Wölfe
Shifter Island 2 – Der Wächter der Seelen
Shifter Island 2,5 – Der Alphakönig
Shifter Island 3 – Der Geist des Magiers
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Michael Krug
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr genauere Angaben hier.
ACHTUNG: Sie enthalten Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer Team vom ONE-Verlag
Für meine Nichte Avery. Es spielt keine Rolle,wie schnell du lesen kannst.Du kannst trotzdemdie Mächtigste im Raum sein.
1
»Alles Gute zum Geburtstag!«, riefen Sorrel und ich unisono, als wir unter dem kleinen Küchentisch hervorsprangen, unter dem wir uns versteckt hatten.
Mein Vater hatte unsere bescheidene Hütte gerade nach einem langen Arbeitstag betreten. Obwohl er erschöpft und ein wenig gerötet wirkte, trat ein Grinsen in seine Züge.
Ich ergriff die etwas schief geratene Torte, die ich gebacken hatte, überquerte damit den Erdboden unserer Hütte und überreichte sie ihm.
»Mandel-Orange?«, fragte er freudig.
Ich nickte. »Deine Lieblingstorte. Mit einer Glasur aus Honig von Frau Lancasters Bienen.«
Ich mochte als Bäckerin nicht so gut sein wie mein Vater, trotzdem konnte ich mich in einer Küche behaupten.
Meine Nachbarin und liebe Freundin Sorrel nahm meinem Vater die Arbeitstasche voller Werkzeug ab und stellte sie auf den Boden, damit er sich mit uns an den Tisch setzen konnte.
Er bewegte sich dabei etwas träge, und ich runzelte die Stirn. »Hast du immer noch dieses Fieber?«
Vor einigen Tagen hatte er sich am Fluss einen Kratzer zugezogen, der sich entzündet hatte.
Mein Vater nickte, bevor er den Blick auf Sorrel richtete. »Ich habe das Neem-Öl aufgetragen, das du mir heute Morgen gegeben hast.«
Sorrel war unsere örtliche Kräuterkundlerin. Ihr Wissen hatte sie sich selbst angeeignet. Was ihr an Heilmagie fehlte, wog sie durch Köpfchen auf.
»Was denn, bist du jetzt auf einmal siebzig?«, scherzte ich.
Er schmunzelte. »Vierundvierzig, aber ich gehe auf die siebzig zu.« Mein Vater rollte die Schultern. Er hatte Dreck unter den Fingernägeln und sogar oben an den spitzen Ohren. Da er zu den wichtigsten Arbeitern unseres Dorfs gehörte, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass er je sauber nach Hause gekommen war. Er galt als ungemein fleißig, worauf ich stolz war.
»Ist es euch gelungen, den Damm in Ordnung zu bringen?«, fragte Sorrel, während sie ihm ein Stück von der Torte abschnitt und servierte.
Er nickte. »Wir haben ihn geflickt. Der Stausee sollte halten.«
Unser bescheidenes Dorf namens Isariah lag drei Stunden Fußmarsch von der Goldenen Stadt entfernt, dem Sitz der mächtigsten Fae im Reich. Während es dort Wasserleitungen und sonstige Annehmlichkeiten in Hülle und Fülle gab, mussten wir mit dem auskommen, was wir selbst konnten. Wir hatten den Fluss der toten Schlangen aufgestaut, der in den Heidelbeersee mündete, benannt nach den Hunderten wilden Heidelbeersträuchern, die um ihn herum wuchsen. Der Fluss der toten Schlangen wiederum hieß so, weil er ohne den Damm nur ein besserer Bach gewesen wäre und kaum mehr als zehn Personen hätte versorgen können.
Der See und der Damm waren entscheidend für unser Überleben – wir tranken das Wasser nicht nur und wuschen uns damit, sondern nutzten es auch für unsere Felder. Wenn wir es verlieren würden, würde sich niemand darum scheren, dass eine Handvoll verbannter Fae ohne Magie verdurstete und verhungerte.
Als Nächstes gab Sorrel mir ein Stück, und ich überlegte, ob ich die ellenbogenlangen Handschuhe zum Essen des Kuchens ablegen sollte. Doch um einen Unfall zu vermeiden, hielt ich es für besser, sie anzubehalten. Ich wollte meinem Vater nicht den Ehrentag vermiesen, indem ich mich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte.
»Fallon, was ist deine liebste Erinnerung mit deinem Pa?«, fragte Sorrel und zeigte auf mich, während sie sich über das eigene Tortenstück hermachte.
Grinsend schaute ich zu dem Mann, der mich von Kind auf großgezogen hatte. »Da war ich zwölf«, antwortete ich. »Damals bin ich weinend aus der Schule heimgekommen, weil die anderen Kinder mich ständig angefasst hatten, um meinen Fluch auszulösen.«
Mein Vater streckte die Hand aus und legte sie auf meinen behandschuhten Arm. Dabei achtete er darauf, keine nackte Haut zu berühren. »An den Tag erinnere ich mich gut.«
Mein Herz zog sich zusammen, als ich daran zurückdachte, wie schmerzlich er sowohl körperlich als auch emotional gewesen war. So ungerecht es sein mochte, ich war mit einem Fluch geboren worden, über den ich keine Kontrolle hatte, und musste mich damit durchs Leben schleppen. »Damals hast du etwas gesagt, das mir im Gedächtnis geblieben ist«, sagte ich zu meinem Vater. »Du hast gemeint, ich könnte nicht beeinflussen, wie die Leute mich behandeln, sehr wohl aber, wie ich darauf reagiere. Das würde ausmachen, wer ich bin.«
Aus meiner Sicht war es ein Wendepunkt in meinem Leben gewesen. Ich hätte einen dunklen Weg einschlagen, alle Welt hassen und verbittert über mein Los sein können. Dank meines Vaters hatte ich stattdessen entschieden, mich darauf zu konzentrieren, was ich kontrollieren konnte, und auf die Freuden in meinem Dasein.
Sorrel räusperte sich. »Wenn ich mich recht erinnere, hat er dir an dem Tag auch deinen Dolch geschenkt und dich ermutigt, dich bei Bedarf zu verteidigen.« Sie zeigte auf meine Hüfte, wo ich das Messer normalerweise trug.
Wir alle brachen in Gelächter aus, und mein Vater nickte. »Tja, die Moral von der Geschichte lautet: Sei freundlich zu anderen, aber verteidige dich, wenn es sein muss.«
»Herr Brookshire, Sie sind dran. Ihre liebste Erinnerung mit Fallon«, wandte sich Sorrel an meinen Vater. In Isariah galt es als Tradition, einander an Geburtstagen und Feiertagen Geschichten zu erzählen, wenn man sich keine Geschenke leisten konnte.
Er lehnte sich zurück und bedachte mich mit einem liebevollen Blick. »Das ist einfach. Der Tag, an dem ich sie zum ersten Mal gesehen habe.«
Bei den Worten stieg mir ein Kloß in den Hals, und ich dachte daran zurück, wie man mich vor siebzehn Jahren mitten in der Nacht nach Isariah gebracht hatte. Man hatte mich in einem kleinen Korb am Eingangstor zurückgelassen, die Nabelschnur noch an meinem Körper und hastig mit einem Knoten abgebunden.
In dem Korb steckte in den Falten meiner Decke ein Zettel mit nur drei Worten darauf.
Nicht anfassen. Verflucht.
Verständlicherweise sorgte das für Aufruhr unter den Bewohnern meines Dorfs. Was für ein Fluch? Tödlich für jeden, der mich hochhob? Ein Landfluch, der ihre Ernte ruinieren würde? Ein Seuchenfluch, der wie ein Lauffeuer um sich greifen und alle vernichten würde?
Niemand wollte mich.
Ich weinte mich in dem Korb durch die Nacht, bis schließlich in den frühen Morgenstunden ein junger Mann Mitte zwanzig auf die Straße herauskam. Im Jahr davor hatte er seine Frau durch Lungenversagen verloren, und sie hatten keine Kinder gehabt. Die beiden hatten sich zwar welche gewünscht, doch sie hatte keine bekommen können. Ohne zu zögern, hob er meinen Korb auf. Als er nicht wie vom Blitz erschlagen starb, kamen die Leute näher, um mich zu betrachten.
»Sie ist doch bloß ein unschuldiges Kind«, meinte der Mann. »Ich kümmere mich, ganz gleich, was für ein Fluch auf ihr lasten mag.«
Und so hatte sich mein Vater an mich gebunden. Er allein hatte sich meiner angenommen, als es niemand sonst hatte tun wollen, weil sich alle zu sehr davor gefürchtet hatten, sich mir auch nur zu nähern.
Rasch hatte er herausgefunden, dass »nicht anfassen« wortwörtlich bedeutete, nicht meine Haut zu berühren. Was anderen Freude bereitete, verursachte mir schier unerträgliche Schmerzen. Schon der geringste Kontakt mit meiner Haut fühlte sich für mich an, als würde ich vom Blitz getroffen. Wie man sich wohl vorstellen kann, gestaltete es sich nahezu unmöglich, den schmutzigen Lendenwickel eines Säuglings berührungslos zu wechseln. Die ersten fünf Jahre meines Lebens hatte mein Vater bis zu den Ellbogen reichende Handschuhe getragen. So gern er mir den Fluch abnehmen wollte, er blieb allein meine Bürde.
»Das war auch mein liebster Tag«, erwiderte ich lächelnd. »Obwohl ich mich nicht daran erinnere.«
Danach gaben Sorrel und ich Erinnerungen aus unserer Kindheit zum Besten, über die wir so ausgelassen lachten, dass wir uns am Ende die Bäuche hielten.
Irgendwann schaute ich zu meinem Vater und bemerkte Schweißperlen auf seiner Stirn. Sein zuvor gerötetes Gesicht war blass geworden. »Pa, du siehst nicht gut aus. Willst du baden und dich dann hinlegen?«
Er schenkte mir ein verhaltenes Lächeln und tätschelte meinen behandschuhten Arm. »Du passt immer auf mich auf.« Als er aufstand, zuckte er zusammen und hielt sich die Seite. Sorrel und ich wechselten einen besorgten Blick. Mein Vater packte die Rückenlehne des Stuhls, umklammerte sie und schwankte.
»Pa.« Das Herz schlug mir bis in den Hals, als auch ich mich erhob.
Sorrel bewegte sich schneller, eilte von ihrem Stuhl zu meinem aschfahlen, wächsern wirkenden Vater, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.
Entsetzt beobachtete ich, wie er abermals schwankte, bevor er wie ein Sack Ziegelsteine zu Boden ging. Sein Körper schlug mit einem dumpfen Laut auf. Mit einem Aufschrei hastete ich an seine Seite.
»Sorrel!«, rief ich panisch. Verschwommen nahm ich wahr, wie sie sich seinen Kopf auf den Schoß bettete, während ich seine Beine nach vorn zog, bis er ausgestreckt auf dem Rücken lag.
Während ich rastlos über den Erdboden unserer Hütte auf und ab lief, untersuchte Sorrel ihn.
»Die Wunde ist immer noch entzündet. Sie riecht wie verfaulter Fisch.« Stirnrunzelnd tastete sie den Bauch meines Vaters ab.
»Der winzige Kratzer?« Ich beugte mich über sie und richtete den Blick auf eine kleine Verletzung in der Nähe seines Bauchnabels. Mir gefror das Blut in den Adern. Zornig gerötete Linien erstreckten sich von dort verästelt die Brust hinauf, doch die Wunde selbst war geradezu lächerlich. Er hatte sich unlängst am Fluss an einem Ast aufgeschürft. Ich war dabei gewesen.
»Das hier?« Ich runzelte die Stirn und spürte, wie sich Unbehagen gleich einem Schatten über mich ausbreitete.
Sorrel schaute mit Grauen in den Augen zu mir auf. »Fallon, so etwas habe ich schon mal gesehen. Rote, zum Herzen verlaufende Linien bedeuten den Tod in vierundzwanzig Stunden.« Sie verfolgte die Linien nach, die noch auf halbem Weg dorthin endeten, und mir stockte der Atem.
Tod?
Nein.
»Es ... war bloß ein Ast. Ein dummer kleiner Ast.« Mir stieg ein Schluchzen in die Kehle, als Sorrel den Bauch meines Vaters mit einem Stoffstreifen bedeckte. Dann senkte sie seinen Kopf behutsam zu Boden, richtete sich auf und kam zu mir.
»Ich weiß, wie viel er dir bedeutet«, sagte sie sanft.
Oh du mein Licht. Sie sah mich an, als stünde ich kurz davor, meinen Vater zu verlieren. Noch dazu an seinem Geburtstag.
»Er ist alles, was ich habe«, murmelte ich. Bei der Vorstellung, ohne ihn zu sein, fühlte es sich an, als wollte mein Herz aus der Brust ausbrechen.
»Sollten wir mehr Neem-Öl draufmachen? Oder soll ich Kräuter holen gehen? Gib mir eine Liste, dann ...«
»Fallon.« Sorrel ergriff meine behandschuhte Hand. »Das übersteigt meine Möglichkeiten. Wenn ich ihm helfen könnte, würde ich es, das weißt du. Aber ...«
»Nein«, stieß ich knurrend hervor und stählte mich. Ich würde nicht in eine Schockstarre verfallen. Er brauchte mich. »Damit finde ich mich nicht ab. Was brauchst du, um ihn zu retten?« Mit entschlossener Miene sah ich Sorrel an.
Sie schnaubte. »Eine Heilerin oder einen Heiler aus der Goldenen Stadt oder eine keimtötende Tinktur aus einer Apotheke.«
Ich wusste, dass sie es sarkastisch meinte. Aber sie hatte keine Ahnung, wozu ich bereit war, um den Mann zu retten, der mich anständig behandelt hatte, als es niemand sonst tun wollte.
»In Ordnung«, erwiderte ich, ließ ihre Hand los und durchquerte die Küche zu meiner kleinen Kammer. Das Schlafzeug auf dem Boden lag unordentlich da. Ich hatte es nicht gemacht, wie mein Vater es wollte, was ich in dem Moment bedauerte. Ich sollte eine gehorsamere Tochter sein.
Rasch sank ich zu Boden, strich die beiden weichen Decken glatt und faltete die Ecken, wie er es mochte. Danach begab ich mich zu meiner kleinen Truhe.
»Äh, Fallon ...«, ertönte Sorrels Stimme von der Tür, als ich meinen Dolch daraus hervorholte und ihn in meinen Stiefel schob. »Was hast du vor?«, fragte sie.
Sorrel war eine gute Freundin. Sie machte sich nie über mein Gebrechen lustig und achtete immer penibel darauf, mich nicht zu berühren. Als wir klein gewesen waren, hatte sie Steine nach Kindern geworfen, die mich gehänselt hatten. Dafür hatten sie sich an den Armen berührt und so getan, als würden sie weinen und zucken wie ich.
Meine Freundin war ein seltenes Juwel. Allerdings hielt sie sich auch streng an Regeln. Als magielose Verstoßene der Goldenen Stadt waren die Bewohner von Isariah stark benachteiligt. Sorrel dachte, sie könnte das wettmachen, indem sie lesen gelernt hatte und Kräuterkundlerin werden wollte. Sie versuchte, ihr Ansehen durch Wissen zu steigern. Dafür respektierte ich sie, doch sie würde nicht gutheißen, was ich vorhatte. Tatsächlich könnte sie mich davon abhalten wollen. Deshalb wäre es wohl besser, ihr möglichst wenig zu verraten.
Ich richtete mich auf und schlüpfte in meinen schweren, grauen, sechs Zoll zu kurzen und entschieden zu löchrigen Mantel. Während ich als Nächstes die dicken, ellbogenlangen Wildlederhandschuhe anzog, lief Sorrel an der Tür auf und ab.
»Fallon, das war ein Witz! Du kannst nicht einfach los und einen Heiler aus der Goldenen Stadt entführen.«
Ich nickte. »Stimmt. Zuerst beschaffe ich die Tinktur.«
Ihre Augen wurden groß. »Die einzigen Apotheken mit keimtötenden Tinkturen auf Lager gibt es in der Goldenen Stadt.«
Wieder nickte ich knapp, bevor ich mich vor sie stellte. »Sorg dafür, dass er am Leben bleibt, bis ich zurück bin. Wenn er stirbt, verzeihe ich dir das nie.«
Ihre Züge fielen in sich zusammen. Ich wusste, wie unfair es war, sie so unter Druck zu setzen, doch ich war verzweifelt.
»Das kann nicht dein Ernst sein. Wir sind verbannt. Auf unrechtmäßiges Betreten der Goldenen Stadt als Magieloser steht die Todesstrafe.«
Tränen traten mir in die Augen und ließen meine Sicht verschwimmen, ehe sie mir über die Wangen kullerten. »Wenn er stirbt, bin ich innerlich sowieso tot. Also können die mich ruhig umbringen«, erwiderte ich. »Und jetzt geh bitte aus dem Weg.«
Sie wusste, dass ich mich nicht körperlich gegen sie zur Wehr setzen könnte. Sie bräuchte nur die Hand auszustrecken und irgendwo meine nackte Haut zu berühren, schon würden mich die Qualen in die Knie zwingen.
Meine Freundin schluckte schwer. »Du bist ein Sturkopf.« In ihrer Stimme schwang ein resignierter Unterton mit. Da sie zwei Jahre älter war als ich, betrachtete ich sie gleichsam als große Schwester. Sie lebte mit ihrer Mutter nebenan. Wir waren zusammen aufgewachsen. Es gab niemanden, dem ich meinen Vater mit ruhigerem Gewissen anvertraut hätte.
Ich nickte. »Stimmt.«
Sie hob die Hand und wischte sich eine verirrte Träne von der Wange. »Und wenn ich dich umarmen könnte, würde ich es jetzt. Verdammt.«
»Das weiß ich.« Meine Stimme wurde brüchig. Wir konnten es nicht riskieren – der Fluch wurde sogar ausgelöst, wenn mich nur jemandes Haar streifte.
Mit hängendem Kopf entfernte sie sich von der Tür. »Möge das Licht dich beschützen.«
Möge das Licht mir helfen, in eine Apotheke einzubrechen und unbemerkt zu entkommen, lag mir auf der Zunge.
Ich ging zu meinem Vater und streichelte mit den behandschuhten Fingern seine Wange. Er rührte sich leicht. Schweiß benetzte seine wächserne, blasse Haut. Mit Anfang vierzig hatte sich erstes Grau in das Haar an seinen Schläfen eingeschlichen, dennoch galt er nach wie vor als einer der Stärksten in unserem Dorf. Ich würde nicht zulassen, dass ihn das Licht wegen einer Entzündung durch den dämlichen Ast eines Baums holte!
»Halt durch, alter Mann. So leicht kommst du mir nicht davon«, sagte ich zu ihm. Dann machte ich mich auf den Weg zur verbotenen Goldenen Stadt.
Ich war bisher nie dort gewesen, hatte keine Ahnung, wo sich die Apotheken befanden, besaß weder Geld noch einen Rang, um mein Ziel zu erreichen. Die Chancen, lebend und mit einem Heilmittel für meinen Vater nach Isariah zurückzukehren, standen schlecht. Trotzdem konnte ich nicht tatenlos herumsitzen und dabei zusehen, wie der einzige Mann starb, der mich je geliebt hatte.
Das würde ich nicht.
Auf keinen Fall.
* * *
Der Marsch von unserem Dorf im Umfeld der Goldenen Stadt zu den ebenfalls goldenen Toren dauerte ungefähr drei Stunden. Ich trat ihn zweimal jährlich an, um mir zur Sommer- und Wintersonnenwende das unglaubliche Lichterspiel am Himmel anzusehen. Die Bürger der Stadt spielten dazu Musik und tanzten. Alle Bewohner von Isariah gingen hin, um von draußen vor den Toren einen Blick darauf zu erhaschen. Allerdings hatte ich die Tore noch nie durchquert, die einem angeblich bei Berührung einen Energiestoß verpassten. Die Goldene Stadt galt als die wohlhabendste im gesamten Reich, was sie sowohl mit ihrem Namen als auch mit der Barriere verdeutlichte, mit der sie arme, nutzlose Fae wie mich aussperrte.
Ein Gerücht besagte, dass die Tore nicht wirklich aus Gold bestanden, sondern durch einen Trugbann so aussahen, den Königin Solana benutzte, um die Stadt schöner aussehen zu lassen. Jedenfalls würde ich sie auf die eine oder andere Weise überwinden, mochte es kosten, was es wollte. Hinter jenen Toren gab es Heilerinnen und Heiler, Tinkturen und Magie, eine ganze Welt, von der ich keine Ahnung hatte. Eine Welt, die mir helfen könnte, meinen Vater zu retten.
Magie hatte ich erst bei zwei Gelegenheiten erlebt. Einmal, als ein königlicher Soldat aus der Goldenen Stadt auf der Durchreise unser Dorf passiert hatte. In Hipsies Taverne hatte er wie selbstverständlich den Salzstreuer über den Tisch in seine Hand schweben lassen.
Wie die Hälfte der Gäste hatte ich vor Verblüffung darüber nach Luft geschnappt. Aber der Mann hatte nur verhalten gelächelt, als hätte es ihm Vergnügen bereitet, für den armen, magielosen Pöbel anzugeben.
Meine zweite Begegnung mit Magie war etwas ernster gewesen. Damals hatte ein Nachtwandler unser Dorf angegriffen. Wir hatten Frau Turvy schreien gehört und waren losgerannt, um ihr zu helfen. Als wir sie erreichten, hatte sich die Kreatur bereits an ihrem Hals festgesaugt und trank. Mein Vater schoss mit dem Jagdbogen einen Pfeil auf den Nachtwandler ab. Als er getroffen wurde, verwandelte er sich in schwarze Schatten und verschwand. Das hatte mir solche Angst eingejagt, dass ich drei Nächte lang nicht hatte schlafen können.
Stimmen vor mir ließen mich die Schritte verlangsamen. Vor lauter Gedankenverlorenheit hatte ich nicht bemerkt, dass ich den Vorposten zur Goldenen Stadt erreicht hatte. Mittlerweile war es vollständig dunkel geworden, nur der Mond spendete ein wenig Helligkeit. Vor mir ragte ein kleiner Wachturm auf. Dahinter konnte ich die Lichter der Stadt durch den dichten Wald schimmern sehen. Die Tore funkelten im Mondlicht, eine Grenzlinie für den Neid all jener, die sie nicht überschreiten durften.
Ich stand kurz davor, mich an den verbotenen Früchten der Goldenen Stadt zu bedienen. Eigentlich hätte ich mich fürchten sollen. Zumindest hätte ich zittrige Hände haben sollen, doch ich konnte nur an meinen Vater und die auf sein Herz zukriechenden Todeslinien denken.
Mit einem beruhigenden Atemzug tat ich, was ich am besten konnte.
Ich verschwand.
Nicht buchstäblich, wie es magische Fae vielleicht konnten, eher so, wie ich es über siebzehn Jahre beim Versuch gelernt hatte, nicht von anderen berührt zu werden. Wenn man mich nicht bemerkte, fasste man mich auch nicht an. Und wurde ich nicht angefasst, musste ich keine Schmerzen leiden.
Mit aufgesetzter Kapuze drückte ich mich an die Bäume und bewegte mich durch den dichtesten Teil des Walds. Ich belastete nur die Fußballen, wich Blättern, Zweigen und allem Sonstigen aus, das Geräusche verursachen konnte, trat ausschließlich auf weiches Moos und aufgewühlte Erde. Indem ich mich in schrägem Winkel nach Osten vorarbeitete, gelang es mir, mich am Wachturm und am Hauptzugang zur Goldenen Stadt vorbeizuschleichen. Der Schutz der Tore selbst überstieg bei Weitem alles, was ich überwinden könnte. Nachdem ich eine Zeit lang in nordöstliche Richtung vorgerückt war, erreichte ich einen Teil des Walds, in dem sich die Bäume lichteten. Zwischen ihnen hindurch konnte ich die golden schimmernden Tore der Stadt ausmachen.
Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich nach unten fasste, um mich zu vergewissern, ob sich mein Dolch noch gut versteckt in meinem Stiefel befand. Eigentlich wusste ich gar nicht, warum ich ihn mitgebracht hatte. Ich glaubte nicht wirklich, dass ich fähig wäre, jemanden zu verletzen, um meinen Vater zu retten, aber ... ich wäre wohl nicht darüber erhaben, jemandem zu drohen. Beim bloßen Gedanken daran schämte ich mich. Mein Vater hatte mir viel über das Aufwachsen in Isariah beigebracht. Wir betrachteten uns als Überlebende unter widrigen Umständen. Er hatte mir den Dolch zu meinem zwölften Geburtstag geschenkt und mir eingebläut, ihn ausschließlich in lebensbedrohlichen Situationen zu benutzen. Gewiss, das Leben in unserem Dorf – ohne Magie, Rang oder Geld – war hart. Im Vergleich zu den Fae der Goldenen Stadt starben wir jünger, waren dünner und verdingten uns als Diener. Aber wir waren keine Verbrecher. Keine Mörder. Ich wollte niemanden verletzen.
Was ich vorhatte – aus der Goldenen Stadt zu stehlen und dafür bei Bedarf meinen Dolch zu benutzen –, würde meinen Vater nicht gerade mit Stolz erfüllen.
Aber das war mir egal.
Wenn er überlebte, würde ich mich gern von ihm ausschimpfen lassen.
Mit jenem letzten Gedanken trat ich zwischen den Bäumen hervor auf die offene Wiese vor dem goldenen Zaun. Nachdem ich mich umgesehen und niemanden entdeckt hatte, rückte ich weiter vor. Wie eine Löwin, die ihrer Beute nachjagte, rannte ich über das grasbewachsene Feld. Mir war bewusst, dass ich in dem Moment am sichtbarsten für etwaige Wächter in Türmen war und schnell handeln musste. Ich hatte vor, den sechs Meter hohen goldenen Zaun zu überklettern, doch als ich mich bis auf einen Schritt genähert hatte, hörte ich das hohe Summen von Elektrizität.
Die gab es bei uns in Isariah nicht. Da es besonderer Magie bedurfte, den Energiestrom zu erzeugen, und zusätzlich eines teuren Kristalls, um ihn einzufangen, blieb sie uns verwehrt. Aber ich hatte davon gehört und in Büchern, die zu lesen Sorrel mir beigebracht hatte, mehr darüber erfahren. Ich wusste, dass damit ein Summen einherging, und ich kannte die Gerüchte, dass der Zaun so geschützt wurde. Wenn man ihn berührte, spürte man angeblich einen schmerzhaften Energiestoß.
Schon merkwürdig, so beschrieb ich immer, wie es sich für mich anfühlte, angefasst zu werden. Als ich klein gewesen war, hatte Sorrel mir ein Buch vorgelesen. Darin wurde ein Junge von einem Blitz getroffen. Sein gesamter Körper wurde dabei verbrannt und zitterte, und die Empfindungen wurden so beschrieben, als stünde seine Haut in Flammen.
Damals hatte ich nach Luft geschnappt und ihr gesagt, dass es sich für mich jedes Mal so anfühlte, wenn mich jemand berührte. Mein Vater war dabei gewesen. Da er selbst nicht lesen konnte, hörte er auch gern zu, wenn Sorrel uns laut vorlas.
Ich hatte nie den Ausdruck blanken Grauens vergessen, den er an jenem Abend im Gesicht hatte. Er meinte damals zu Sorrel und mir, er wäre müde, und er wünschte uns eine gute Nacht.
Durch die dünnen Wände unserer Hütte hörten wir ihn die nächste Stunde lang in seinem Zimmer schluchzen. Von mir zu hören, wie ich meine Schmerzen beschrieb, verursachte ihm Schmerz, das begriff ich schon in jenem zarten Alter. Und das wollte ich nicht. Deshalb hatte ich danach vor meinem Vater nie wieder etwas davon erwähnt.
Nun starrte ich auf die goldenen Stäbe vor mir und wappnete mich auf zweifellos heftige Qualen. Aber für meinen Vater würde ich sie in Kauf nehmen. Ich trat näher hin, um den Weg nach oben zu planen, und fragte mich, ob es helfen würde, die Stangen mit Handschuhen zu ergreifen. Dabei stellte ich fest, dass die Lücken dazwischen riesig wirkten. Zwar nicht groß genug für einen erwachsenen Mann, aber vielleicht für eine untergewichtige Siebzehnjährige ohne nennenswerte Brüste ... Ich überlegte, ob ich mich einfach dazwischen hindurchschieben könnte. Schließlich entschied ich, es wäre den Versuch wert, zog den Bauch ein und drehte mich zur Seite.
Hinter dem Zaun befand sich ein Wald. Wenn ich es dorthin schaffte, könnte ich mich vor etwaigen Wächtern verstecken. Ohne weiter darüber nachzudenken, zwängte ich mich in die Lücke zwischen den Gitterstäben und betete zum Licht, ich möge es lebend auf die andere Seite schaffen.
Die erste Hälfte meines Körpers glitt vergleichsweise einfach hindurch. Aber als meine Brust die Stange streifte, die am Stoff meines Mantels zerrte, durchzuckte mich der Energiestrom, und ich schnappte jäh nach Luft. Schmerzen schossen durch meine Wirbelsäule und verschlugen mir den Atem. Mein gesamter Körper erschauderte. Mit einem Ruck zwängte ich mich durch den Rest der Lücke und landete mit einem Aufschrei auf den Knien.
Es hatte geschmerzt. Sehr. Aber nicht schlimmer als mein Fluch. Die Erkenntnis, dass meine Bürde dem ähnelte, womit die Goldene Stadt sich vor Schaden schützte, stimmte mich einen Moment lang traurig.
Ich kroch auf Händen und Knien los. Dabei atmete ich schwer, während die Schmerzen auf meiner Haut nachklangen. Als ich es zwischen die dicht wachsenden Bäume innerhalb der Stadtgrenzen schaffte, ließ ich mich auf den Rücken fallen. Mir brummte der Schädel ähnlich wie dann, wenn ich versehentlich – oder auch nicht wirklich versehentlich – berührt wurde. Vor allem in meinen jüngeren Jahren an der Schule waren andere neugierig gewesen und hatten herausfinden wollen, ob mein Fluch echt war. Oder wie ich darauf reagierte.
Ein Finger an meinem Hals, ein Streifen mit Haaren – mein Vater hätte mich beinah aus der Dorfschule geholt, weil es entschieden zu oft vorgekommen war.
Dann hatte ich den Dolch dorthin mitgenommen. Und als mich das nächste Mal jemand absichtlich berührt hatte, um lachend zu beobachten, wie ich mich auf dem Boden krümmte, hatte ich die Waffe gezogen und sie ihm sachte an der Kehle angesetzt.
Danach hatte es schlagartig geendet, und mein Vater hatte nicht mal davon erfahren, dass ich den Dolch in der Schule bei mir gehabt hatte. So hatten alle dabei gewonnen.
Mein Vater.
So gern ich auf der kalten Erde liegen geblieben wäre, bis sich meine schmerzende Haut beruhigt hätte, ich musste weiter. Diese zornigen roten Linien auf dem Bauch meines Vaters kündigten seinen bevorstehenden Tod an. Wenn sie sein Herz erreichten, würde ich ihn für immer verlieren. Das durfte ich nicht zulassen.
Nachdem ich mich orientiert hatte, machte ich mich auf den Weg in die Stadt, weg vom goldenen Zaun und in Richtung der Klänge ausgelassenen Treibens. Die Geräusche kannte ich gut – klirrende Gläser, laute Stimmen, stampfende Füße. Vor mir befand sich eine Taverne wie jene, in der ich arbeitete. Eine Gaststätte verhieß zwar Leute, aber in der Regel von Met benebelt. Hoffentlich würden sie nicht auf meine abgetragene Kleidung achten oder bemerken, dass ich mich in einer Stadt nicht auskannte, in der ich eigentlich leben sollte.
Und tatsächlich erblickte ich das große Gebäude, sobald ich den dichten Wald hinter mir ließ und eine gepflegte kopfsteingepflasterte Straße betrat. Wie sich herausstellte, unterschied sich diese Taverne völlig von jener, in der ich in Isariah arbeitete. Sie war viermal so groß und schien vollständig aus massiven roten Ziegelsteinen zu bestehen. Die Veranda war voll von Fae, die tanzten und ihre Gläser gen Himmel erhoben.
Es musste irgendein Feiertag sein. Oder vielleicht wurde ein Geburtstag gefeiert. Bestimmt ging es so nicht jeden Abend zu, oder? Wer könnte es sich schon leisten, täglich auswärts trinken zu gehen? Ich ließ den Blick über die vor der Taverne feiernden Fae wandern, hielt Ausschau nach jemandem, der zugänglich wirkte.
Eine junge Frau, vielleicht Mitte zwanzig, betrachtete ihre Fingernägel und vermittelte einen gelangweilten Eindruck.
Ich näherte mich dem Geländer der Veranda und rief ihr zu. »Fräulein?«
Abrupt schaute sie auf und sah mich an. Prompt heftete sich ihr Blick auf meinen abgewetzten Mantel und meine löchrigen Schuhe. Sie schrak leicht zurück, und ich schämte mich. Diese Fae trugen allesamt bunte Kleidung aus Seide und Samt, die aussah, als wäre sie nicht öfter als dreimal gewaschen worden. Die Frisuren wurden von Nadeln perfekt fixiert, die Gesichter wiesen Schminke auf.
»Ich bin aus einer anderen Stadt zu Besuch bei meiner Base, aber sie ist schon zu Bett gegangen. Jetzt habe ich Kopfschmerzen und bräuchte eine Apotheke«, erklärte ich und schaute weiter die kopfsteingepflasterte Straße hinauf. Eine Reihe von Gebäuden erstreckte sich an ihr entlang in die tieferen Bereiche der Stadt. Hoffentlich würde mir die junge Frau die Richtung weisen können.
»Einfache Kopfschmerzen?« Sie lachte. »Mein Freund drinnen besitzt Heilmagie. Sie beschränkt sich zwar auf kleinere Gebrechen, aber Kopfschmerzen sind für ihn ein Klacks. Ich hole ihn und ...«
Panisch fiel ich ihr ins Wort. »Ich hätte lieber eine Tinktur, die ich auch später benutzen kann, wenn kein Fae-Heiler verfügbar ist.«
In Isariah gingen wir so oft mit Wehwehchen und handfesten Schmerzen zu Bett. Und in der Goldenen Stadt trieben sich Fae-Heiler herum, die sie einem kostenlos abnahmen! Da die Frau gesagt hatte, die Magie ihres Freunds beschränkte sich auf harmlosere Gebrechen, brauchte ich ihn gar nicht erst zu fragen, ob er meinem Vater helfen könnte.
Nach kurzem Zögern nickte sie. »Geh die Straße entlang weiter. Am Rosenweg biegst du nach rechts, an der Weidenstraße nach links. Die Avis-Apotheke.«
Erleichterung über die einfache Beschreibung breitete sich in mir aus. »Danke.« Ich schenkte ihr ein aufrichtiges Lächeln, bevor ich mich zum Gehen wandte. Das Herz schlug mir bis in den Hals, als ich mich entfernte und betete, meine Aufmachung würde mich an diesem Ort nicht in Schwierigkeiten bringen. Gab es in der Goldenen Stadt keine armen Leute? Jedenfalls hatte die Frau mich angestarrt, als hätte sie noch nie im Leben einen fadenscheinigen Mantel gesehen. Aber egal, mir fehlte die Zeit, um mir den Kopf über meine Kleidung zu zerbrechen. Mein Vater stand an der Schwelle zum Tod. Damit im Hinterkopf verfiel ich in Laufschritt. Ich begegnete nur zwei Leuten, beide betagt. Es schien sich um Ladenbesitzer zu handeln, einen hatte ich nämlich beim Abschließen der Tür eines Uhrmacherladens beobachtet. Offenbar war es an der Zeit für Feierabend. Ich war mir nicht sicher, ob ich wollte, dass die Apotheke noch geöffnet oder schon geschlossen wäre. Hätte sie offen, könnte ich den Besitzer oder die Besitzerin zwar nach dem richtigen Heilmittel fragen, nur müsste ich dann damit davonrennen, und man würde mir die Wächter auf den Hals hetzen. Wenn sie geschlossen wäre, könnte ich ein Fenster einschlagen und einbrechen, müsste allerdings allein herumstöbern.
Was hatte Sorrel genau gesagt? Ich hatte es bereits vergessen, war jedoch überzeugt, es würde mir einfallen, wenn ich die Beschriftungen sähe. Entzündungshemmend?
Ich beschloss, es dem Schicksal zu überlassen.
Am Rosenweg bog ich nach rechts ab und versuchte, mich nicht wie eine Fremde staunend umzusehen. Aber die Stadt erwies sich als wunderschön. Noch schöner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Zum einen so sauber. Die Straßen wirkten gefegt, nirgendwo sah man Schmutz oder gar Müll. In jeder gab es kleine schimmernde Lampen mit Körben voller Hängeblumen, und als ich hinaufschaute, um festzustellen, woher das Licht stammte, entdeckte ich einen Kristall. Er entsprach genau dem, worüber ich gelesen hatte – die Fae luden ihn mit der Magie auf, die Elektrizität erzeugte. Der Stein strahlte ein annähernd violettes Licht ab, das die Stadt in einen zarten Fliederton tünchte. Die Fassade jedes Ladengebäudes war in einer anderen Farbe gestrichen. Hellgelb, hellrosa, hellblau. Allein der Anblick erfüllte mich mit Glücksgefühlen. Nichts an diesem Ort wirkte bedrückend. In Isariah sah man immer irgendwo etwas, das in Ordnung gebracht oder gereinigt werden müsste, in dieser Stadt hingegen schien alles perfekt zu sein.
Das Schild der Weidenstraße riss mich aus dem Staunen, und ich bog nach links ab. Unverhofft entfuhr mir ein spitzer Laut, als ich mich plötzlich von Angesicht zu Angesicht einem Stadtwächter gegenübersah.
Unter seinem Mantel lugte das goldene Flammenemblem auf seinem Brustpanzer hervor.
Auch er zuckte zusammen, und ich wich hastig zurück, um nicht berührt zu werden.
»Du hast mich erschreckt.« Ich fasste mir an die Brust und versuchte, mir Antworten für all die Fragen zurechtzulegen, die er bestimmt stellen würde.
Was wollte ich in dieser Gegend? Warum trieb ich mich nach Einbruch der Dunkelheit draußen herum? Stammte ich überhaupt aus der Stadt? Wieso trug ich so fadenscheinige Kleidung?
Sein Blick wanderte über mein unter der Kapuze verborgenes Gesicht, und er nickte. »Was machst du nach Ausgangssperre hier draußen?«
Es gab eine Ausgangssperre?
Denk nach, Fallon.
Mein Herz hämmerte wild gegen den Brustkorb, als ich mir vorstellte, so knapp vor dem Ziel verhaftet zu werden.
»Ich muss in einem der Geschäfte eine Bestellung abholen, aber danach eile ich gleich nach Hause. Das verspreche ich.« Unauffällig ging ich in Stellung, um die Flucht zu ergreifen, falls er mich zu packen versuchte.
Stattdessen grinste er verschmitzt. »Du weißt doch, dass du nach der Ausgangssperre auf der Westseite der Stadt bleiben sollst. Also lass dich besser nicht von anderen Wächtern sehen, in Ordnung?«
Die Westseite der Stadt? Wieso das?
»In Ordnung«, murmelte ich. Erleichterung durchströmte mich, und ich entspannte mich ein wenig.
Nach einem weiteren Nicken ging er.
Dem Licht sei Dank. Ich atmete durch, ehe ich den Weg die Weidenstraße hinunter fortsetzte.
Was befand sich auf der Westseite der Stadt? Und warum sollte ich dort bleiben? Ich hatte nicht vor, lang genug zu verweilen, um es herauszufinden. Stattdessen beschleunigte ich die Schritte und hielt gleichzeitig nach dem Geschäft Ausschau, das ich suchte.
Delilahs Feinkost, Swanns Süßwaren, Maes Magieladen und ... Da war sie, die Avis-Apotheke. In den Namen und den putzigen, aufeinander abgestimmten Buchstaben erkannte man deutlich ein Muster. Zu Hause würde ich Hipsie raten, den Namen ihrer Gaststätte in Tabithas Taverne zu ändern, um mit der Zeit zu gehen.
Bei dem Gedanken schmunzelte ich, als ich vor den Eingang des Ladens trat. Enttäuschung nistete sich in mir ein, als ich dort ein Schild mit der Aufschrift »Geschlossen« erblickte. Drinnen schimmerte nur ein schwaches Licht.
Nein.
Eigentlich hatte ich nicht einbrechen wollen. Ich wollte nicht stehlen, aber ich hatte kein Geld, und da ich schon so weit gekommen war, gab es kein Zurück mehr.
Ich warf einen Blick über die Schulter und vergewisserte mich, dass ich mich allein in der Weidenstraße befand. Als ich weit und breit niemanden entdeckte, bückte ich mich beiläufig und hob einen großen Stein aus dem schmucken Blumenbeet vor dem Schaufenster auf.
Obwohl mein Herz in der Brust flatterte, trieb mich die Erinnerung an meinen bewusstlos mit wächserner, blasser Haut auf dem Boden liegenden Vater weiter an.
Ohne lange nachzudenken, schlug ich mit dem Stein in der Nähe des Riegels gegen die Glasscheibe der Tür und zertrümmerte sie auf Anhieb. Der Stein rutschte mir aus den Fingern und fiel mit einem lauten Pochen drinnen auf den Boden.
Wieder drehte ich mich um und fürchtete, von einem Fußgänger oder Wächter erwischt zu werden, aber immer noch hielt sich niemand in der Nähe auf. Ich fasste hinein, hob den Riegel an und öffnete die Tür, die dabei gegen den Stein stieß und ihn über den Boden schob.
Rasch trat ich ein und schloss sie hinter mir. Nun musste ich nur noch ein Heilmittel für meinen Vater finden. Energie durchströmte mich, als ich vorrückte und all die Ablagen betrachtete. Sie enthielten Pulver, Salben, Kapseln, Kristalle, Tees, Öle. Kleine Fläschchen, große Flaschen, Beutel, Ampullen und Gläser. Der Anblick war überwältigend.
Mein Blick wanderte rasch darüber, und ich schnappte hörbar nach Luft, als ich das Wort Tinkturen auf einem Schild hinter der Ladentheke las. Sie nahmen in kleinen blauen Glasflaschen eine gesamte Wand ein. Ich ging um die Theke herum dahinter und begann, im schwachen Licht die Etiketten zu lesen, dankbar dafür, dass Sorrel es mir beigebracht hatte. Geistesruh, Rückenwohl, Augenschwellungsheil, Ausschlagsabschied ...
»Du musst verzweifelt sein, wenn du meine Tür einschlägst«, sagte eine weibliche Stimme hinter mir. Ich erstarrte. Meine Hand erzitterte mit dem Entzündungslebwohl-Fläschchen, das ich gerade ergriffen hatte. Meine Atmung beschleunigte sich, meine Muskeln spannten sich wie eine aufgezogene Feder an, als ich mich dafür wappnete, jäh die Flucht zu ergreifen.
Als ich herumwirbelte, sah ich mich einer freundlich wirkenden Fae mit grauen Strähnen im braunen Haar gegenüber. Sie schien Ende dreißig oder Anfang vierzig zu sein, stand in einem Nachthemd mitten im Laden und betrachtete stirnrunzelnd die zerbrochene Scheibe.
»Mein Vater liegt im Sterben. Von seinem Bauch breiten sich rote Ranken zu seinem Herzen aus. Ich kann nicht bezahlen. Es tut mir leid«, stieß ich schnell hervor und hoffte, sie würde mich nicht mit lähmender Magie angreifen oder einen Wächter rufen.
Soll ich den Dolch ziehen? Besitzt sie Magie, um mich zu fassen? Sie versperrte mir den Weg zum Ausgang, und ich wünschte, ich hätte mein Unterfangen besser durchdacht.
Langsam nickte sie, faltete die Hände und bedachte mich mit einem nachdenklichen Blick.
»Wenn es rote Ranken sind, wird diese Tinktur nicht helfen. Er braucht einen Heiler. An der Akademie gibt es Schüler der Heilkunde, die Kranke zur Übung kostenlos behandeln. Für den Abschluss brauchen sie eine bestimmte Anzahl verschiedener Fälle.«
Meine Gedanken überschlugen sich, während ich ihre Worte verarbeitete. Ich war verwirrt. Bot sie etwa an ... mir zu helfen?
Merkte sie nicht, dass ich nicht aus der Stadt stammte?
»Ich habe deine Scheibe zerbrochen«, platzte ich heraus und fragte mich, warum im Namen des Lichts sie danach etwas für mich tun wollte.
Wieder nickte sie. »Und das sagt mir, dass du wirklich in Not sein musst. Es ist mein Beruf, Leuten zu helfen. Ich wünschte nur, du hättest einfach angeklopft.«
Scham brachte meine Wangen zum Lodern. Schlagartig fühlte ich mich schrecklich. Mir war nie der Gedanke gekommen, anzuklopfen und um ein Almosen zu bitten. Wohnte die Frau etwa in dem Laden? Ich spähte zur Seite des Raums, und tatsächlich, dort entdeckte ich ein aufgeklapptes Regal, hinter dem sich eine verborgene Tür befand, die zu ihrem Zuhause führen musste.
»Es ... es tut mir so leid. Ich will versuchen, dafür zu bezahlen.« Eine vergebliche Lüge. In Isariah benutzten wir keine Münzen. Meine Arbeit in der Taverne stellte einen Tauschhandel dar. Wir brauchten kein Geld.
Die Frau bedachte mich mit einem strengen Blick, verengte die Augen zu Schlitzen und stemmte eine Hand in die Hüfte. »Oh, ich erwarte voll und ganz von dir, dass du wieder herkommst und die Schuld dafür abarbeitest.« Sie zeigte auf das zerbrochene Glas.
Abarbeiten. In der Goldenen Stadt? Also wusste sie nicht, dass ich von woanders stammte. Meine Aufmerksamkeit galt der Neuigkeit, dass es eine Akademie gab, die offenbar Heiler ausbildete und kostenlose Dienste anbot.
»In welcher Richtung ist die Akademie noch mal? Meinem Vater bleibt nicht viel Zeit, es war eine schreckliche Nacht, und ich bin völlig durcheinander.« Ich zeigte im Laden erst nach hinten, dann zur Seite, um mögliche Richtungen anzudeuten.
Sie verdrehte die Augen. »Die Akademie! Das große schwarze Gebäude westlich von hier. Bestimmt träumst du davon, sie zu besuchen, seit du klein warst, oder?«
Ich nickte. »Natürlich. Diese Akademie.«
Obwohl ich keine Ahnung davon hatte, wollte ich sofort hingehen und versuchen, einen Heiler für meinen Vater zu finden. Ich würde die Tinktur und einen Heiler mit nach Hause bringen, dann würde er gewiss nicht sterben.
Also steckte ich das Fläschchen mit Entzündungslebwohl ein. »Das arbeite ich auch ab«, log ich. »Nur für den Fall, dass es doch hilft.«
Die Frau seufzte resignierend. »Na schön, Liebes. Und nächstes Mal klopfst du an. Weißt du, es macht mir nichts aus, den Leuten zu helfen, die auf der Westseite leben.«
Schon wieder. Nach dem Wächter erwähnte auch sie diese Gegend. Da dämmerte mir, dass es in der Goldenen Stadt sehr wohl Arme geben musste, und es versetzte mir einen kleinen Stich im Herzen, dass man mich auf Anhieb als jemanden davon erkannte.
»Danke«, murmelte ich.
Ich trat hinter der Theke hervor. Kurz zögerte ich, bevor ich zur Eingangstür ging und sie öffnete.
»Ich erwarte, dass du das morgen aufräumst!«, rief sie mir nach. »Ich stelle den Besen für dich heraus.«
Mir widerstrebte, der Frau mitzuteilen, dass sie mich nie wiedersehen würde. Mir gefiel die Vorstellung, dass sie glaubte, ich würde in der Goldenen Stadt leben, auch wenn sie dachte, dass ich aus dem armen Teil stammte. Ich bedankte mich erneut, ehe ich den Laden verließ und mich auf die Suche nach einem Heiler für meinen Vater machte.
Zu dem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass ich wesentlich mehr finden würde, als ich erwartete.
2
Die Akademie erwies sich als faszinierendes Gebäude aus schwarzem Ziegelstein mit goldenen Türmen und gewölbten Bögen. Allerdings war nur das Bauwerk selbst dunkel, denn über nahezu jede Mauer rankte sich irgendein buntes, blumenartiges Gewächs. Am besten gefielen mir die violetten, wie Tropfen um die Fenster herum angeordneten Blüten, die im Mondlicht regelrecht zu leuchten schienen. Das Gebäude wirkte dadurch wie lebendig, als würde es durch die Pflanzen daran atmen. Es ragte fünf Geschosse empor. Etwas Höheres hatte ich noch nie gesehen. Das Eingangstor stand weit offen. Ich ging schnurstracks hindurch auf einen hell erleuchteten Innenhof. Dort saßen einige Schülerinnen auf einer Bank beisammen und unterhielten sich lachend miteinander.
Ich hatte beschlossen, mir die Sache mit der »Westseite« zunutze zu machen und so zu tun, als lebte ich in der Gegend. Als ich mich der Gruppe näherte, verstummten alle. Eine junge Frau bedachte mich mit einem unverhohlen verächtlichen Blick.
»Ziemlich weit weg von zu Hause, was, Westlerin?«, höhnte eine mit blondem Haar. Die anderen lachten leise darüber.
Kein besonders freundlicher Empfang.
»Ich brauche jemanden, der heilen kann. Dringend.« Bei den Worten hielt ich den Kopf hoch erhoben und tat so, als wüsste ich, wovon ich redete.
Die junge Frau lachte. »Dann geh zur Klinik auf der Westseite, wie es sich gehört.« Mit verzogenen Lippen betrachtete sie meine Schuhe.
Oha – also gab es eine strikte Trennung zwischen Arm und Reich? Aus irgendeinem Grund widerte mich das an. Ich hatte mir immer vorgestellt, die Goldene Stadt wäre voller mächtiger Fae, die einander alle gleich behandelten. Und dass man nur die nach Isariah verbannten Magielosen als Ausgestoßene betrachtete.
»Ich brauche einen Heiler in Ausbildung, der kostenlos arbeitet. Mein Vater liegt im Sterben!« Vor lauter Panik klang meine Stimme schärfer als beabsichtigt.
Die jungen Frauen auf der Bank schwiegen, aber eine Fae, die schweigend an der Mauer dahinter lehnte und uns beobachtet hatte, räusperte sich. »Ich bringe dich zur Heilklinik für Auszubildende.« Sie stieß sich von der Mauer ab und kam auf mich zu. Unter dem kurzen, wilden, lockigen roten Haar hatte sie einen entschlossenen Ausdruck in den Augen.
»Danke«, murmelte ich.
»Eine Westlerin? Komm schon, Eden. Du weißt, dass sie nicht hier sein darf«, sagte die schnodderige junge Frau zu meiner neuen Helferin.
Eden warf der Rädelsführerin einen finsteren Blick zu. »Als hättest du noch nie gegen eine Regel verstoßen, Blair.«
Darauf erwiderte Blair nichts mehr, und Eden winkte mich zu einem langen Gehweg zwischen zwei riesigen Gebäuden.
Sobald wir unter uns waren, schenkte sie mir ein verhaltenes Lächeln. »Tut mir leid wegen ihr. Ist ja nicht deine Schuld, dass du mit schwacher Magie geboren worden bist. Ich habe diese Spaltung der Stadt nie verstanden.«
Oh ... Also hausten Westler auf der Westseite, weil sie nur schwache Magie besaßen, während die mächtigen Fae auf der Ostseite lebten und die schicke Akademie besuchten. Auf einmal ergab alles einen Sinn. Eine auf Macht beruhende Hierarchie.
Ich nickte nur, wollte nicht zu viel sagen, weil ich fürchtete, meine Tarnung könnte sonst auffliegen.
Während wir die Gänge durchquerten, sah ich mich um, ließ alles auf mich wirken. Da die Türen zu den Klassenzimmern offen standen, ertappte ich mich dabei, hineinzuspähen. Saubere Schreibtische, brandneue Bücher, eine Wand voller Waffen und eine Kammer, die nach einem gepolsterten Übungsraum aussah. Dort waren gerade Schüler zugange. Unwillkürlich schnappte ich nach Luft, als ein Feuerball von der Handfläche eines jungen Mannes schoss und in den Brustpanzer aus Metall eines anderen einschlug, bevor er sich auflöste.
Eden kicherte neben mir. »Die Jungs hier an der Schule geben gern an.«
»Wohnst du auf dem Campus?«, fragte ich sie und war dankbar, dass die Akademie so spät noch geöffnet zu sein schien.
Als sie den Kopf schüttelte, wippten ihre wilden Locken um ihr Gesicht. »Wir hatten heute einen Ausflug. Deshalb sind wir alle lang geblieben, um die Klassenarbeit nachzuholen, und die Schülerklinik ist immer bis spät-abends geöffnet.« Sie setzte den Weg an dem großen Raum vorbei fort zu einem Gebäude in der Mitte der Anlage.
Ich erwiderte nichts, ließ nur den Blick umherwandern und nahm alles in mich auf.
»Du, wie es klingt, ist dein Vater in ziemlich übler Verfassung, richtig?«, fragte Eden.
Ich nickte und versuchte, mich wieder auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren.
»Gut. Bausch das ruhig auf. Je mehr du es als Frage von Leben und Tod darstellst, desto besser stehen die Aussichten, dass sich ein mächtiger Heiler bereit erklärt, für deinen Vater auf die Westseite zu reisen.«
Traurigerweise brauchte ich nichts aufzubauschen. Und was die Reise auf die Westseite anging ... Das würde hoffentlich verhandelbar sein. Aber ich war dankbar für Edens Freundlichkeit. Sie betrachtete mich nicht als Abschaum, was ich als Sieg wertete.
Als wir vor das neue, ebenfalls aus schwarzen Ziegelsteinen errichtete Gebäude mit goldbemalten Zierleisten und Blumenranken traten, fiel mein Blick auf ein schwarzes Schild vorn auf der Doppeltür. »Schülerklinik« stand in metallischen, schnörkeligen Buchstaben darauf. In Silber folgte darunter: »Betreten auf eigene Gefahr.«
Darüber runzelte ich die Stirn, doch Eden grinste nur. »Es sind alle wirklich begabt. Nur die Besten der Besten schaffen es in die Akademie. Wenn du deinen Vater zur Klinik der Westseite bringst, wartet er wahrscheinlich stundenlang in der Schlange und stirbt womöglich draußen, bevor er überhaupt untersucht wird.«
Bei der Einschätzung krampfte sich mein Magen zusammen.
»Woher weißt du so viel über die Westseite?«, fragte ich.
Kurz veränderte sich ihre Miene. Ihre Züge erschlafften, doch sie erwiderte nichts, streckte nur die Hand aus, öffnete die Doppeltür und führte mich hinein.
Zwei junge Männer in silbernen Seidenkitteln, die bis zu den Waden reichten, saßen hinter einem Schreibtisch und plauderten. Ihre Hände ruhten gefaltet auf der Tischplatte. Ich bemühte mich, mein Erstaunen über die silbrig eintätowierten Male auf ihren Handrücken zu verbergen. Einer hatte mehr davon als der andere.
Als wir uns näherten, schauten sie auf, lächelten Eden freundlich an und erhoben sich.
»Hallo, E«, grüßte einer der beiden mit dunklem Haar und grünen Augen. Der andere, ein großer Fae mit kinnlangem Haar der Farbe von Mondlicht und eisengrauen Augen, starrte mich so unverwandt an, dass es sich wie ein Schlag in die Magengrube anfühlte. Unwillkürlich stieß ich den Atem aus, als sein eindringlicher Blick ein Bewusstsein tief in meinem Wesen erweckte. Ich fühlte mich gebannt von seiner Gegenwart.
Langsam strich seine Aufmerksamkeit über mich, vom schwarzen Haar zu den abgewetzten, ellbogenlangen Handschuhen bis hinunter zu den schmutzigen, rissigen Schuhen. Bei meinem Gesicht, meinen Lippen hielt er länger inne, und mein Bauch krampfte sich zusammen.
»Ihr Vater ist in wirklich schlechter Verfassung. Er braucht einen Heiler. Und sie hat kein Geld.« Eden sprach für mich, wofür ich dankbar war, denn in jenem Moment steckte ich fest, erstarrt unter dem prüfenden Blick dieses Gottes mit den eisengrauen Augen. Noch nie zuvor im Leben hatte ich mich so entblößt gefühlt. Unter seiner Musterung kam ich mir splitternackt vor. Beinah so, als berührte er mich, indem er mich bloß ansah. Ich fragte mich gerade, ob irgendeine Magie am Werk war, als der Grünäugige den anderen in die Brust stupste und damit den Bann über mich brach. »Ariyon, aufwachen«, sagte er. Der Grauäugige blinzelte, schüttelte leicht den Kopf und sah Eden an.
»Hallo, E.«
Ariyon. Allein der Namen bewirkte Merkwürdiges in meinem Körper. Hitze breitete sich durch mein Innerstes aus.
Sie nickte. »Kann ihr einer von euch helfen? Ihr müsstet zu ihm. Dein Vater kann ja nicht laufen, oder?«, wandte sie sich an mich und gab mir mit großen Augen zu verstehen, dass ich es bestätigen und aufbauschen sollte. Ich schluckte schwer, bevor ich mit der Wahrheit antwortete. »Er hat sich vor ein paar Tagen an einem Ast den Bauch aufgekratzt. Danach hat er Fieber bekommen. Schließlich hat er das Bewusstsein verloren, und ... und von der Wunde breiten sich zornig-rote Ranken zu seinem Herzen aus.«
Alle Anwesenden schnappten nach Luft, auch Eden. Und Ariyon überraschte mich, indem er über die Theke sprang und zu mir eilte.
»Der Fall gehört mir, Hayes!«, rief er dem Grünäugigen zu.
»Was zum Fae soll das, Mann? Ich brauche auch noch eine systemische Erkrankung!«, klagte Hayes.
»Gehen wir«, sagte Ariyon eindringlich zu mir und streckte die Hand nach meinem Oberarm aus, als wollte er mich hinausführen. Obwohl mich mein Mantel und meine Handschuhe schützten, widerstrebte es mir. Gleichzeitig gefiel mir sein sichtlicher Eifer, meinen Vater zu heilen. Auch wenn er es nicht aus reiner Herzensgüte wollte, sondern für seine Ausbildung. Das war mir egal. Ich brauchte nur seine Hilfe.
»Viel Glück!«, wünschte uns Eden, als wir auf die Tür zusteuerten.
Ich drehte mich um und winkte ihr. »Danke!«
»Warte, wie heißt du?«, rief sie mir nach.
»Fallon!«, rief ich zurück, und sie winkte erneut.
»Wir sehen uns!«
Nein, würden wir nicht.
Mit forschen Schritten bahnten wir uns einen verschlungenen Weg über das Schulgelände. Und ehe ich mich versah, standen wir vor Stallungen.
»Mit meinem Pferd erreichen wir die Westseite schneller. Rote Ranken bedeuten, dass dein Vater bestenfalls noch Stunden zu leben hat.« Er warf einen Sattel über einen wunderschönen Rappen.
Grauenhafte Gedanken rasten mir durch den Kopf, eine Flut möglicher Szenarien, die alle mit dem Tod meines Vaters endeten. Mein Herz pochte wild, und ich spürte, wie meine Handflächen in den Handschuhen klamm wurden.
Reiß dich zusammen, Fallon, sagte ich mir, während ich die schwarze Stute anstarrte.