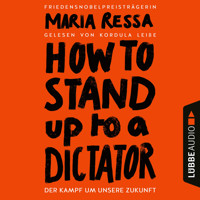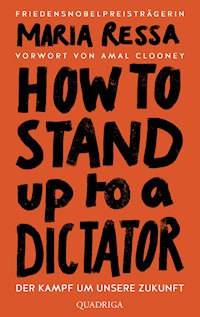
HOW TO STAND UP TO A DICTATOR - Deutsche Ausgabe. Von der Friedensnobelpreisträgerin E-Book
Maria Ressa
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Quadriga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Meinungsfreiheit und freier Journalismus sind die schärfsten Waffen zur Verteidigung von Demokratien. Die Journalistin Maria Ressa steht wie keine andere für den Kampf um die Wahrheit und gegen Hass und Gewalt. In ihrem Buch beschreibt sie, wie Demokratien durch Autokraten und Diktatoren ausgehöhlt werden - mittels sozialer Medien. Denn Facebook und Google dulden aus Profitgier Propaganda und Fake News. Ressa legt ein Netzwerk der Desinformation offen, das den ganzen Globus umspannt: von Dutertes Drogenkrieg bis zur Stürmung des Kapitols in Washington, vom Brexit bis zur Cyber-Kriegsführung durch Russland und China. Maria Ressas Recherche ist verstörend - und dringend notwendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Vorwort
von Amal Clooney
Prolog
Die unsichtbare Atombombe
Leben im (gegenwärtigen) Augenblick (der Vergangenheit)
■
TEIL I
Heimkehr: Macht, die Presse und die Philippinen
1963–2004
Kapitel 1
Die goldene Regel
Ich entscheide mich fürs Lernen
Kapitel 2
Der Ehrenkodex
Grenzen ziehen
Kapitel 3
Schnelligkeit durch Vertrauen
Verletzlichkeit zulassen
Kapitel 4
Die Mission des Journalismus
Ehrlich bleiben
■
TEIL II
Der Aufstieg von Facebook, Rappler und das schwarze Loch des Internets
2005–2017
Kapitel 5
Der Netzwerk-Effekt
Schritt für Schritt Richtung Kipppunkt
Kapitel 6
Hohe Wellen der Veränderung
Ein neues Team
Kapitel 7
Wie Freunde von Freunden die Demokratie zu Fall brachten
Lieber langsam denken
Kapitel 8
Wie der Rechtsstaat von innen ausgehöhlt wurde
Schweigen bedeutet Zustimmung
■
TEIL III
Unterdrückung: Festnahmen, Wahlen und der Kampf um unsere Zukunft
2018 – Gegenwart
Kapitel 9
Tod durch tausend Schnitte
An das Gute glauben
Kapitel 10
Werde nicht zum Monster, um ein Monster zu bekämpfen
Stell dich deiner Angst
Kapitel 11
Kurs halten
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker
Kapitel 12
Warum der Faschismus gewinnt
Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit
Epilog
Ein 10-Punkte-Plan zur Überwindung der Informationskrise
Dank
Anmerkungen und Quellenverzeichnis
Über das Buch
Meinungsfreiheit und freier Journalismus sind die schärfsten Waffen zur Verteidigung von Demokratien. Maria Ressa steht wie keine andere für den Kampf um die Wahrheit und gegen Hass und Gewalt. In ihrem Buch beschreibt sie, wie Demokratien durch Autokraten und Diktatoren ausgehöhlt werden – mittels sozialer Medien. Denn Facebook und Google dulden aus Profitgier Propaganda und Fake News. Ressa legt ein Netzwerk der Desinformation offen, das den ganzen Globus umspannt: von Dutertes Drogenkrieg bis zur Stürmung des Kapitols in Washington, vom Brexit bis zu Cyber-Kriegsführung durch Russland und China. Maria Ressas Recherche ist verstörend – und dringend notwendig.
Gewinnerin des FRIEDENSNOBELPREISES 2021 und des UNESCO FREEDOM AWARD 2021
Über die Autorin
Maria Ressa, geboren auf den Philippinen, zog mit neun Jahren in die USA und kehrte nach ihrem Studium an der Princeton-Universität nach Asien zurück, wo sie leitende Positionen beim Nachrichtensender CNN INTERNATIONAL in Manila und Jakarta bekleidete. Als leitende Investigativreporterin von CNN Asien spezialisierte sie sich auf terroristische Netzwerke. Die Mitgründerin des Online-Nachrichtenportals RAPPLER (2012) erhielt 2021 den FRIEDENSNOBELPREIS.
MARIA RESSA
HOW TOSTANDUP TO ADICTATOR
DER KAMPF UM UNSERE ZUKUNFT
Aus dem amerikanischen Englischvon Henning Dedekind, Marlene Fleißig,Frank Lachmann und Hans-Peter Remmler
QUADRIGA
Dieser Titel ist auch als Hörbuch und Printausgabe erschienen
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»HOW TO STAND UP TO A DICTATOR«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Maria Ressa.
Foreword copyright © 2022 by Amal Clooney.
Published by HarperCollins
Published by arrangement with CIM
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Bildnachweis: Copyright © by Maria Ressa, wenn nicht anders angegeben.
Textredaktion: Angela Kuepper, München
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille nach einem Originalentwurf von © Holly Ovenden
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-2878-2
quadriga-verlag.de
lesejury.de
Für Journalisten und Journalistinnen,Bürgerinnen und Bürger,die »Kurs halten«: #HoldTheLine.
Vorwortvon Amal Clooney
Wenn Sie an einen Superhelden denken, stellen Sie sich möglicherweise etwas anderes vor als eine 1,58 Meter kleine Frau mit einem Bleistift in der Hand. Heute jedoch brauchen Journalisten in autoritären Ländern tatsächlich Superkräfte. Tagtäglich setzen sie ihren Ruf, ihre Freiheit und – in manchen Ländern – ihr Leben aufs Spiel. Und Maria Ressa ist eine von ihnen.
Zu behaupten, Maria würde ihren Kampf allen Widrigkeiten zum Trotz führen, wäre untertrieben. In einer Autokratie ist der Gegner des Journalisten der Staat – er bestimmt Politik und Gesetze, er lenkt die Polizei, er heuert die Staatsanwälte an und hält die Gefängnisse bereit. Er verfügt über eine ganze Armee von im Netz aktiven Bots, die jeden verteufeln und sabotieren, den die Obrigkeit als Widersacher wahrnimmt. Er hat die Macht, Radiosender und Webseiten dichtzumachen. Und vor allem: Er muss den Informationsfluss bestimmen, um zu überleben. Seine Existenz hängt davon ab, dass jede Geschichte immer nur eine Seite hat.
Ein berühmter Philosoph sagte einmal, die größte Tyrannei sei diejenige, die unter dem Deckmantel des Rechts und im Namen der Gerechtigkeit verübt wird. Doch unter Präsident Duterte zögerte die philippinische Regierung nicht, mit juristischen Mitteln gegen jeden vorzugehen, der oder die als Gegner wahrgenommen wird. Die Behörden entzogen Maria die Medienlizenz und überzogen sie mit Zivilklagen, die sie in den Bankrott treiben können. Sie sieht sich mit einer Flut frei erfundener Anklagen konfrontiert, die sie für den Rest ihres Lebens hinter Gitter bringen könnten.
Und das alles nicht etwa, weil sie ein Verbrechen begangen hätte – die Führer ihres Landes wollen einfach keine Kritik hören. Sie hat also die Wahl: Entweder sie fügt sich der Regierung und lebt in Sicherheit oder sie riskiert alles und macht ihre Arbeit. Sie hat nicht gezögert, sich für letzteres zu entscheiden. Und ich weiß, dass sie niemals aufgeben wird.
In der Geschichte waren einige der wichtigsten Stimmen der Gesellschaft immer wieder staatlicher Verfolgung ausgesetzt. Gandhi, Mandela und Martin Luther King wurden alle vor Gericht gestellt, weil sie Kritik an ihren jeweiligen Regierungen geübt hatten. Bei seinem Prozess wegen Aufwiegelung der Bevölkerung in Indien sagte Gandhi dem Richter, er erwarte keine Gnade dafür, sich einer Regierung entgegenzustellen, die die Menschenrechte mit Füßen tritt: »Ich stehe hier und erwarte mit Freuden die höchste Strafe, die mir auferlegt werden kann«, denn »die Nicht-Kooperation mit dem Bösen ist ebenso eine Pflicht wie die Kooperation mit dem Guten«. Seine Worte brachten ihn für zwei Jahre ins Gefängnis. Aber er machte aus Indien eine gerechtere Gesellschaft. Mandela wurde verhaftet, weil seine Ansichten und Überzeugungen der Regierung missfielen: Der Vorwurf lautete auf Hochverrat, und er saß deswegen siebenundzwanzig Jahre im Gefängnis. Aber er war es, der das Übel der Apartheid zu Fall brachte.
Maria ficht einen Kampf aus, der unsere Epoche definiert. Daten aus den letzten Jahren zeigen, dass weltweit mehr Journalistinnen und Journalisten ins Gefängnis geworfen und umgebracht werden als je zuvor seit der Erfassung solcher Daten. Und wir haben heute mehr Autokratien als Demokratien auf der Welt.
Genau deshalb weigert sich Maria, ihr Land zu verlassen; und sie ist entschlossen, sich gegen die Anschuldigungen zu wehren. Sie weiß, dass eine unabhängige Stimme wie die ihre immer wertvoll ist, jedoch unentbehrlich wird, wenn andere schweigen. Sie ist eine Stütze für jeden, der es wagt, den Mund aufzumachen. Denn wenn Maria, eine US-amerikanische Staatsbürgerin und Trägerin des Friedensnobelpreises, dafür eingesperrt werden kann, dass sie ihre Arbeit macht, welche Chance bleibt dann noch den anderen?
Autokratische Führer werden oft als der »starke Mann« tituliert und dargestellt. Welche Ironie, wo sie doch in Wirklichkeit zu schwach sind, um Widerspruch zu ertragen oder auch nur bereit wären, mit fairen Mitteln zu kämpfen! Wir sollten die Größe und Stärke derjenigen rühmen, die sich ihnen entgegenstellen – und manche von ihnen sind gerade mal 1,58 Meter groß.
Elie Wiesel warnte uns, es könnte Zeiten geben, in denen wir nicht die Macht haben, Ungerechtigkeit zu verhindern, aber es darf niemals eine Zeit geben, in der wir aufhören, dagegen zu protestieren. Marias Vermächtnis wird viele Generationen prägen – weil sie niemals versäumte, ihre Stimme des Protests zu erheben und zu versuchen, den Lauf der Geschichte in Richtung der Gerechtigkeit zu wenden. Und junge Philippiner und Philippinerinnen, die Geschichte studieren, werden erkennen, dass die erste Person aus ihrem Land, die jemals mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, eine mutige Journalistin war, unbeirrt und entschlossen, die Wahrheit auszusprechen. Möge ihnen Marias Vorbild als Inspiration dienen – um der kommenden Generationen willen.
Prolog■ ■ ■Die unsichtbare AtombombeLeben im (gegenwärtigen) Augenblick (der Vergangenheit)
Seit Beginn des Corona-Lockdowns im März 2020 bin ich viel emotionaler als je zuvor in meinem Leben. Ich spüre die aufgestaute Wut über die Ungerechtigkeit, die ich zwangsläufig hinnehmen muss. Das ist es, was sechs Jahre der Angriffe durch die Regierung bei mir bewirkt haben.
Vielleicht muss ich ins Gefängnis. Für den Rest meines Lebens – oder, wie mir mein Anwalt sagt, für mehr als hundert Jahre. Aufgrund von Anschuldigungen, die nicht einmal vor Gericht gebracht wurden. Der Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit ist global, aber für mich ist er inzwischen auch eine persönliche Angelegenheit. In weniger als zwei Jahren hat die philippinische Regierung zehn Haftbefehle gegen mich ausgestellt.
Ich könnte auch zum Ziel eines Anschlags werden. Wäre die Polizei, wäre meine Regierung so dumm, mich ins Visier zu nehmen? Leider ja. Die philippinische Menschenrechtskommission schätzte Ende 2018, dass seit dem Amtsantritt des damaligen Präsidenten Rodrigo Duterte im Jahr 2016 etwa 27.000 Menschen im Zuge des brutalen »Kriegs gegen die Drogen« getötet wurden.1 Stimmt das? Wer weiß das schon. Diese Statistik ist das erste Opfer im Kampf um die Wahrheit in meinem Land. Seit 2018 trage ich eine kugelsichere Weste, wenn ich unterwegs bin.
Online-Gewalt ist Gewalt in der realen Welt. Das haben viele Untersuchungen und zahlreiche tragische Ereignisse rund um den Globus bewiesen. Wie Tausende anderer Journalisten2, Aktivisten, Oppositionsführer und ahnungsloser Bürger hier und auf der ganzen Welt werde auch ich jeden Tag online angegriffen.
Doch wenn ich morgens aufwache und aus dem Fenster schaue, schöpfe ich neue Kraft. Ich habe Hoffnung. Ich sehe die Möglichkeit, dass dies trotz aller Finsternis auch eine Zeit ist, in der wir unsere Gesellschaften wieder aufbauen können. Wir sollten anfangen mit dem, was direkt vor uns liegt: unserem eigenen Einflussbereich.
Die Welt, die wir einst kannten, wurde stark erschüttert. Jetzt müssen wir entscheiden, was wir erschaffen wollen.
Ich heiße Maria Ressa und bin seit über sechsunddreißig Jahren als Journalistin tätig. Ich wurde auf den Philippinen geboren, wuchs in New Jersey auf und kehrte nach dem College Ende der 1980er-Jahre in mein Heimatland zurück. Meine berufliche Laufbahn begann ich bei CNN, für das ich in den 1990ern zwei Büros in Südostasien aufbaute und leitete. Es waren die glorreichen Jahre von CNN und eine berauschende Zeit für internationale Journalisten. Von meinem Sitz in Südostasien aus wurde ich Augenzeugin dramatischer Ereignisse, die oft Vorboten dessen waren, was später auf der ganzen Welt passierte: aufkommende demokratische Bewegungen in ehemaligen kolonialen Außenposten, der erschreckende Aufstieg des islamischen Terrorismus lange vor dem 11. September 2001, eine neue Klasse demokratisch gewählter Machthaber, die ihre Länder in Quasi-Diktaturen umwandelten, und das verblüffende Versprechen und die Macht der sozialen Medien, die bald eine entscheidende Rolle dabei spielten, dass alles niedergerissen wurde, was mir lieb und teuer war.
Im Jahr 2012 war ich Mitgründerin des philippinischen Online-Nachrichtenportals Rappler. Mein Ziel war es, in meinem Land einen neuen Standard für investigativen Journalismus zu schaffen, der die Plattformen der sozialen Medien nutzte, um Aktionsgemeinschaften für bessere Regierungsformen und stärkere Demokratien aufzubauen. Damals glaubte ich fest an die Macht der sozialen Medien, etwas Gutes in der Welt bewirken zu können. Mithilfe von Facebook und anderen Plattformen waren wir in der Lage, aktuelle Nachrichten zu sammeln, wichtige Quellen und Tipps zu finden, kollektives Handeln im Kampf gegen den Klimawandel und für eine gute Regierungsführung zu mobilisieren sowie das Wissen der Wähler und die Wahlbeteiligung zu verbessern. Wir waren schnell erfolgreich, doch im fünften Jahr des Bestehens von Rappler wurden wir nicht mehr für unsere Ideen gelobt, sondern gerieten ins Visier der Regierung – und das nur, weil wir weiterhin unserer Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten nachkamen: die Wahrheit zu sagen und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen.
Bei Rappler deckten wir Korruption und Manipulation nicht nur innerhalb der Regierung auf, sondern zunehmend auch in den Technologieunternehmen, die unser Leben bereits beherrschten. Von 2016 an zeigten wir auf, dass an zwei Fronten kriminelles Handeln straflos blieb: im sogenannten Krieg gegen die Drogen von Präsident Rodrigo Duterte und bei Mark Zuckerbergs Facebook.
Ich möchte im Folgenden darlegen, warum der Rest der Welt aufmerksam verfolgen sollte, was auf den Philippinen geschieht. 2021 war das sechste Jahr in Folge, in dem Philippiner von allen Bürgern dieser Welt die meiste Zeit im Internet und in den sozialen Medien verbrachten. Trotz des langsamen Internets wurden 2013 die meisten Videos auf YouTube weltweit von Philippinern hoch- und heruntergeladen. Vier Jahre später waren 97 Prozent der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes auf Facebook. Als ich Mark Zuckerberg 2017 auf einer Konferenz diese Statistik nannte, war er einen Moment lang still. »Moment mal, Maria«, antwortete er schließlich und sah mich direkt an. »Wo sind die anderen drei Prozent?«
Damals lachte ich über seine schlagfertige Bemerkung. Heute ist mir das Lachen vergangen.
Wie diese Zahlen zeigen (und Facebook bestätigt), sind die Philippinen der Ground Zero für die folgenschweren Auswirkungen, die soziale Medien auf die Institutionen eines Landes, seine Kultur und das Denken seiner Bevölkerung haben können.3 Jede Entwicklung, die in meinem Land stattfindet, erreicht irgendwann auch den Rest der Welt – wenn nicht morgen, dann in ein oder zwei Jahren. Bereits 2015 gab es Berichte über regelrechte Account-Farmen, die von den Philippinen aus telefonverifizierte Social-Media-Accounts (phone-verified accounts, kurz: PVAs) erstellten. Im selben Jahr zeigte ein Bericht, dass die meisten Facebook-Likes von Donald Trump außerhalb der Vereinigten Staaten geklickt wurden und dass einer von siebenundzwanzig Trump-Followern auf den Philippinen lebte.
An manchen Tagen fühle ich mich wie Sisyphus und Kassandra in Personalunion, in meinem Versuch, die Welt immer wieder vor den Auswirkungen der sozialen Medien auf unsere gemeinsame Realität zu warnen, den Ort, an dem Demokratie stattfindet.
Dieses Buch ist mein Ansatz dazu aufzuzeigen, wie verheerend das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit in der virtuellen Welt ist. Es gibt nur eine Realität, und der weltweite Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit wurde durch das Fehlen einer demokratischen Vision für das Internet im 21. Jahrhundert eingeleitet. Mangelnde Strafverfolgung im Internet führte logischerweise zu ihrem Pendant in der Offline-Welt, wodurch die bestehenden Kontrollinstanzen ausgehebelt wurden. Was ich in den letzten zehn Jahren beobachtet und dokumentiert habe, ist der Aufstieg einer fast gottgleichen Macht der Technologie, die ermöglicht, dass ein Lügenvirus jeden von uns infiziert, uns gegeneinander ausspielt, Ängste, Wut und Hass schürt und den Aufstieg autoritärer Machthaber und Diktatoren in aller Welt beschleunigt.
Ich nannte es den »Tod der Demokratie durch tausend Schnitte«. Gerade die Plattformen, die für uns wichtige Nachrichten liefern, enthalten uns Tatsachen vor. Schon 2018 zeigten Studien, dass sich Lügen, die mit Wut und Hass verbunden sind, schneller und weiter verbreiten als Fakten.4 Ohne Fakten aber gibt es keine Wahrheit. Ohne Wahrheit gibt es kein Vertrauen. Ohne alle drei haben wir kein gemeinsames Verständnis von Realität, und die Demokratie, wie wir sie kennen, wird sterben – und mit ihr alle bedeutsamen menschlichen Bestrebungen.
Ehe es so weit kommt, müssen wir handeln. In diesem Buch möchte ich nicht nur die Werte und Grundsätze des Journalismus und der Technologie erkunden, sondern auch der kollektiven Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um den Kampf um die Wahrheit zu gewinnen. Diese Entdeckungsreise ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Deshalb gibt es in jedem Kapitel einen Mikro- und einen Makroteil: eine individuelle Lektion und das große Ganze. Sie werden erkennen, dass ich häufig an einfachen Gedanken festhalte, um Entscheidungen zu treffen, die im Laufe der Zeit instinktiv, aber gleichermaßen wohlüberlegt gefällt worden sind, während sich immer neue Erfahrungen gegenwärtiger Augenblicke der Vergangenheit überlagern.
Im Jahr 2021 wurde ich als eine von zwei Journalisten mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das letzte Mal, dass ein Journalist diesen Preis erhalten hatte, war im Jahr 1935. Der Preisträger, ein deutscher Reporter namens Carl von Ossietzky, konnte die Auszeichnung damals nicht entgegennehmen, weil er in einem Konzentrationslager der Nazis gefangen war. Indem das norwegische Nobelpreiskomitee mir und dem Russen Dmitrij Muratow diese Ehre zuteilwerden ließ, signalisierte es, dass sich die Welt an einem ähnlichen historischen Wendepunkt befand, einem weiteren für die Demokratie existenziellen Punkt. In meiner Nobelpreisrede5 sagte ich, dass in unserem Informationsökosystem eine unsichtbare Atombombe explodiert sei, und damit meine ich die Technologieplattformen, die der geopolitischen Macht die Möglichkeit geben, jeden Einzelnen von uns zu manipulieren.
Nur vier Monate nach der Nobelpreisverleihung marschierte Russland in die Ukraine ein – und nutzte dabei Metanarrative, die es seit 2014 über Online-Propaganda6 verbreitet hatte, als es die Krim überfallen, annektiert und dort einen Marionettenstaat errichtet hatte. Die Taktik? Informationen unterdrücken und sie dann durch Lügen ersetzen. Indem sie mit ihrer kostengünstigen digitalen Armee brutal gegen die Tatsachen vorgingen, löschten die Russen die Wahrheit aus und ersetzten das zum Schweigen gebrachte Narrativ durch ihr eigenes – nämlich, dass sich die Krim willentlich der russischen Kontrolle unterworfen habe. Die Russen erstellten gefälschte Online-Konten, setzten Bot-Armeen ein und nutzten die Schwachstellen der Social-Media-Plattformen, um echte Menschen zu täuschen. Für die in amerikanischem Besitz befindlichen Plattformen, die neuen Informationshüter der Welt, führte all dies zu erhöhter Aktivität und brachte somit mehr Geld ein. Die Ziele der Gatekeeper und der Desinformanten stimmten somit überein.
Damals erkannten wir erstmalig die Taktiken der Informationskriegsführung, die schon bald weltweit zum Einsatz kommen sollten. Acht Jahre später, am 24. Februar 2022, überfiel Wladimir Putin mit denselben Techniken und denselben Metanarrativen, die er bei der Annexion der Krim angewandt hatte, die Ukraine. So kann Desinformation, von unten nach oben und von oben nach unten, eine völlig neue Realität schaffen.
Weniger als drei Monate später stürzten die Philippinen in den Abgrund. Der 9. Mai 2022 war der Wahltag, an dem mein Land einen Nachfolger für Duterte wählte. Obwohl es zehn Präsidentschaftskandidaten gab, waren nur zwei von Bedeutung: die Oppositionsführerin und Vizepräsidentin Leni Robredo und Ferdinand Marcos jr., der einzige Sohn und Namensvetter des Diktators Ferdinand Marcos, der 1972 das Kriegsrecht verhängt hatte und fast einundzwanzig Jahre lang an der Macht geblieben war. Der Kleptokrat Marcos wurde beschuldigt, seinem Volk zehn Milliarden Dollar gestohlen zu haben, bevor er schließlich 1986 durch die Volksrevolution gestürzt wurde.
An diesem Abend übernahm Marcos jr. eine frühe souveräne Führung in den Wahlergebnissen und gab diese nicht mehr ab. Nach den auf rappler.com7 verfügbaren Ergebnissen hatte Marcos um 20:37 Uhr, als 46,93 Prozent der Wahlbezirke ausgezählt worden waren, 15,3 Millionen Stimmen im Vergleich zu Robredos 7,3 Millionen erzielt. Um 20:53 Uhr, bei einer Stimmenauszählung von 53,5 Prozent, lag Marcos bei 17,5 Millionen und Robredo bei 8,3 Millionen; um 21:00 Uhr, bei einer Auszählung von 57,76 Prozent, lag Marcos bei 18,98 Millionen und Robredo bei 8,98 Millionen Stimmen.
Das war’s dann wohl, sagte ich mir an jenem Abend. Die Wahl erwies sich als Schaufenster für die Auswirkungen permanenter Desinformationskampagnen in den sozialen Medien, die von 2014 bis 2022 das Vermächtnis und den Familiennamen von Marcos’ Vater reingewaschen hatten, der nun als strahlender Volksheld dastand. Die Desinformationsnetzwerke stammten nicht nur von den Philippinen, sondern umfassten auch globale Netzwerke, wie ein von Facebook 2020 abgeschaltetes Netzwerk aus China,8 das dazu beigetragen hatte, die Geschichte vor unseren Augen umzuschreiben.
Schon in meiner Rede zum Friedensnobelpreis Ende 2021 hatte ich wiederholt erklärt, dass der Wahlsieger nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Vergangenheit bestimmen würde. Ohne Fakten sind freie Wahlentscheidungen nicht möglich.
Die Fakten haben verloren. Die Geschichte hat verloren. Marcos hat gewonnen.
Verglichen mit anderen, die untergetaucht, im Exil oder im Gefängnis sind, habe ich Glück. Die einzige Verteidigung, über die ein Journalist verfügt, besteht darin, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Lüge zu entlarven – und das kann ich immer noch tun. Unzählige andere, von denen man nie erfährt, haben weder die Möglichkeit, sich zu äußern, noch werden sie unterstützt. Sie werden verfolgt von Regierungen, die weiterhin ungestraft ihr Unwesen treiben. Ihr Komplize ist die Technologie, die stille nukleare Katastrophe, die sich in unserem Informationsökosystem ereignet hat, und genau wie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg muss die Welt neue Institutionen und Abkommen schaffen, um uns zu schützen – Institutionen und Abkommen wie Bretton Woods, die NATO, die Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Heute brauchen wir neue globale Institutionen und eine Wiederbelebung der Werte, die uns wichtig sind.
Gegenwärtig stehen wir vor den Trümmern der Welt, wie sie einmal war, und müssen den Weitblick und den Mut aufbringen, uns die kommende Welt so vorzustellen und zu gestalten, wie sie sein sollte: mitfühlender, gerechter, nachhaltiger. Eine Welt, die sicher ist vor Faschisten und Tyrannen.
Dies ist meine Reise dorthin, aber es geht auch um Sie, liebe Leserinnen und Leser.
Demokratie ist fragil. Man muss um jedes bisschen kämpfen, um jedes Gesetz, jeden Schutzmechanismus, jede Institution, jede Geschichte. Man sollte nicht aus den Augen verlieren, wie gefährlich selbst die kleinste Verletzung sein kann. Deshalb sage ich zu uns allen: Wir müssen standhaft bleiben.
Das ist es, was viele Bewohner der westlichen Welt, denen die Demokratie als gegeben erscheint, von uns, von den Philippinen, lernen müssen. Dieses Buch richtet sich an alle, die Demokratie für etwas Selbstverständliches halten, geschrieben von jemandem, der dies niemals tun würde.
Wie Sie denken und handeln, ist wichtig in diesem gegenwärtigen Augenblick der Vergangenheit, in dem die Erinnerung so leicht verändert werden kann. Bitte stellen Sie sich dieselbe Frage, mit der mein Team und ich uns jeden Tag auseinandersetzen: Was sind Sie bereit, für die Wahrheit zu opfern?
TEIL IHeimkehr:Macht, die Presseund die Philippinen1963–2004
Kapitel 1■ ■ ■Die goldene RegelIch entscheide mich fürs Lernen
Schulfoto als Drittklässlerin am St. Scholastica’s College, 1973.
Man weiß nicht, wer man ist, bis man darum kämpfen muss.
Wie entscheidet man, wofür man kämpfen soll? Manchmal ist das keine eigene Entscheidung. Man gerät im Laufe des Lebens hinein, weil die Summe der getroffenen Entscheidungen einen an diesen Punkt bringt. Wer Glück hat, erkennt schon früh, dass jede Entscheidung, die sie oder er trifft, eine Antwort auf die Frage darstellt, mit der wir uns alle herumschlagen: Wie können wir unserem Leben einen Sinn geben? Sinn ist nicht etwas, über das man zufällig stolpert oder das einem jemand gibt; man schafft ihn durch jede Wahl, die man trifft, die Verpflichtungen, die man eingeht, die Menschen, die man liebt, und die Werte, die einem wichtig sind.
Mein eigenes Leben kann ich in Abschnitte von jeweils zehn Jahren unterteilen: Als ich zehn war, änderte sich mein Leben dramatisch; das folgende Jahrzehnt stand ganz im Zeichen der Entdeckung und Erforschung. In meinen Zwanzigern drehte sich alles um Entscheidungen: was ich nach dem College machen wollte, wo ich leben, für wen ich arbeiten, wen und wie ich lieben wollte. In meinen Dreißigern ging es um die Aneignung von Fachwissen in dem Bereich, der meine Berufung werden sollte – dem Journalismus – und um die damit verbundene Suche nach Gerechtigkeit. Harte Arbeit war ein ständiges Thema, das Einzige, von dem ich wusste, dass ich es steuern konnte.
Dann kamen meine Vierziger, meine »Master of the Universe«-Phase und meine selbst auferlegte Deadline, bis zu der ich mich endlich für einen Wohnsitz entscheiden und mich zu den Philippinen bekennen sollte. In meinen Fünfzigern geht es nun um Neuerfindung und Aktivismus: Ich beziehe Stellung zu meinen tiefsten Überzeugungen. Gegen die Morde und den schamlosen Machtmissbrauch, gegen die dunklen Seiten der Technik. Und ich bekenne mich zu meinen politischen Ansichten und meiner Sexualität.
Ich wurde am 2. Oktober 1963 in einem Holzhaus in Pasay City, einem Teil der Hauptstadtregion Metro Manila, auf den Philippinen geboren, einem weitläufigen Archipel mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen, die durch die katholische Kirche miteinander verbunden sind. Die Philippinen waren eine feudale Gesellschaft, beherrscht von Oligarchen, die ihr Land während der jahrhundertelangen spanischen Kolonialherrschaft erhalten hatten. Nach dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges im Jahr 1898 übergab Spanien die Philippinen im Rahmen des Pariser Vertrags an die Vereinigten Staaten. Ein Jahr später, so sagen die Philippiner, begann der Philippinisch-Amerikanische Krieg, der in den US-amerikanischen Geschichtsbüchern lange Zeit nur eine Fußnote blieb und als »Aufstand« bezeichnet wurde.9 Es war die Zeit der »Manifest Destiny«-Ideologie in den Vereinigten Staaten. Rudyard Kipling schrieb sein berühmtes imperialistisches Gedicht »Die Bürde des Weißen Mannes«, um die Amerikaner 1899 zu ermutigen, die Philippinen zu besetzen. Sie blieben bis 1935, als die Philippinen ein selbstverwaltetes Commonwealth wurden. Die Verfassung, die von US-Präsident Franklin D. Roosevelt genehmigt werden musste, war praktisch eine Neuauflage der US-Verfassung.
Im Jahr 1964 starb mein Vater Manuel Phil Aycardo bei einem Autounfall. Er war damals gerade zwanzig. Ich war ein Jahr alt, und meine Mutter, Hermelina, war mit meiner Schwester Mary Jane schwanger.
Meine Mutter brachte uns von der Familie meines Vaters weg. Meine Schwester und ich lebten in einem halb fertigen Haus mit meiner Mutter und meiner Urgroßmutter, die zwar nach Alkohol stank, sich aber um uns kümmerte. Wir waren so arm, dass wir uns die Zähne mit Salz putzten und uns ständig Sorgen machten, woher die nächste Mahlzeit kommen würde. Wenn meine Mutter, die beim Arbeitsministerium tätig war und dessen gelbe Uniform trug, am Zahltag mit einer Schachtel von Kentucky Fried Chicken nach Hause kam, war das für uns etwas Besonderes.
Als ich fünf war, flammte ein alter Familienstreit erneut auf, und meine Mutter ging in die Vereinigten Staaten, zu ihrer eigenen Mutter, die kurz zuvor nach New York City gezogen war. Meine Mutter war 25 Jahre alt, als sie am 28. April 1969 in San Francisco eintraf.
Meine Schwester und ich zogen bei den Eltern meines Vaters in der Times Street in Quezon City in der Metro Manila ein. Es war ein ruhiges, bescheidenes Mittelklasse-Viertel mit Vorgärten vor den Häusern.
Meine Großmutter väterlicherseits, Rosario Sunico, war tief religiös und vermittelte mir ihre Werte. Sie erzählte mir Geschichten über meinen Vater: jung, intelligent, ein guter Pianist aus einer Musikerfamilie. Sie lehrte mich, in der Schule hart zu arbeiten, und erzog mich dazu, geduldig auf den Lohn für meine Mühen zu warten: Die Münzen, die ich mir von meinem Essensgeld absparte, steckte ich in eine Flasche, die sich nach und nach füllte. Meine Großmutter versuchte auch, meine Ansichten zu beeinflussen; sie erzählte mir, dass meine Mutter nichts tauge und dass sie in die Vereinigten Staaten gegangen sei, um sich zu prostituieren.
Das war für mich als Tochter nicht leicht zu verarbeiten, vor allem, weil meine Mutter in regelmäßigen Abständen zu Besuch kam. Mindestens einmal im Jahr war sie bei uns zu Gast, und das stellte den gesamten Haushalt auf den Kopf. Obwohl ich noch sehr jung war, konnte ich die Spannungen zwischen meiner Mutter und meiner Großmutter spüren. Es war ein unterschwelliger Streit, der mich oft zwang, Stellung zu beziehen.
In meinem Kopf flackern schwarz-weiße Erinnerungen an diese Besuche auf: Als ich etwa sieben oder acht Jahre alt war, saß ich mit meiner Mutter und meiner Schwester auf einem Bett. Meine Mutter war in meiner Wahrnehmung geradezu überirdisch: zierlich, schön, immer zum Lachen aufgelegt. Einmal unterhielt sie sich gerade mit meiner Schwester, als mir ein neues Wort einfiel, mit dem ich angeben wollte. Ich wartete auf den richtigen Moment und warf es dann ein.
»Unglaublich!«, rief ich. Es herrschte einen Moment lang Stille, bevor meine Mutter in Gelächter ausbrach. Dann umarmte sie mich.
Ich besuchte das St. Scholastica’s College, eine katholische Mädchenschule, gegründet und geleitet von deutschen Missions-Benediktinerinnen. Dort kam ich in eine spezielle Pilotklasse; meine Mitschülerinnen und ich schnitten in den Tests gut ab und galten daher als »klüger« als die anderen Kinder. Zumindest war es das, worüber meine Klassenkameradin Twink Macaraig und ich immer lachten.
Das endete mit dem Tag, an dem meine Mutter meine Schwester und mich aus der Schule entführte.
Es schien ein Tag wie jeder andere, als ich das Klassenzimmer betrat. Grelle Sonnenstrahlen fielen durch die Fenster. Ich stellte meine Schultasche ab und klappte den Deckel meines Holzpults hoch. Dann hörte ich eine Stimme meinen Namen rufen. »Mary Ann!«
Nur meine Familie nannte mich so – eine Verkürzung meiner beiden Vornamen, Maria Angelita. Ich drehte mich erschrocken um und sah meine Mutter mit der Schulleiterin, Schwester Gracia, vor dem Klassenzimmer stehen. Sie kamen zu meinem Pult und halfen mir, alles wieder in meine Tasche zu packen. Als wir hinausgingen, blickte ich mich noch einmal nach meinen Freunden um, die mich anstarrten.
Wir gingen weiter zum Klassenzimmer meiner Schwester. Sie wartete schon vor der Tür mit der Schwester meiner Mutter, Mencie Millonado, und einer weiteren Ordenslehrerin. Als sie unsere Mutter sah, rannte Mary Jane los, um sie zu umarmen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir allein auf dem Flur. Mary Jane und Mom weinten beide. Dann hörte ich, wie meine Mutter leise vor sich hin murmelte, dass sie uns nach Amerika mitnehmen wolle.
Ich erinnere mich, dass ich mich in diesem Augenblick in der Schule umsah und instinktiv wusste, dass nichts mehr so sein würde wie bisher. In solchen Situationen sucht man nach Ankern. Meiner war das Bibliotheksbuch in meiner Tasche, das ich am selben Tag hätte zurückgeben müssen.
Als wir zum Tor gingen, erzählte ich meiner Mutter von dem Buch. Sie antwortete, dass wir es an einem anderen Tag zurückbringen würden.
Ein Auto war am Bürgersteig geparkt worden, und wir stiegen ein. Sobald wir auf die Sitze geklettert waren, stellte uns meine Mutter den Mann auf dem Beifahrersitz vor. »Mary Ann, Mary Jane«, sagte sie, »das ist euer neuer Vater.«
In einem einzigen Augenblick kann sich alles verändern.
Ich kehrte an jenem Tag nicht mehr ins Haus meiner Großeltern oder in die Schule zurück. An einem Tag waren sie meine Welt. Am nächsten Tag waren sie es nicht mehr. Die Tür zu jener Welt war für immer geschlossen, und eine neue Realität öffnete sich. Ich war zehn Jahre alt.
Etwa zwei Wochen später befanden wir uns in einem Flugzeug der Northwest Airlines mit einer Zwischenlandung in Alaska. Es war der 5. Dezember 1973. Ich starrte aus dem Flugzeugfenster und nahm mir vor, das Datum nicht zu vergessen. Ich wusste nicht, was als Nächstes geschehen würde, aber es war das erste Mal, dass Mary Jane und ich Schnee sahen.
Als wir auf dem John F. Kennedy International Airport in New York landeten, war es dunkel und eiskalt – eine Kälte, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Mein Stiefvater nahm unsere Koffer. Ich überlegte immer noch, wie ich ihn anreden sollte, obwohl meine Mutter sagte, ich solle ihn Daddy nennen, und meine Tante Mencie meinte: »Versuch es mit Daddy Ressa.« Als wir noch in Manila gewesen waren, hatte jemand um ein Foto mit ihm gebeten. »Sie glauben, er ist Elvis Presley«, hatte Mom geflüstert.
Auf dem Flughafenparkplatz stiegen wir in einen dunkelblauen VW Käfer und fuhren etwa anderthalb Stunden in Richtung Süden. Die Heizung im Auto war für meine Schwester und mich etwas Neues. Nach einer Reise, die mehr als vierundzwanzig Stunden zuvor am anderen Ende der Welt begonnen hatte, erreichten wir unser Ziel, ein Vorstadthaus in der Neubausiedlung Toms River, New Jersey. Wir luden unser Gepäck aus. Im dünnen Schnee auf der Einfahrt hinterließ ich eine deutlich sichtbare Fußspur. Dann betraten meine Schwester und ich unser neues Zuhause. Mein neuer Vater und meine Mutter erklärten uns später, dass er die Adoption beantragen und unseren Nachnamen formell in Ressa ändern lassen wolle.
Ich hatte ein Land in Aufruhr hinter mir gelassen. Etwas mehr als ein Jahr zuvor, am 21. September 1972, hatte Präsident Ferdinand Marcos das Kriegsrecht verhängt und den größten Fernsehsender, ABS-CBN, der immer ein Zentrum der Medienmacht gewesen war, geschlossen. Marcos’ Ein-Mann-Herrschaft sollte eine neue Ära für die Philippinen einläuten, die bis dahin übermächtig von den Vereinigten Staaten geprägt worden waren. »Die territoriale Eroberung begann und endete auf den Philippinen«, schrieb mein Freund Stanley Karnow in seinem Epos In Our Image: America’s Empire in the Philippines. »Die Amerikaner versäumten es, eine funktionierende und unparteiische Verwaltung aufzubauen … also wandten sich die Philippiner an Politiker statt an die Bürokratie, wenn sie Hilfe brauchten, eine Praxis, die Vetternwirtschaft und Korruption förderte.«10
Feudale Vetternwirtschaft und endemische Korruption sollten auf den Philippinen nie ganz verschwinden. Marcos, der 1965 inmitten schwerwiegender wirtschaftlicher Probleme erstmals gewählt wurde, war der erste und einzige philippinische Präsident, der für eine zweite Amtszeit wiedergewählt wurde. Im Wahlkampf warb er mit nationaler Identität und Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten.
Nachdem Marcos das Kriegsrecht verhängt hatte, ratifizierte der Kongress die Verfassung von 1973, die immer noch der US-Verfassung nachempfunden war, nun allerdings mit Überarbeitungen, die Marcos’ Macht sicherten. Diese wurde später vom Obersten Gerichtshof gebilligt und ermöglichte es Marcos, seine Macht für die nächsten vierzehn Jahre »legal« zu festigen und zu erhalten – Jahre, die ich in meiner neuen Realität in den Vereinigten Staaten verbrachte.
Unsere Familie glaubte an Amerika: Man arbeitete hart, zahlte seine Steuern und bekam, was man verdiente. Die Welt ist gerecht – das war es, was der Gesellschaftsvertrag implizit bot. Meine Eltern haben die Erosion dieses Vertrags über Jahrzehnte miterlebt. Ich weiß, was das mit den Menschen macht, wie Unsicherheit und Angst wachsen, wie diejenigen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten, sich betrogen fühlen, wenn Versprechen gebrochen werden. Wenn dann noch die sozialen Medien und Informationskampagnen hinzukommen, werden genau diese Menschen empfänglich für Lügen.
Peter Ressa bei einer Verabredung mit Hermelina Delfin vor der Freiheitsstatue, 1971.
Peter Ames Ressa wurde in New York City geboren und gehört zur zweiten Generation von Italo-Amerikanern. Mit sechzehn brach er die Schule ab, um seiner Familie zu helfen, über die Runden zu kommen, und trat später eine Stelle als Datenerfasser bei der Investmentbank Brown Brothers Harriman & Co. an, wo er sich mühsam die Karriereleiter hinaufarbeitete. Als er das Unternehmen verließ, war er leitender IT-Manager für Großrechner. Dann ging er zu IBM. Harte Arbeit trieb ihn an, ebenso wie die außergewöhnliche Fähigkeit, sich an kleinste Details zu erinnern.
Er und meine Mutter waren sich auf den Straßen von New York City (buchstäblich) über den Weg gelaufen. Nach zweijähriger Beziehung heirateten sie 1972, und im folgenden Jahr wurde meine Schwester Michelle geboren. Nur eine Woche später baten meine Eltern meine Tante Annie, sich um ihr neues Baby zu kümmern, und flogen nach Manila, um Mary Jane und mich abzuholen. Für meine Mutter war es eine schwierige und zugleich siegreiche Reise.
Peter und Hermelina waren ein eindrucksvolles Paar, was all ihren Kindern bewusst war – als stünden die Eltern die ganze Zeit im Rampenlicht. In jenen Jahren sah ich die Vereinigten Staaten vor allem durch die Linse dieser hart arbeitenden, glanzvollen Figuren: Sie verließen das Haus vor Sonnenaufgang, pendelten zwei Stunden zu ihren Jobs in New York City und kehrten erst nach Einbruch der Dunkelheit zurück; sie arbeiteten rund um die Uhr.
Um Geld zu sparen, fing meine Mutter irgendwann an, unsere Kleidung selbst zu nähen, stellte dann aber fest, dass der damit verbundene Zeitaufwand das gesparte Geld nicht wirklich wert war. Als mein Bruder Peter Ames jr. und ihre Jüngste, Nicole, zur Welt kamen, führte ich die Einkaufstouren für den Schulanfang hinter meiner Mutter an und schob jeden August bei Grand Union, Sears und anderen Schnäppchenläden den Einkaufswagen. Ich wusste, wie man die billigsten Kleider und Schuhe aussuchte.
Während dieser Zeit bezahlte die Firma meines Vaters seine Weiterbildung und ermöglichte ihm so, die Highschool abzuschließen. Als ich zur Highschool ging, besuchte er abends das College. Erst später wurde mir klar, wie viel meine Eltern geopfert hatten, um ihren Kindern eine Chance zu geben. Sie wollten, dass wir ein gutes Leben hatten und gute Schulen besuchten – und so war es auch.
Als ich das Klassenzimmer meiner dritten Klasse in der weitläufigen, aus rotem Backstein errichteten Silver Bay Elementary School betrat, war ich mit meinen 1,20 Metern das kleinste Kind – und das einzige mit brauner Hautfarbe. Obwohl ich Englisch verstand und sprechen konnte, war meine Hauptsprache zu Hause Tagalog, also Filipino. Ich staunte über das laute, selbstbewusste Auftreten meiner Klassenkameraden und war schockiert darüber, wie unhöflich sie gegenüber unserer Lehrerin waren.
Ich war froh zu sehen, dass die Schule, wie schon St. Scholastica’s auf den Philippinen, das SRA Reading Lab einsetzte, eines der ersten personalisierten Lernprogramme für Lesen, Schreiben und Verstehen, das es den Schülern ermöglichte, in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Ich trat gern gegen mich selbst und meine Klassenkameraden an und war in St. Scholastica’s recht gut vorangekommen. Als ich in den hinteren Teil meines neuen Klassenzimmers ging, um meine SRA-Leseverständniskarte zu holen, mit der unsere Fortschritte erfasst wurden, verkündete eines der größten und lautesten Kinder dem Rest der Klasse, dass man für mich die Schachtel mit einem ganz neuen Lernabschnitt öffnete, den noch kein anderer Schüler bearbeitete. Da wusste jeder, dass ich fortgeschritten war.
Ich bin von Natur aus schüchtern, ein introvertierter Mensch. Der Übergang zum amerikanischen Leben war für mich so einschneidend, dass ich fast ein Jahr lang nicht sprach, wie meine Lehrer später erzählten. Ich erinnere mich an mein Schweigen als Lernen, als Fortsetzung der »Sprich, wenn du angesprochen wirst«-Mentalität meiner Erziehung und Schulzeit auf den Philippinen. Dabei saugte ich meine neue Welt auf wie ein Schwamm.
Irgendwie erkannten die Lehrkräfte der Silver Bay Elementary School den Grund für mein Schweigen und halfen mir, mich anzupassen. Eine Lehrerin, Mrs. Rarick, erteilte mir jede Woche kostenlos Klavierunterricht, was mir Halt gab. Meine Großmutter hatte immer betont, dass mein Vater Klavier gespielt habe, dass sie einer Familie von Kunstmäzenen entstamme11 und dass mein Onkel Konzertpianist gewesen sei.12 Irgendwie übernimmt man die Träume, die in der Luft um einen herum schweben. Das Klavierspielen verband mich mit der Vergangenheit und gab mir ein Gefühl der Freiheit: Ich musste weder sprechen noch eine neue Sprache lernen. Alles, was ich tun musste, war zu üben, bis ich spielen und Musik erschaffen konnte. Ich begriff früh, dass man stundenlang üben muss, um wirklich gut zu spielen, damit man die Technik loslassen kann, wenn man auftritt. Wenn die Welt erdrückend wurde, lenkte ich meine Energie ins Klavierspielen.
Selbstverständlich wollte ich aber auch so sein wie alle anderen. Ich stand vor dem Spiegel, versuchte, englische Wörter richtig auszusprechen, und wünschte mir, ich hätte hellere Haut und blondes Haar. Wenn man nicht weiß, wer man ist, und die eigene Welt auf den Kopf gestellt wurde, will man nicht auffallen.
Aus dem Jahr, in dem ich in die Vereinigten Staaten zog, sind mir drei wichtige Erkenntnisse geblieben. Sie rücken in meinem Leben immer wieder in den Fokus, obwohl sich der Kontext laufend ändert. Jedes Mal gewinnen sie eine neue Bedeutung.
Die erste war die Entscheidung zu lernen. Das bedeutete, sich auf Veränderungen einzulassen und den Mut zum Scheitern aufzubringen; Erfolg und Scheitern sind zwei Seiten derselben Medaille. Man kann nicht erfolgreich sein, wenn man nicht irgendwann einmal versagt hat. Die meisten Menschen, so wurde mir klar, wählten die Bequemlichkeit und blieben bei dem, was ihnen vertraut war: alte Freunde, Routinen, Gewohnheiten.
Der Umzug in die Vereinigten Staaten stellte für mich alles infrage, was mich ausmachte. Was nehme ich mit? Was lasse ich zurück? Wer bin ich? Sogar mein Name war ein anderer: Als ich mein Klassenzimmer in Manila verlassen hatte, war ich Angelita Aycardo gewesen, und jetzt war ich Maria Ressa. Ich war in eine völlig neue Welt gezogen, mit einer neuen Sprache, neuen Sitten, neuen kulturellen Signalen, die alle außer mir verstanden. Es war so überwältigend, dass ich in jenem ersten Jahr irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen wollte.
Also konzentrierte ich mich auf das, was ich messen konnte: meine Fortschritte mit dem SRA Reading Lab und wie schnell ich Hanons Übungen für das Klavier durcharbeiten konnte. Vieles lernte ich aus Büchern, darunter auch, wie man Basketball spielt. An den Wochenenden nahm ich ein Buch mit zum Basketballplatz der Schule, legte es auf den Asphalt und befolgte Schritt für Schritt die Anweisungen, wie man einen Ball dribbelt, wie man einen Freiwurf ausführt. Alles, was ich lernte, setzte ich um. Ich brauchte nur zu üben.
Einige Monate, nachdem ich mich eingelebt hatte, fragte mich Miss Ugland,13 eine Lehrerin, die ich abgöttisch liebte, ob ich mir vorstellen könne, in ein anderes Klassenzimmer umzuziehen: Die Schule wolle mich in eine höhere Jahrgangsstufe versetzen. Ich fing gerade an, mich wohlzufühlen, und die mögliche Veränderung machte mir Angst. Da sagte sie zu mir: »Maria, hab keine Angst.« Also wurde ich Mitte des Jahres von der dritten in die vierte Klasse versetzt und fing wieder von vorne an – und gelangte zu meiner zweiten Erkenntnis: Man muss sich seiner Angst stellen.
Der Auslöser? Ich wusste nicht, was »Pyjamaparty« bedeutete. In Manila hatte es so etwas nicht gegeben, oder zumindest hatten wir es nicht so genannt. Doch ich bekam eine Einladung zu einer »Pyjamaparty« von Sharon Rokozny, dem coolsten Kind in meiner Klasse, und als ich meine Mutter fragte, was das für eine Party sei, antwortete sie: »Das ist eine Party, zu der man im Schlafanzug geht!« Das machte Sinn. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass Sharon mich eingeladen hatte.
Am verabredeten Tag zog ich meinen Schlafanzug an und stieg mit meinem Vater, meiner Mutter und meiner Schwester ins Auto. Als wir in die Sackgasse einbogen, wo Sharon wohnte, sah ich meine Klassenkameraden auf dem Rasen vor dem Haus Kickball spielen. Niemand trug einen Schlafanzug.
In Panik wandte ich mich an meine Mutter, die verlegen zugab, dass sie auch nicht so recht wisse, was eine »Pyjamaparty« eigentlich sei. Zu diesem Zeitpunkt hatten meine Klassenkameraden unser Auto bereits gesehen; wir konnten nicht mehr wegfahren. Als der Wagen hielt, warf ich meinen Eltern einen Blick zu, bevor ich die Tür öffnete. Dann stieg ich aus.
Meine Klassenkameraden hörten auf zu spielen und sahen mich an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Da kam Sharon zum Auto. »Oh, du hast deinen Pyjama an«, sagte sie.
»Ich dachte, wir sollten das tun«, murmelte ich am Rande der Tränen. Es hatte mich meinen ganzen Mut gekostet, aus dem Auto zu steigen, und jetzt hatte ich keinen mehr.
Sharon nahm meine Hand, schnappte meine Tasche und führte mich zum Haus. »Du kannst reingehen und dich umziehen«, sagte sie, während ich mir die Augen abwischte und meinen Eltern zuwinkte. Gut, dass ich Extrakleidung eingepackt hatte.
Wenn man ein Risiko eingeht, muss man darauf vertrauen, dass einem jemand zu Hilfe kommt; und wenn man selbst an der Reihe ist, hilft man jemand anderem. Es ist besser, sich seiner Angst zu stellen, als vor ihr wegzulaufen, denn durch Weglaufen verschwindet das Problem nicht. Wenn man sich der Angst stellt, hat man die Chance, sie zu besiegen. So begann ich, Mut zu definieren.
Meine dritte Erkenntnis war, dass man sich gegen Tyrannen auflehnen muss, was damals mit einer Vielzahl von Dingen verbunden war: Angst, Akzeptanz, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Beliebtheit. Da mir alles fremd war, blieb mir meist nichts anderes übrig, als still zu bleiben, zu beobachten und zu lernen. Weil ich mich ohnehin schon so sehr von den anderen unterschied, hatte ich viel weniger das Bedürfnis, mich anzupassen, und konnte mir den Luxus leisten, die Masse zu beobachten und zu verstehen, ohne jemals Teil von ihr zu sein.
In jenem Jahr hatte ich eine Klassenkameradin, die ich im Folgenden Debbie nennen will, ein ruhiges, schlichtes Mädchen, das verspottet wurde, weil es Polyesterhosen trug. Alle machten sich über Debbie lustig, obwohl ich nicht ganz verstand, warum. Ich wollte auf keinen Fall den Mund aufmachen und fragen – was wäre, wenn die Leute sich dann über mich lustig machen würden?
Heute habe ich eine Redewendung für diese Situation: Schweigen ist Mitschuld.
Ich spielte Geige, und Debbie spielte Bratsche. Eines Tages, nach unserer Schulorchesterprobe, sah ich Debbie in einer Ecke des Proberaums weinen. Mein Instinkt riet mir wegzugehen, denn wenn ich stehen bliebe, um sie zu fragen, was los sei, könnten die anderen dies bemerken und mich ebenfalls zur Zielscheibe machen. Keiner sprach mit Debbie, außer um sie zu hänseln. Dann erinnerte ich mich an die goldene Regel aus der Bibel: »Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die Propheten.«
Ich traf eine Entscheidung. Ich verließ den Proberaum, ging zur Toilette auf der anderen Seite des Flurs, holte ein Papiertuch, brachte es Debbie und fragte sie, was los sei. Sie erzählte mir, dass ihr Vater schon seit Monaten im Krankenhaus liege.
Das Gespräch mit ihr ermutigte mich, auch weiterhin mit ihr zu reden. Irgendwann lud ich sie ein, bei mir zu übernachten. Es stellte sich heraus, dass sie deshalb Polyesterhosen trug, weil ihre Familie Mühe hatte, über die Runden zu kommen, und die Hosen billig waren.
Danach begann ich, mich für Debbie einzusetzen. Als ihre ärgste Peinigerin im Orchester wieder einmal auf ihr herumhackte, sagte ich zu ihr, sie solle damit aufhören. Gerade als ich dachte, sie würde nun auf mich losgehen, kamen einige meiner Freunde zu Hilfe. Es braucht nur eine Person, die aufsteht und kämpft, denn ein Tyrann mag es nicht, wenn man ihn öffentlich herausfordert.
Das war eine frühe Erkenntnis, wie man sich gegen die Grausamkeit der Herdenmentalität zur Wehr setzt. Folgendes habe ich über Beliebtheit gelernt: Die Menschen mögen einen, wenn man ihnen gibt, was sie wollen. Die Frage ist: Ist es das, was man selbst will?
Das öffentliche Schulsystem von Toms River bot mir kostenlosen Musikunterricht, Programmierkurse und eine Teilnahme am Advanced Placement Program, dessen Kurse auf College-Niveau es mir ermöglichten, mich um eine Zulassung zu weiterführenden Eliteschulen zu bewerben – die Verheißung einer Zukunft, die versprach, dass man alles erreichen konnte, wenn man hart genug arbeitete. Als ich die Highschool abschloss, war ich drei Jahre lang Klassensprecherin gewesen und zur Schülerin mit den besten Karrierechancen gewählt worden. Da meine Eltern immerzu arbeiteten, verbrachte ich viel Zeit mit meinen Lehrern. Derjenige, der mir half, mich selbst zu finden, war Donald Spaulding, der Leiter der schulischen Sommerakademie für Streicher, ein stämmiger, aber flinker Mann mit Bart, der stets ein Lächeln auf den Lippen trug. Mr. Spaulding war nicht nur mein Geigenlehrer und Orchesterleiter; er half mir, bis zu acht verschiedene Instrumente zu lernen. Er förderte mich und andere wie mich: Kinder auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Er holte mich vom anderen Ende der Stadt ab, damit ich an Auftritten teilnehmen konnte. Wir spielten beim Sonntagsbrunch, im Ground Round, wo die Erdnussschalen auf dem Boden herumlagen, in unserem örtlichen Einkaufszentrum in Ocean County und im Six Flags Great Adventure, einem großen Abenteuerpark in New Jersey.14
Er trieb mich an, mich als Mensch und als Musiker zu verbessern. Keine Idee, die ich hatte, war zu weit hergeholt.
»Mr. Spaulding, wie wäre es, wenn wir ›The Devil Went Down to Georgia‹ spielten?«, fragte ich, nachdem ich ein Riff gehört hatte, das ich lernen wollte. Er überlegte kurz, nahm seine Geige heraus, holte leere Notenblätter hervor und begann, die Noten aufzuschreiben, damit ich folgen konnte.
»Warum nicht?«, lautete seine typische Antwort. Man soll sich immer für das Lernen entscheiden.
In Don Spauldings Umfeld erhielt man aber noch eine andere Lektion: dass niemand alleine etwas Bedeutendes erreichen kann. Das lernte ich im Orchester, in den Basketball- und Softballteams, bei den Theateraufführungen und in der Schülervertretung. Wie gut man als Teamplayer ist, hängt indes von den eigenen Fähigkeiten, dem eigenen Antrieb und der eigenen Ausdauer ab.
Ich liebte es, mich von der Musik mitreißen zu lassen. Ein Teil von mir lauschte und schwebte, ein anderer Teil zählte die Takte, beobachtete das Auf und Ab unserer Bögen, und ein dritter Teil war immer auf den Dirigenten konzentriert, bereit, ihm zu folgen und, als Konzertmeisterin, zu führen. Die Magie entstand, wenn die ganze Arbeit in den Hintergrund rückte und wir in der Musik lebten, die Töne spielten und gemeinsam Musik schufen. Um an diesen Punkt zu gelangen, waren viele Stunden des Übens erforderlich.
Später erkannte ich, dass ein Orchester die perfekte Metapher für eine funktionierende Demokratie ist: Die Musik gibt den Menschen die Noten, das System; aber wie man spielt, fühlt und folgt – und wie man führt –, das liegt ganz an einem selbst.
Um nicht als Nerd abgestempelt zu werden, trieb ich auch weiterhin Sport. Aber ich war ein totaler Nerd. Vor allem liebte ich Bücher, die mir alles erklärten, was andere Menschen nicht konnten – oder mir Fragen beantworteten, die ich nicht stellen konnte. Ich verschlang Liebesromane und Science-Fiction-Geschichten, die mich dazu anregten, mir andere Welten vorzustellen, etwa die von Isaac Asimov. Doch in erster Linie war ich vor allem eines: ein eingefleischter Trekkie.
Ich las sämtliche Star-Trek-Romanfassungen von James Blish und hatte zu Hause ein Regal, in dem ich sie sammelte. Die Bücher halfen mir, meinen eigenen Verstand zu begreifen. Manchmal war ich Captain Kirk, der Kommandeur, der auf seine Emotionen und sein Bauchgefühl hörte; manchmal war ich Mr. Spock, der logische Vulkanier, der Probleme dekonstruierte. Erst viel später erkannte ich, dass es sich dabei um zwei Seiten des Gehirns und der menschlichen Natur handelte – schnelles und langsames Denken, wie Daniel Kahneman es später formulierte. Wenn mich heute noch jemand fragt, wer meine Helden sind, verweise ich auf die Kombination von Mr. Spock und Captain Kirk: rationale, logische Analyse, ergänzt durch Empathie, Instinkt und Gefühle.
Erst später begriff ich, dass ich meine negativen Emotionen, etwa meine Wut, unterdrückte. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich eine Außenseiterin war, die zu verstehen versuchte, was vor sich ging, damit ich dazugehören könnte. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum die außerschulischen Aktivitäten, die ich wählte, irgendwie mit dem Land meiner Herkunft zu tun hatten. Ich spielte Basketball, die beliebteste Sportart auf den Philippinen, und trat der Schachmannschaft bei, weil dies irgendwo in meiner Erinnerung wichtige Teile einer Vergangenheit waren, in die ich nicht zurückkehren konnte und die ich noch nicht ganz verstanden hatte.
Als die Zeit für meine College-Bewerbung kam, traten manche dieser Gefühle offen zutage. In meinem Bewerbungsaufsatz schrieb ich, wie sehr ich es bedauerte, dass viele meiner Leistungen, vieles von dem, was ich geworden sei, lediglich widerspiegelten, was andere – Lehrer, meine Eltern – von mir erwarteten. Wenn es darauf ankam, schrieb ich glatte Einsen, aber trotzdem hatte ich stets das Gefühl, dass ein Teufel auf meiner Schulter saß, der mich dazu drängte, immer besser zu werden und noch mehr zu leisten, weitere Erfolge und Superlative anzuhäufen, weil ich andernfalls nicht dazugehörte.
Ich bewarb mich an 13 Colleges, darunter für sechsjährige Medizinstudiengänge, an Militärakademien und mehreren Elitehochschulen. Meine Eltern wollten, dass ich Ärztin würde. Ich dachte, ich brauchte Disziplin. Letztlich wusste ich nicht wirklich, wer ich war, aber tief in mir war ich überzeugt, dass ich etwas erreichen müsste. Etwas. Irgendetwas.
Ich wusste, dass dieser Drang in einem Gefühl der Unsicherheit wurzelte. Dennoch war ich pragmatisch. Auch wenn ich den Teufel auf meiner Schulter nicht verstand, wusste ich, dass es mir nur nutzen könnte, wenn ich lernte – und zwar über die normalen Schulbücher hinaus.
Ich dachte mir, man könne nichts falsch machen, wenn man sich fürs Lernen entschied.
Kapitel 2■ ■ ■Der EhrenkodexGrenzen ziehen
Um in Princeton aufgenommen zu werden, muss man sich zum Ehrenkodex bekennen.
Auf dem College begann ich selbstständig zu forschen und zu denken. Meine Schulbildung in Manila hatte den Schwerpunkt auf Auswendiglernen und Merkfähigkeit gelegt, darauf, die Regeln zu befolgen und nur zu sprechen, wenn man aufgefordert wird. In den Vereinigten Staaten hatte ich dies ebenfalls getan. Bis zum College.
Meine Wahl fiel auf die Princeton University. Mir gefiel der Gedanke, dass die Studierenden sogenannte Precept Classes (kleine Diskussionsgruppen) mit weltberühmten Professoren, sogar einem Nobelpreisträger, besuchen konnten. Außerdem lag die Universität nur etwa drei Autostunden von Toms River entfernt, sodass ich nicht allzu weit von zu Hause weg war. Ich verbrachte Stunden damit, über den wunderschönen Campus mit seinen geschichtsträchtigen Gebäuden zu spazieren und zu beobachten, wie sich die Blätter verfärbten. Oder ich saß in der Kapelle, wo ich zur Ruhe kam. Manchmal, wenn niemand in der Nähe war, blieb ich am imposanten Blair Arch stehen, um den Punkt in der Mitte zu finden, an dem mein Flüstern von den Wänden widerhallte. Spätabends, wenn ich von der Firestone Library nach Hause kam, hielt ich am 1899 Arch an, um den improvisierten Darbietungen unserer Gesangsgruppen zu lauschen, bevor ich zurück in meinen Schlafsaal ging und dort das letzte Lied anstimmte.
Ich hatte ein etwas über acht Quadratmeter großes Zimmer zugewiesen bekommen, das gerade genug Platz für ein Bett, eine Kommode und einen Schreibtisch hatte. Meine Mutter brachte mir eine riesige Statue der Jungfrau Maria mit, die sie auf meine Kommode stellte. Von dort blickte sie direkt auf mein Bett. Mir war gar nicht bewusst, wie seltsam das war – obwohl es kurz vor dem Schlafengehen für einige tolle Gespräche mit meinen Freunden sorgte.
Religion war für mich ein großes und schwieriges Thema. Die tiefe Religiosität meiner Großmutter hatte meiner Schwester und mir die kirchlichen Vorschriften eingebläut. Sie hatte verlangt, dass wir zweimal am Tag, morgens und abends, den Rosenkranz beteten und fast jeden Tag zur Messe gingen. In meinem ersten Studienjahr befasste ich mich mit den fünf großen Weltreligionen: Christentum, Buddhismus, Islam, Judentum und Hinduismus. Ich wollte meinen Glauben logisch definieren, aber natürlich gibt es nichts Logisches an der Religion. Eine Zeit lang überlegte ich, Buddhistin zu werden, doch dann gewann das tägliche Leben die Oberhand, und meine Überzeugungen vermischten sich mit meinen Studieninhalten.
Ich besuchte die vormedizinischen Kurse in Princeton und erfüllte in den ersten beiden Jahren sämtliche Anforderungen für das Medizinstudium. Ich erkannte, dass die Regeln der Wissenschaft, der Physik, philosophisch sind, wie die Gesetze der Thermodynamik – Entropie, Chaos, dass es Energie braucht, um Ordnung zu erhalten. Dasselbe gilt für die Newton’schen Axiome. Mein Favorit war das dritte und damit das Prinzip der Wechselwirkung: actio est reactio. Oder die Heisenbergsche Unschärferelation, die ich meinem ersten Buch voranstellte: dass der bloße Akt des Beobachtens das, was man beobachtet, verändert und dass das, wonach man sucht, umso unbestimmter wird, je tiefer man vordringt. Wer hat gesagt, dass Religion und Wissenschaft nicht Hand in Hand gehen können?
Was mich und mein Werteempfinden in dieser Zeit jedoch am meisten prägte, war der Ehrenkodex. Bei jeder Hausarbeit und jedem Test müssen die Schüler in Princeton niederschreiben: »Ich gelobe, dass ich bei dieser Prüfung nicht gegen den Ehrenkodex verstoßen habe.« Damit verbürgt man sich nicht nur für sein eigenes Verhalten, sondern auch für das aller anderen um einen herum. Sobald die Prüfungsaufgaben ausgeteilt sind, verlässt der Professor den Raum. Mit dem Versprechen verpflichtet man sich, alle, die man beim Schummeln beobachtet, zu melden, denn tut man das nicht, nimmt die eigene Ehre Schaden. Man ist also nicht nur für sich selbst verantwortlich, sondern auch für die Welt um einen herum, zumindest für den eigenen Einflussbereich.
Dieser Gedanke gefällt mir. Obwohl ich während meines Studiums nicht viel über das »Honor Pledge« in Princeton nachdachte, lebte ich es bereits. Erst später wurde mir klar, dass ich davon ausging, alle würden das Gleiche tun und Verantwortung für die Welt um sich herum übernehmen. Einige Verwandte und Freunde haben diesen Charakterzug von mir einmal als dogmatisch und elitär kritisiert, und ich kann einem damit durchaus auf den Nerv gehen, vermute ich. Doch der strenge Ehrenkodex vereinfachte die Welt für mich und half mir, schnelle Entscheidungen zu treffen.
Dieser Ehrenkodex ermöglichte es mir, meine Werte früh und klar zu definieren, noch bevor mich ein moralisches Dilemma dazu verleiten konnte, egoistisches, schlechtes Verhalten zu rationalisieren. Er half mir, später im Leben eine Situationsethik zu vermeiden. Es war ganz einfach. Ziehe eine Grenze: Auf der einen Seite bist du gut, auf der anderen böse.
In Princeton stellte sich heraus, dass ich mich eher für die Künste als für die Naturwissenschaften interessierte. Ich belegte ein übermäßiges Pensum an Kursen, damit ich all meine Leidenschaften unterbringen konnte: vergleichende Literatur, Shakespeare, Theater, Schauspiel, Dramaturgie, Psychologie, Geschichte. In diesen Fächern lernte ich, mit dem Stress des täglichen Lebens umzugehen und meine eigene Geschichte und Identität zu verstehen. Sie machten mir bewusst, wie sehr ich mein Außenseiterdasein gepflegt hatte, indem ich immer nach Perfektion gestrebt hatte, um das fehlende Zugehörigkeitsgefühl auszugleichen. Außerdem förderten sie meinen Forscherdrang, indem sie mich fragen ließen, warum wir auf diesem Planeten lebten und was ich hier eigentlich tun sollte.
Am meisten lernte ich vom Theater, selbst so einfache Dinge wie das Atmen: sich hinlegen, tief durchatmen, sich vorstellen, wie Luft und Energie ein- und ausströmen, sich im gegenwärtigen Moment zentrieren; den Geist und den Körper zusammenarbeiten lassen, um absolut präsent zu sein. Eine weitere Theaterübung war das sogenannte Spiegeln, bei dem sich zwei Personen gegenüberstehen und die Grenzen zwischen Führen, Folgen und künstlerischem Schaffen ausloten. Solche Übungen mögen simpel erscheinen, aber sie haben sich in einigen der schlimmsten Augenblicke meines Lebens als unglaublich nützlich erwiesen.
In einem dieser Theaterkurse protestierte ich gegen ein aus meiner Sicht unfaires Verhalten und knüpfte damit eine der wichtigsten Beziehungen meines Lebens.
Unter den Ersten, die ich in Princeton kennenlernte, war Leslie Tucker, eine hellhäutige Afroamerikanerin. Groß, hübsch und charmant, schien sie das Gegenteil von mir zu sein. Sie war witzig, eine geborene Geschichtenerzählerin, jemand, der auf natürliche Weise die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Außerdem war sie schonungslos ehrlich, bisweilen sogar gemein, was die Leute aber nicht beleidigte, sondern irgendwie dazu brachte, mit ihr zu lachen.
In unserem Dramaturgiekurs reichten wir jede Woche Szenen ein, die dann in der Gruppe diskutiert wurden. Leslie konnte stets erhellende Kommentare beisteuern. Ihr bester Freund war der gut aussehende Andrew Jarecki. Die beiden lachten ständig miteinander und machten sich, so stellte ich es mir jedenfalls vor, über andere lustig. Irgendwann gab es eine Phase, in der Leslie ihre Aufgaben nicht mehr erledigte und keine eigenen Szenen einreichte, aber immer noch an den Kritiken teilnahm. Eines Tages hatte ich genug.
Unsere Stühle standen im Kreis, und Leslie übte ihre typische Kritik, die zwar unverblümt war, unsere Professoren aber stets erfreute.
»Entschuldigung«, unterbrach ich sie. »Wir haben noch keine Szene von dir gelesen, Leslie.«
Verblüfftes Schweigen herrschte, auch bei mir. Ich hatte es tatsächlich laut ausgesprochen.
Ich fuhr fort und wandte mich an die Klasse: »Findet ihr nicht auch, dass Leslie ihre Szene abgeben sollte?«
Leslie sah mich verwundert an und bemühte sich um eine Antwort. »Ich bin mir nicht sicher, worauf Maria hier hinauswill …«
Ich unterbrach sie erneut, wobei mir das Herz bis zum Hals schlug. »Das geht jetzt schon ein paar Wochen so. Ist das wirklich fair?« Unser Professor war gezwungen, das Problem anzugehen, und ich empfand eine gewisse Art von Gerechtigkeit.