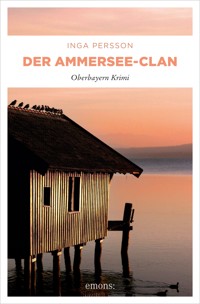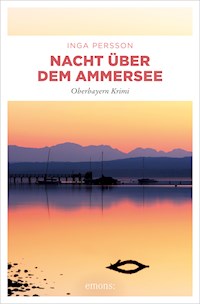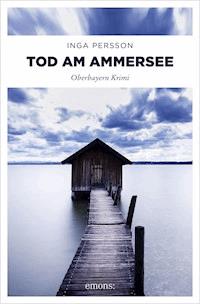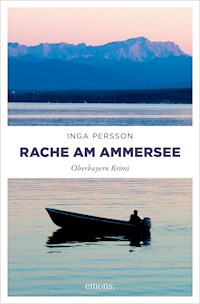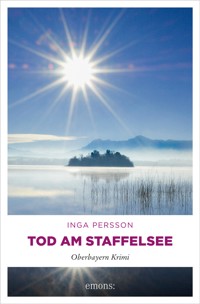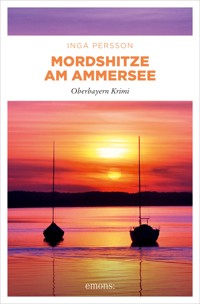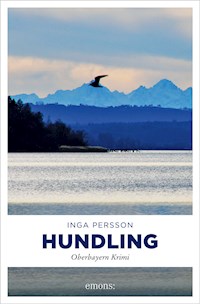
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Carola Witt
- Sprache: Deutsch
Humorvolle Krimiunterhaltung vor traumhafter Voralpenkulisse. Die heile Welt am Ammersee gerät aus den Fugen: Eine Mückenplage spaltet die Menschen vor Ort. Umweltschützer und Politiker, die sich für den Einsatz von Pestiziden aussprechen, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Dann wird die Pressesprecherin des Landrats tot aufgefunden. Ein Zufall? Mitnichten, glaubt Kommissar Lenz Meisinger und ist sich dabei ausnahmsweise einig mit seiner Freundin Carola Witt. Als es eine weitere Tote gibt, beginnt für die beiden ein Wettlauf mit der Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inga Persson hat Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, 1994 promovierte sie. Anschließend schrieb sie jahrelang im Auftrag anderer: erst für Bundestagsabgeordnete, später für ihre Agenturkunden. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn am westlichen Ammersee und betreibt dort die traditionsreiche Gastwirtschaft »Schatzbergalm«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Ruediger Schmautz/stock.adobe.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-733-0
Oberbayern Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
Ich bring ihn um
Ich bring ihn um.
Okay. Das mach ich. Ich bring ihn um.
Sofort.
Nein, morgen. Morgen bring ich ihn um.
Und das Letzte, das wirklich Allerletzte, was er sieht, bevor er sein kleines Scheißleben aushaucht, das bin ich.
Sie streckte sich in ihrem Sitz, die Augen geschlossen. Das tat gut. Wohlig badete sie noch etwas länger in ihren Gedanken. Sonnenlicht, reflektiert von den Scheiben eines vorbeifahrenden Autos, streifte ihr Gesicht. Unwillkürlich öffnete sie ihre Augen einen Spaltbreit. Vor ihr leuchteten vier Zahlen und ein Doppelpunkt im Armaturenbrett: »08:28«.
Sie überlegte kurz. Die Anzeige war dreimal umgesprungen, seitdem sie im Schutz ihrer Sonnenbrille in ihre Träume geglitten war. Sie lächelte. Drei Minuten lang hatte sie es sich vorgestellt, nein, sie hatte es gespürt, ganz tief in ihrem Inneren, wie es sich anfühlen würde, wenn er endlich tot wäre.
Phantastisch. Er. Weg. Endgültig. So sollte es sein. Nein, so würde es sein. Es, das war ihr Leben. Sie nickte sich selbst zu. Ja, genau. Ihr Leben, das würde so ganz anders werden. Sie würde nicht mehr nur darauf hoffen, dass er nicht nach Hause kommen, von der Straße fliegen, gegen einen Baum fahren würde. Dass irgendein Raser ihn vom Bürgersteig fegen, die Brücke in der Mitte einstürzen, das Wildschwein queren würde – dass irgendetwas passieren würde, völlig egal, was. Hauptsache, er käme nicht mehr wieder.
Ihr erdachtes Leben, in dem er nicht mehr vorkam, war herrlich. Sie konnte den ganzen Tag damit verbringen, es sich in allen Details vorzustellen. Es war, als ob sie durch bunte Kulissen wandelte, die voller bekannter Gesichter waren, von denen aber eines fehlte.
Sie atmete ein. War das ein Seufzer, oder holte sie Luft? Das waren Träume, die mit ihrem jetzigen Leben nichts zu tun hatten. Jedes Mal musste sie zurückkehren, so wie jetzt, aus ihrem Zauberleben zurück auf ihren Autositz.
Aber … sie konnte nicht mehr anders, seit sie sich das erste Mal getraut hatte, aus ihren Ideen Bilder entstehen zu lassen. Von da an war sie high on emotion, vollkommen berauscht. Endorphine mischten sich mit Adrenalin und strömten in ihrem Blut durch ihre Adern, jedes Mal aufs Neue, wenn sie sich ihren Gefühlen hingab. Von da an wurde jeder Tag zum Fest, selbst das Alltägliche schwerelos, der Job ein Kinderspiel, Haushalt, Kinder, alles ging ihr leicht von der Hand.
Wie war sie vorher Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag enttäuscht gewesen, abends seine Schritte wieder auf der alten Holztreppe ihres Elternhauses zu hören. Schwer, laut, so ganz anders als das leichte Trippeln der Kinderfüße. Hatte das Blei gefühlt, das sie niederdrückte, wenn er die Tür öffnete. Wenn sie in sein Gesicht sehen musste, jeden Abend, starr, abweisend und schweigend. Seine Kälte spürte, die ihr entgegenschlug wie eine winterliche Frostnacht. »Grüß dich« sagen musste, jeden elenden Tag, und dafür ein Knurren erntete. Das sprachen sie miteinander. Zwei Worte und ein Geräusch. Jeden einzelnen Tag.
Gott sei Dank kam er nicht mehr so häufig abends heim. Und wenn, dauerten ihre Begegnungen meist nicht lang. Dann setzte er sich an seinen Platz, aß schweigend seine Brotzeit, stand auf, verschwand grußlos in seinem Zimmer. Schloss die Tür hinter sich. Blieb dort die ganze Nacht, um am nächsten Tag, meist vor Morgengrauen, wieder zu gehen.
Zwei Worte und ein Brummen. Mehr nicht. Außer, ja, außer sie wollte, sie musste etwas mit ihm besprechen. Besprechen, was für ein Hohn. Sie waren verheiratet, lebten in einem Haus, hatten Kinder, es mussten Rechnungen bezahlt, Steuererklärungen abgegeben, Versicherungen geändert werden. Der ganz normale Wahnsinn eben, der jeden traf und den alle irgendwie hinzukriegen hatten. Für den er sich aber nicht zuständig sah. Den er als Zumutung empfand, wenn sie damit ankam. Weil er ja den ganzen Tag gearbeitet hatte, während sie nur ein bisserl blöd in den Computer geschaut hatte. Und sie nun seinen Feierabend störte, der ihm zustand.
Über die Jahre waren diese alltäglichen Aufgaben zur Tortur geworden. Ihre Bemühung um gemeinsam gefundene Lösungen familiärer Aufgaben mutierte innerhalb kürzester Zeit zu einem Pranger. Zum Gerichtssaal. Zum Tribunal mit nur einem Ankläger und einer Angeklagten – und der immer selben Anklage: Arbeitsscheu sei sie, kein Wunder, ihre Eltern seien es ja auch. Der Sohn ein fauler Strick. Und zu nichts zu gebrauchen. Ihre Arbeit sinnlos, ihre Pläne illusorisch und dann noch ihre Freunde, alles Ich-Menschen, genau wie sie.
Laut. Scharf. Lange. Ohne ein Ende zu finden.
In der ersten Zeit hatte sie geweint. Vor ihm, allein auf dem Klo, im Fahrstuhl vor irgendeinem Arzttermin. Eine Weile lang schrie sie zurück, wütend, warf Teller nach ihm. Es war doch einfach nicht wahr! Und war schließlich verstummt. Seit Jahren schwieg sie schon, stand vor ihm am Esstisch, ließ die immer gleichen Worte über sich hinwegströmen, hörte zu und hörte nicht zu, kannte die Sätze, die sie ab und zu noch trafen, aber meistens nicht mehr, wartete, bis er langsamer wurde, bis er sich ausgeleert hatte, um ihn dann anzulächeln und sich mit seinem obligatorischen Knurren die Zustimmung für das Bezahlen einer Rechnung bei ihm abzuholen.
Sie spürte, wie Magensäure ihre Speiseröhre nach oben kroch. Mit der Rechten tastete sie im Fußraum nach ihrer Handtasche, hob sie auf den Schoß, suchte und fand die kleine Plastikdose mit den Säureblockern und ihre Trinkflasche. Mit zwei, drei Handgriffen hatte sie sich eine Kapsel auf die Zunge gelegt und sie mit einem Schluck Wasser hinuntergespült. Sie schloss die Augen und atmete aus. In wenigen Minuten würde das Medikament seine Wirkung tun, ihren Magen entspannen, der Schmerz würde nachlassen und sie wieder ruhig werden. Plötzlich erschöpft lehnte sie sich zurück, ließ ihren Kopf an die gepolsterte Stütze sinken, schloss die Augen.
Ein kurzes, dumpfes Scheppern ließ sie auffahren. Sie sah den erschreckten Gesichtsausdruck einer blonden Frau, die ihre Fahrertür ans Auto gedonnert hatte. Die Frau klopfte an ihr Fenster, machte eine entschuldigende Geste, sie winkte ab. Aus dem roten Wagen neben dem ihren kletterte ein nicht mehr junger, aber schlanker, braun gebrannter Mann mit grauen Locken, die ihm bis zu den Schultern reichten. Er schien etwas zur Blondine zu sagen, denn sie lachte, schloss zu ihm auf. Gemeinsam gingen sie über den Parkplatz. Durch das Seitenfenster blickte sie ihnen nach. Was sie wohl vorhatten? Sie sahen geschäftig aus, irgendwie vertraut. Kein Paar, aber schon von Weitem als Team zu erkennen. Wie gern wäre sie jetzt die Frau an der Seite des grau gelockten Mannes gewesen. Vereint durch Jahre des gemeinsamen Arbeitens. Vertraut. Verlässlich.
Sie spürte das Brennen einer Träne im Augenwinkel, fühlte, wie sie über ihr Gesicht rollte, und ließ sie nach unten in ihren Schoß fallen.
Zwischen ihren Wimpern blinzelte sie durch die Windschutzscheibe nach vorn. Vor ihr ein Wagen, rechts und links neben ihr auch. Wie lange saß sie schon im Auto auf dem namenlosen Parkplatz? Eine halbe Stunde? Eine Stunde? Sie hatte das Zeitgefühl verloren. Niemand hatte sie beachtet, eine Frau, die auf dem Beifahrersitz saß, angeschnallt, still. Es war Regen angesagt.
Eine zarte Erinnerung an das Gefühl, wie es sein würde, wenn er tot wäre, flog an ihr vorbei. Sie versuchte, nach ihrem Gedankengespinst zu greifen, sich von ihm emporheben zu lassen, raus, weg aus dem Auto, von diesem Sitz, der unter ihr von Sekunde zu Sekunde wärmer wurde. Aber es gelang ihr nicht, den Traumzipfel zu erhaschen, er zog vorbei, verblasste, löste sich auf wie eine kleine Kumuluswolke am Junihimmel. Sie war wieder allein.
Mühsam versuchte sie, sich in ihren Gedanken zurechtzufinden. Wie lange würde er noch fort sein? Erfahrungsgemäß dauerten diese »Meetings« mindestens eine Stunde, manchmal auch zwei, je nachdem, wie gut aussehend die Sekretärin war. Um zehn Uhr müssten sie zusammen bei diesem Empfang in München im Ministerium auftauchen.
Das Bild der anderen schoss ihr plötzlich durch den Kopf. Die Zeitung hatte es abgedruckt. Groß, schlank, selbstbewusst und im figurbetonten Kostüm stand sie neben irgendeinem Politiker. Wer war das doch gleich noch gewesen? Ah ja, der Landrat. Seine Pressesprecherin sei sie, war unter dem Foto zu lesen gewesen. Was auch immer man als solche tat, aber für ein Bild im Dorfbladl reichte es anscheinend aus. Sie hatte die andere gegoogelt, sich noch mehr Bilder von ihr angesehen, die Informationen aufgesogen: Mitte dreißig, studiert, tough, schick. Offizieller Beziehungsstatus auf Facebook: Single. Na ja, was hatte sie auch erwartet? Es gab ja kein Kästchen für »Gspusi«.
Lächelte sie schon wieder? Ja, tatsächlich. In ihr war keine Enttäuschung, keine Eifersucht, sondern – Erleichterung. Wenn er wüsste, wie befreit sie sich fühlte, seit er zu ihr ging. Mehr oder weniger regelmäßig. Aber eigentlich immer mittwochs und freitags, nachdem er zu Hause geduscht hatte. Und an diversen Wochenenden. Und sie in Ruhe ließ, in ihrem schmalen Bett, das sie neben ihrem Schreibtisch ins Arbeitszimmer gestellt hatte.
Sie hatte es sofort gemerkt. Seit vorletztem Sommer bewegten sich die Moleküle anders durch den Raum, die wenigen Male, wenn er schweigend an ihr vorbei in seinem Zimmer verschwand. Ganz vermeiden konnte er es ja nicht, ihr zu begegnen. So entging ihr nicht sein auftrumpfender Gesichtsausdruck, wenn er in sein Auto stieg, um zu ihr zu fahren. Und dann diese Jacke, die die andere ihm letzten Winter geschenkt hatte. Diese federleichte Daunenjacke. Senfgelb. Tailliert. Unwillkürlich kicherte sie. Er trug sie stolz wie ein Gockel. Wenn er nur sehen könnte, was diese Jacke aus ihm machte, der er sonst ausschließlich Jeans und Karohemden trug.
Ob er wusste, dass sie es wusste? Vielleicht, aber wenn, war es ihm egal. Seit Jahren war sie Luft für ihn. Was hatte er sich immer lustig über sie gemacht. »Du bist so leicht zu durchschauen«, hatte er gesagt. Er halt auch.
Wochenlang hatten sie Vermutungen über die veränderte Atmosphäre gequält. Aber es war so eindeutig: sein leichter Schritt, das selbstgefällige Grinsen, seine Abwesenheit. Sie hatte sich das Gehirn zermartert, wie sie aus ihrem Verdacht Gewissheit machen könnte, aber dann war alles so einfach gewesen. Eines Abends nach irgendeiner Gemeinderatssitzung war er sturzbetrunken nach Hause gekommen. Ließ erst seine Jacke auf den Fußboden, dann sich aufs Sofa fallen, schnarchte.
Sie beobachtete ihn eine Zeit lang, schlich sich auf Zehenspitzen an, zog sein Handy aus der Jackentasche. Nahm vorsichtig seinen Zeigefinger, drückte ihn auf sein Smartphone und ließ wieder los. Strahlend erwachte das Gerät und erzählte ihr all seine Geheimnisse. Mit offenem Mund scrollte sie durch seine Nachrichten. Unmengen an Nachrichten.
Ihr erster Triumph ob der Entdeckung zerfiel in Sekundenschnelle zu Staub. Er schrieb ihr praktisch jede Stunde, manchmal sogar öfter, sie sahen sich zweimal in der Woche, gingen essen, besuchten Veranstaltungen, segelten und fuhren Ski. Sie lebten ein Leben miteinander. Doch für sie hatte er nur ein Knurren übrig.
Aber was hatte sie schon erwartet? Ihre Ehe war am Ende. Sie hielten nur noch die Fassade aufrecht. Verbrachten, wenn es notwendig war, einen Abend zusammen, nahmen gemeinsam an Veranstaltungen teil, die sie nicht absagen konnten. So wie heute an dem Empfang oder morgen an dem politischen Frühschoppen. Abseits davon führten seine Wege zu der anderen.
Mit ihr hatte auch der Sex aufgehört. Sie hatte es nie in Frage gestellt. Er auch nicht. Warum auch? Manchmal, bevor sie auf ihrer schmalen Pritsche einschlief, dachte sie an die ersten Jahre zurück. Sie hatten ganze Wochenenden im Bett verbracht, das Haus nicht verlassen, vollkommen versunken ineinander. Hatten Soul gehört, verknotet auf dem Sofa gelegen, waren in jede Hautfalte des anderen gekrochen, vollkommen hingerissen voneinander. Er war zärtlich gewesen, zugewandt, aufmerksam. Hatte sie mit Geschenken überhäuft, mit Komplimenten verzückt, mit Küssen verwöhnt. Sie war so verliebt in ihn gewesen. Damals wäre es ihr nicht in den Sinn gekommen, dass es jemals anders werden könnte.
Doch aus dem Nichts, als wäre er durch ein unsichtbares Tor aus einem anderen Universum in ihr Leben getreten, hatte eines Tages ein anderer Mann vor ihr gestanden. Hart, abweisend, frostig. Sie hatte keine Ahnung, wer er war. Es war ein Schock, dieser kalte Mensch, der in der Haut ihres Geliebten steckte. Der fremde Mann beschimpfte sie, nein, er erniedrigte sie, bezichtigte sie, tausend Dinge falsch, schlecht oder gar nicht gemacht zu haben. Erst grollte, dann zürnte, schließlich wütete er.
Es ging alles so schnell. Sie erschreckte sich zu Tode, ergab sich kampflos, sah widerstandslos dabei zu, wie er nach ihrem Herzen griff und es mit aller Macht in Stücke riss. Für Bruchteile von Sekunden erkannte sie das, was auf sie zukam, als Schmerz, als sie schon in die Knie sank, nein, zu Boden fiel, dabei weinte, bettelte: »Bitte, bitte, sei wieder gut mit mir.«
Doch der Kalte war geblieben. Tagelang. Sie erinnerte sich an ihre Tränen, ihre Verwirrung darüber, was vor sich ging, ihre Taubheit, mit der sie in der Zeit mechanisch ihren Alltag erledigt hatte. Bis vollkommen unvermittelt der andere verschwand und ihr geliebter Ehemann wieder vor ihr stand. Erschöpft und unendlich erleichtert darüber, dass er wieder da war, hatte sie sich in seine Arme sinken lassen. Endlich war alles wieder gut gewesen.
Was für ein Irrtum. Seit diesen Tagen war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war. Denn die Erleichterung hatte die Angst im Gepäck. Wenn der Unbekannte einmal gekommen war … würde er wiederkommen? Hart, kalt und abweisend?
Und wie er gekommen war. Ohne Vorwarnung, von einer Sekunde auf die andere. Wieder war sie ungeschützt, brach zusammen und spürte nur noch ihr wundes, blutendes Herz. Weinte und bettelte erneut. Bis der andere ging und die warmen braunen Augen ihres Mannes sie wieder ansahen.
Bis zum nächsten Mal. Und zum übernächsten.
Ihr Leben hatte sich in einen grauen Brei aus Schmerz und Angst verwandelt. Manchmal, in den wenigen Momenten dazwischen, in denen sie noch einen klaren Gedanken fassen konnte, wurde ihr bewusst, dass sie sich wie ein Junkie verhielt. Und wenn sie ganz ehrlich war, nicht nur wie ein Junkie. Sie war ein Junkie. Der regelmäßig seinen Stoff brauchte. Und sofort auf Entzug war, wenn er nicht versorgt wurde. Willenlos. Ein Häufchen Elend. Aber trotzdem vollkommen unfähig, auf die Droge zu verzichten.
Sie zermarterte sich den Kopf. Was machte sie falsch? Es musste doch einen Grund dafür geben, dass er sich immer wieder veränderte, blitzschnell kalt, lieblos und unzugänglich wurde. Doch sie konnte keinen Fehler finden. Beide hatten sie herausfordernde Berufe, die Kinder waren wohlgeraten, das Haus schön und gepflegt. Und trotzdem musste da etwas sein.
Sie versuchte, mit ihm darüber zu sprechen. Herauszufinden, wo sie versagte. Was er wollte. In den ersten Jahren schien er ihr zuzuhören und antwortete dann immer das Gleiche. Dass es besser werden würde.
Aber es wurde schlechter. Aus dem kalten, zürnenden Mann wurde der eisige, schweigende Mann. Der Mann, der sie eines Morgens nicht mehr grüßte. Der sie keines Blickes würdigte. Der die Tür hinter sich schloss.
Sie hatte die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Verwirrt, verängstigt, verletzt. Aber wen interessierte es, wie es ihr ging? Die Kinder mussten in die Schule, sie hatte einen Job und einen großen Haushalt zu führen.
In der ersten Zeit hielt sie es keine Stunde lang aus. Klopfte an seine Tür. Weinte. Flehte. Dann irgendwann hatte sie so viel zu tun, dass sie einen Tag ohne ihn schaffte. Daraus wurden zwei. Eine Woche. Zwei, drei. Und schließlich ein ganzer Monat.
Dennoch ertrug letztlich immer sie es nicht mehr. Ging jedes Mal, jedes einzelne Mal, wieder auf ihn zu. Suchte das Gespräch. Irgendwann nicht mehr weinend. Nicht mehr bettelnd. Sondern sein abweisendes Schweigen ignorierend, einfach, als ob alles in Ordnung wäre. Überging die Kälte, arbeitete, redete, lachte. Weil sie es ja sein musste, die etwas falsch gemacht hatte.
Bis sie eines Tages verstand. Das Wochenende begann gut, es war die Zeit noch weit vor der anderen. Sex und ein ausgedehntes Frühstück. Sie gingen in die Berge, wanderten unter hohem Himmel mit Aussicht auf schneebedeckte Gipfel. Dann, unvermittelt wie ein Wettersturz, kippte ein glückseliger Tag in sein Gegenteil. Eben noch hatten sie miteinander geredet, aber eine Minute später reagierte er nicht mehr. Als hätte sie sich in Luft aufgelöst, ging er nur noch neben ihr her. Auf diesem Wanderweg, in lieblicher Landschaft unter weiß-blauem Himmel, war sie mit einem Mal mit dem Kalten unterwegs.
Aber diesmal war es anders. Sie spürte keine Angst. Klar stand es vor ihr: Es ging überhaupt nicht um sie.
Den Sonntag brachte sie mit Anstand zu Ende. Fabulierte dank jahrelanger Übung routiniert über sein Schweigen hinweg, tat so, als nähme sie seine Veränderung nicht wahr, fuhr mit ihm auf dem Beifahrersitz nach Hause und sang zur Musik im Radio mit.
Doch in ihrem Kopf rasten die Gedanken. Wenn nicht sie es war, die den Kalten zum Vorschein brachte, dann musste er es sein. Und wenn nur er entschied, was er für sie war, Geliebter und Kalter, war es vollkommen unerheblich, was sie tat, wie sie es tat und wann.
Also konnte sie genauso gut aufhören, bei sich nach dem Fehler zu suchen, sich darum zu bemühen, perfekt zu sein und alles richtig zu machen. Sie konnte … Ja, genau, sie konnte einfach tun und lassen, was ihr in den Sinn kam! Nicht nur Job, Kinder, Haushalt. Sie konnte tun, was ihr – und zwar nur ihr – Spaß machte, das unternehmen, was ihr gefiel.
Und das tat sie auch. Anfangs eher unauffällig. Ein Saunabesuch während einer seiner Gemeinderatssitzungen hier, ein Abendessen bei der Freundin da. Dann eine kleine Reise während seiner Fortbildung, ein paar Tage bei einer anderen Freundin in Berlin. Im nächsten Jahr mit ihr eine Woche in die Sonne. Sie holte ihr vergessenes Strickzeug aus dem Schrank, spielte wieder Gitarre und machte lange Fahrradtouren um den See.
Das neue Leben tat ihr gut. Mit der Zeit wurde sie ruhiger, der Wundschmerz ließ nach, sie bekam wieder besser Luft. Sie spürte, dass der Drang, ihm nahe sein zu wollen, abnahm. Ob es anderen Abhängigen auch so ging, wenn sie einen Entzug machten? Sie spürte Dankbarkeit und betrachtete den größer werdenden Abstand zwischen sich und ihm als Zone, die sie vor einem Rückfall schützte.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie ewig so weitermachen können. Doch eines Tages suchten die Moleküle einen anderen Weg durch das Zimmer, und sie stellte ihr Klappbett ins Arbeitszimmer. Außer zwei Worten und einem Knurren war nichts mehr von ihrer Ehe übrig.
Wie lange hielt dieser Zustand nun schon an? Ein Jahr oder zwei? Das Leben verflog ereignislos, hatte weder Höhen noch Tiefen. Sie hatte sich damit abgefunden.
Bis zu diesem einen Tag im Frühjahr. Sie machte Hausputz, saugte unter den Schränken, zog einen Briefumschlag unter der Couch hervor, adressiert an seine Firma. Sie wollte ihn zu seinen Sachen legen, besann sich aber und zog die Seiten aus dem Umschlag.
Ein Münchner Rechtsanwalt. Der ihm darlegte, wie es ihm gelingen könnte, an ihr Erbe, das Haus ihrer Eltern, zu kommen. Was seiner Meinung nach verhältnismäßig einfach war. Da waren seine Investitionen in ihre Immobilie und ihr Auszug aus dem Ehebett. Der sei als Wegfall der Geschäftsgrundlage zu werten. Dann auch noch der Zugewinn, der geteilt werden müsste. Das sähe sehr schlecht für sie aus. Sie bekäme eine überschaubare Abfindung und das Sorgerecht für die Kinder. Unterhalt in substanzieller Höhe hätte sie nicht zu erwarten, schließlich würde sie gut verdienen, während er das Risiko eines jungen Unternehmens zu tragen hätte. Ihre Zustimmung sei gewiss, um Streit zu vermeiden, zum Wohle der Kinder. Er werde eine Mediation empfehlen, um ihr den Eindruck zu vermitteln, ihre Anliegen würden gehört. Für ihn sei das am Ende günstiger als ein strittiges Verfahren.
Noch heute klopfte ihr Herz bis zum Hals, wenn sie an den Brief zurückdachte. Mit zitternden Fingern hatte sie ihn mit ihrem Handy fotografiert, zurück in den Umschlag gesteckt und wieder unter das Sofa gelegt. Zwei Tage später war er verschwunden.
All die Freude über ihr neues Leben verpuffte auf einen Schlag. Stattdessen spürte sie eine neue Glut in sich, tief unten, noch unter ihrem sauren Magen. Akribisch wie eine Wissenschaftlerin forschte sie in sich selbst und definierte die Empfindung als Hass.
Der sie wie noch nie zuvor motivierte. Sie arbeitete Tag und Nacht, als würde ein neuer Motor in ihr laufen. Und sie träumte, erst von ihm, dann von seinem Tod. Anfangs nur in der Nacht, immer wieder, dann auch tagsüber, bis sie sich schließlich bei jeder sich ihr bietenden Gelegenheit ein Leben ohne ihn erdachte. So wie jetzt auf ihrem Sitz, in dem Auto, auf dem Parkplatz.
Ihr Magen gab ein knurrendes Geräusch von sich. Sie strich sich eine Strähne hinters Ohr und wollte eben in ihrer Handtasche nach einem Müsliriegel suchen, als sich die Tür des Gebäudes gegenüber öffnete. Sie sah ihn heraustreten, dynamisch über den Parkplatz auf ihren Wagen zukommen. Er grüßte jeden Zweiten, blieb stehen, schüttelte Hände. Sie beobachtete ihn durch die Windschutzscheibe. In der Sekunde, als es anfing zu regnen, drehte er sich zu ihr, seine Augen trafen ihren Blick, sie nahm ihn ins Visier und sandte ihm eine Nachricht: D‑U-B‑I‑S‑T-E‑I‑N-T‑O‑T‑E‑R-M‑A‑N‑N.
Geh nur ran
»Mei, schau nur, wie liab.«
Carola, die zwischen reflektierenden Regentropfen auf der Windschutzscheibe und den knarzenden Scheibenwischern hindurch auf die Ampel starrte, wandte ihren Blick vom Rotlicht ab. Seit gestern regnete es, das Auto brummte, sie standen an einer Kreuzung. Was um Himmels willen fand Lenz auf einmal »liab«? Sie folgte seinem Zeigefinger und starrte eine riesige Plakatwand an, die sie bis vor einer Sekunde nicht wahrgenommen hatte, obwohl sie direkt hinter der Ampel stand. Die Werbung einer Krankenkasse mit einem kernigen Spruch in großen roten Lettern, die dynamisch grob und querbeet über die Fläche gepinselt waren. Dazu hielten zwei eindeutig männliche, dennoch feingliedrig-sensible Hände ein Babyköpfchen dem Betrachter entgegen.
Carola runzelte die Stirn. Was gefiel Lenz ausgerechnet an diesem Plakat? Die Krankenkasse? Wohl kaum. Der Spruch? Irgendwas von Männern und Familie. Wirklich? Das konnte nicht sein, da gab es bessere. Womöglich … das Kind? Sie warf ihrem Lebensgefährten einen schnellen Seitenblick zu. Lenz saß vollkommen entspannt neben ihr auf dem Beifahrersitz, die Hände im Schoß gefaltet, selig lächelnd. Im Ernst? Der Anblick eines Werbebabys brachte Lenz zum Strahlen?
Hinter ihr hupte es.
»Is schon recht«, knurrte sie und nahm den Fuß von der Bremse. Wenigstens hatten sie gefrühstückt. Wenn man zwei Schälchen warmes Porridge und je eine Tasse Kaffee so nennen konnte. Auf jeden Fall war es zu wenig Kaffee gewesen. Sie gönnte ihrem Liebsten, Kriminalhauptkommissar Laurentius Meisinger, den alle nur Lenz nannten, noch einen Blick und gab Gas. Schließlich war sie nicht in aller Herrgottsfrüh aufgestanden und hatte schon eine Stunde am heimischen Schreibtisch verbracht, während Lenz telefonierte, nur damit sie jetzt gemeinsam vor einer Ampel versauerten. Er musste zum Dienst in die Polizeiinspektion Weilheim und sie ins Wahlkreisbüro, ihren Kollegen Seppi Hinterstrasser einsammeln und dann weiter zum politischen Frühschoppen. Ihr Chef, der Bundestagsabgeordnete Johannes Ludwig, hatte Lokalpolitiker zu sich nach Hause eingeladen.
Carola gähnte herzhaft, als sie das Ortsschild Diessen hinter sich ließen. Gerade wollte sie das Pedal durchdrücken, da tauchte in der Kurve vor ihnen ein großes Gespann auf, ein gigantischer Traktor samt turmhohem Kipper. Es hörte auf zu regnen. Die Sonne brach durch die Wolken und brachte den Asphalt zum Funkeln.
»So«, sagte sie zur Windschutzscheibe, als sie hinter dem Schlepper her zuckelnd in die enge Birkenallee nach Fischen einbog, etwas nach links zog und zum Überholen ansetzte, »ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Fan von Betriebskrankenkassen bist.«
»Von was?«, kam es irritiert vom Beifahrersitz.
Der Wagen zog an, sie überholte den Bulldog. Beste Entscheidung, das alte Auto gegen dieses auszutauschen. Gott, wie sie diesen Turbo liebte. »Na, von Krankenkassen. Darum ging’s doch bei dem Plakat an der Ampel. Oder nicht?«
Vom Beifahrersitz ertönte Gekicher, als sie wieder zurück auf ihre Spur einscherte. Die zarten weißen Bäume, die die Birkenallee säumten, flogen an ihr vorbei, und ihre Gedanken drifteten weg von dem Gespräch und hin zu ihrer heutigen Tagesaufgabe: Bei einem Weißwurstfrühstück sollten eine politische Nachfolge und die aktuelle Mückenplage diskutiert werden.
An den Viechern schieden sich derzeit die Geister am Ammersee. Wie schon in den letzten Jahren war Mitte März der Winter nahtlos in den Sommer übergegangen. Von einem Tag auf den anderen fror es nicht mehr. Stattdessen kletterte das Thermometer auf fünfzehn Grad, in der Sonne sogar auf achtzehn. Rund um die alte Eiche auf dem Secklerhof, hoch über dem Ammersee, schossen erst Buschwindröschen, Veilchen und Schlüsselblumen aus der Erde, kurz danach hatten die ersten Bäume auf der Streuobstwiese ihre Blüten aufgesteckt. In Carolas Augen gab es zu dieser Jahreszeit nichts Schöneres, als gegen die alte Reneklode gelehnt nach oben in die weißen Blüten zu schauen.
Und dann war der Mai gekommen. Die Temperaturen rauschten wieder in den Keller, dass kaum noch fünf Grad erreicht wurden. Pünktlich zu den Eisheiligen begann es zu regnen. Es goss in Strömen, tagelang, es hörte einfach nicht mehr auf, nicht nur bei ihnen am See, sondern auch in den Bergen. Die Null-Grad-Grenze stieg auf über zweitausend Meter, auch in den Höhenlagen schmolz der Schnee rapide ab. Innerhalb kürzester Zeit erreichte der Pegel der Ammer jeden Tag einen neuen Höchststand. Das Wasser im See stieg und stieg, die Ammer trat über die Ufer und überzog die flussnahen Felder mit einer bräunlich trüben Brühe. Direkt nach der Kalten Sophie Mitte Mai hörte der Regen schlagartig auf, die Sonne kam raus, und die Temperaturen kletterten wieder nach oben. Von einem Tag auf den anderen wurde es tropisch warm, und die Pegel fielen ebenso schnell, wie sie zuvor gestiegen waren. Seither wechselten sich sturzbachartige Regengüsse und heiße Frühsommertage ab.
»Oh-oh«, hatte Resi, die Besitzerin des Secklerhofes, Lenz’ Mutter und seit über drei Jahren Carolas Vermieterin, eines Morgens im Mai gemacht, als sie nebeneinander unter dem Vordach standen und ihren Morgenkaffee aus großen Tassen schlürften.
»Was meinst du mit ›oh-oh‹?«, fragte Carola.
»Na, das da«, antwortete Resi und schwenkte ihre Tasse in Richtung Ammertal. »Siehst du das, die dreckerten Wiesen? Da, wo das Ammerhochwasser schon zurückgegangen ist? Ideales Mückenbrutgebiet. In zwei Wochen sind s’ da, die Scheißviecher.«
Was sie nur immer hat, dachte Carola, stürzte ihren Kaffee hinunter und fuhr zur Arbeit. »Jetzt weiß ich, was du neulich gemeint hast«, hatte sie vierzehn Tage später gequietscht, während sie ein halbes Dutzend Blutsauger, die sich über ihren nackten Oberschenkel hermachen wollten, mit der flachen Hand erschlug.
Sie grinste. Dauernd diese Tiere. Letztes Jahr war es ein Storch gewesen, der sie auf Trab gehalten hatte. Das schwarz-weiße Federvieh hatte die Dachreparatur am Raistinger Pfarrhof durch seinen forschen Nestbau zum Erliegen gebracht. Etliche Behörden und Unternehmen hatten nicht gewusst, was sie mit dem Storchen-Schwarzbau anfangen sollten. Sie selbst hatte dem eine unterhaltsame Seite abgewinnen können, ebenso wie dem Umstand, dass ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger erst letzten Winter in die Rathäuser gelaufen waren, um beim Volksbegehren »Rettet die Bienen« zu unterschreiben. Als sie ein halbes Jahr später, um nicht gestochen zu werden, aus den Cafés rund um den See flüchteten, hatten die gleichen Bienenretter »Tötet die Mücken!« geschrien. War sie eigentlich die Einzige, die das eigenartig fand?
An der Grenze zwischen Leben und Tod verlief nun im Frühsommer ein öffentlicher Schützengraben. Sich gegenüber lagen diejenigen, die die Mücken bekämpften, und die, die der Natur ihren Lauf lassen wollten. Im Supermarkt an der Kasse, in Leserbriefen der Zeitungen und diversen Onlineforen, überall wurde über Mücken gestritten. Der Ton war rau und wurde mit jedem Tag schärfer.
Eigentlich hätte sich Carola ja zurücklehnen und dabei zuschauen können, wie sich Leute, die sie bisher für ganz vernünftig gehalten hatte, auf offener Straße beschimpften. Aber leider war sie mit von der Partie, denn das Thema der Mückenbekämpfung hatte die politische Bühne in Beschlag genommen. In ihrem Fall war der politische Nachwuchs gefährdet. Nein, korrigierte sie sich: die Motivation des Nachwuchses, sich überhaupt politisch zu engagieren.
Die Neulinge auf dem politischen Parkett verschreckte die Vehemenz der Debatte. Unwillkürlich umfasste Carola das Lenkrad etwas fester. Sie konnte die Angst politischer Youngster, öffentlich Dresche zu beziehen, ja nachvollziehen, denn selbst als Kommunalpolitiker brauchte man inzwischen ein verdammt dickes Fell. Selten wurde sachbezogen diskutiert, stattdessen ebenso emotional wie unsachlich losgebrüllt, real oder im Internet.
Sie wusste, wie wenig das einlud, politische Verantwortung zu übernehmen. So wie im vorliegenden Fall bei Friedhelm Albrecht. Eigentlich sollte er möglichst ohne Aufsehen dem kürzlich verstorbenen Gemeinderat Sauter nachfolgen. Pustekuchen, dachte Carola. In einem vertraulichen Telefonat hatte Albrecht Ludwig gestanden, das Amt an den Nächsten auf der Liste weiterreichen zu wollen. Ein Vorhaben, das ihr Chef verhindern wollte, hatte er doch schon die Kommunalwahlen im nächsten Jahr im Auge. Für die Aufstellung der Liste zählte jeder Mann. Oder jede Frau. Albrecht zu motivieren war das eigentliche Ziel des Weißwurstfrühstücks, ein Meinungsaustausch über die politische Lage der offizielle Anlass. Und über all dem schwebte die Frage nach der parteiinternen Aufstellung für den Wahlkampf im nächsten Jahr.
»Sei nicht albern, Caro«, unterbrach Lenz’ Stimme ihren Gedankenfluss. »Ich meinte natürlich das Baby. Das sah doch supersüß aus, findest du nicht?«
Ach ja. Da war ja noch was. Lenz war auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs. Sie spürte, wie er sie von der Seite erwartungsvoll musterte. Da war sie wieder, diese undankbare Wahl zwischen Pest und Cholera. Sollte sie seine Gefühle verletzen, indem sie ihm eine flapsige »Ich bin ein political animal, und Kleinkinder werden eh überbewertet«-Replik vor den Latz knallte? Oder ihm um des Weltfriedens und der frühen Stunde willen einfach beipflichten? Sie verdrehte innerlich die Augen und gab ein undefinierbares Geräusch von sich.
Ihre Reaktion schien Lenz’ guter Laune keinen Abbruch zu tun. Sie spürte, wie er vor Begeisterung in seinem Sitz auf- und abhüpfte. »Jetzt, wo du’s sagst, Caro«, frohlockte er, »darüber wollte ich eh schon die ganze Zeit mit dir reden.« Er streckte seine linke Hand aus und tätschelte ihre rechte, die auf dem Hebel der Automatik lag.
Nur mit Mühe gelang es ihr, nicht zurückzuzucken. Sie hatte doch nichts gesagt. Worüber wollte der Mann also mit ihr reden? Nicht über Krankenkassen, sondern über Babys? Aber jetzt bloß keinen Streit. Den konnte sie um diese Uhrzeit, noch dazu vor einem wichtigen Event und in Kombination mit einem niedrigen Koffeinpegel, überhaupt nicht gebrauchen. Sie entschied sich, auf die noch regennasse Straße vor sich zu starren, und fabrizierte erneut einen gutturalen Laut.
Lenz streichelte ihre Hand. »Brauchst jetzt nichts sagen, Spatzerl. Ich weiß, das alles kommt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich denke, wir sollten eine Familie gründen. – Ey!« Er stützte sich mit beiden Händen am Armaturenbrett ab und ließ vorsichtig den Sicherheitsgurt zurückgleiten, in den ihn Carolas Vollbremsung geworfen hatte. »Ist dir was vor den Kühler gerannt? Was haust denn so in die Bremse rein? Fährst halt nicht so schnell, sonst baust noch einen Crash, das sag ich dir!«
Vom Fahrersitz funkelte Carola ihn kurz an, setzte den Blinker und beschleunigte wieder. »Ich schieb das jetzt mal auf die kurze Nacht, dass du so einen Schmarrn erzählst«, sagte sie und sah wieder stur geradeaus.
»Schmarrn? Wieso Schmarrn? Alle Leute kriegen Kinder. Warum nicht auch wir?«
»Weil …«, setzte Carola an, um sich sofort zu unterbrechen. Ja, warum eigentlich nicht? »Ach, Lenz«, seufzte sie und blieb hinter einem Lkw, den sie normalerweise schon längst überholt hätte.
»Also ich hätte wirklich gern Kinder. Und das am liebsten mit dir«, sagte er mit sanfter Stimme.
Carola verspürte erneut das starke Bedürfnis, das Bremspedal durchzudrücken. Verbunden mit dem Wunsch, die Fahrertür aufzureißen und davonzusprinten. Wie wenig kannte dieser Mann sie eigentlich? Spürte er nicht ihren Freiheitsdrang? Ahnte er nicht, dass sie sich nach Orten sehnte, an denen sie noch nie gewesen war? Havanna, Kyoto, Borobudur – das kannte sie nicht, da wollte sie hin. Aber mit Baby? Caro, bitte, schalt sie sich, du bist brutal ungerecht. Erstens nehmen Fluggesellschaften auch Kinder mit und zweitens: Woher soll der Mann das wissen? Schnauze, meckerte ein anderer Teil ihrer selbst sie an, ich glaub, ich werd jetzt langsam sauer.
Sie schenkte Lenz einen langen Blick. »Und wie stellst du dir das vor? Wer soll sich dann um dieses Kind kümmern?«, fragte sie mit süßer Stimme.
Lenz’ ungläubiger Blick streifte ihre rechte Wange. »Was meinst denn du, wie alle anderen das machen? Glaubst du, du wärst die erste Frau der Republik, die in Mutterschutz und Elternzeit geht? Aber du hast natürlich recht. Unsere junge Demokratie würde es nicht überleben, wenn du eine Zeit lang nicht das Wahlkreisbüro Ludwig leitest.«
Carola konnte die Verletzung aus seiner Stimme heraushören. Really? In letzter Sekunde unterdrückte sie den Impuls, mit der Faust auf das Lenkrad zu hauen. Lenz war getroffen? Und was war mit ihr? Wieso ging er eigentlich davon aus, dass sie sich freudig schwängern lassen würde, um dann zu Hause auf Geburt und Kleinkind zu warten? Um dann am besten jahrelang das Dreieck zwischen Secklerhof, Supermarkt und Spielplatz in den Seeanlagen abzugehen?
Der Jähzorn, ihr alter Bekannter, kämpfte mit ihrer Bauchspeicheldrüse, um sich seinen Weg nach oben, in ihren Brustkorb, ihren Hals und zu ihren Stimmbändern, zu bahnen. Sie presste die Lippen zusammen, um bloß nicht wütend loszubrüllen. Das würde jetzt auch nicht weiterhelfen. Aber wieso schoss ihr gerade jetzt ein Satz durch den Kopf, den sie unlängst gelesen hatte? Dass jemandem den Tod zu wünschen Gartenarbeit als beliebtestes Hobby abgelöst habe? Sie sog Luft durch die Nase ein.
»Wenn du ein Kind willst, wieso gehst du dann nicht in Elternzeit?«, fragte sie in betont leichtem Ton zurück.
Lenz katapultierte sich fast aus seinem Sitz. »Ich? Du bist doch die Mutter!«
Carola schnappte nach Luft und hielt eine Sekunde inne, bevor sie in schallendes Gelächter ausbrach. »Lenz«, japste sie, »das Ding heißt Elternzeit, nicht Mutterzeit. Und wenn du so weitermachst, werd ich nie eine werden.« Sie setzte den Blinker, bog in die Straße zur Polizeiinspektion ab und dachte, dass sie grad noch mal die Kurve gekriegt hatte.
Vom Beifahrersitz erklang ein dumpfes Scheppern.
»Lenz, deine Jacke klingelt«, sagte sie und fuhr auf den Parkplatz.
»Was?«, kam es beleidigt zurück. »Ach ja, wo hab ich es denn?«, brummte Lenz, grub in seinen Taschen und hielt sein Telefon ans Ohr. »Meisinger!«, bellte er.
Jessas, dachte Carola, ist der angefressen. Der Anrufer möchte ich jetzt echt nicht sein. Sie ließ das Auto vor der KPI ausrollen und hielt an.
»Wo ist der Pollinger? Kämmt der schon wieder seine Haare?«, knurrte Lenz und schien mit der Antwort zufrieden. »Sag ihm, er soll der Otto in der Rechtsmedizin Bescheid geben. – Ach, hast du schon gemacht? Okay, dann noch der KTU. – Aha, auch schon. Ja dann! Wozu rufst du mich an und stiehlst mir meine Zeit?«
Carola legt ihre Hände auf das Lenkrad und verkniff sich ein Grinsen. Beni, der junge Kommissar, war anscheinend wieder mal auf Zack.
»Wie, wo ich denn bleib? Wenns du mal beim Fenster rausschaust und dabei nicht nur in der Nase bohrst, sondern richtig hinschaust, könntest du mich vor der KPI entdecken. – Ob ich schlechte Laune hab? Beni, noch ein Wort und ich versetz dich zu den Fernsehdeppen nach Rosenheim!«
Lenz tippte auf seinem Telefon herum und stopfte es zurück in seine Jackentasche. »Spatzerl, leblose Person am See. Ungeklärte Umstände. Womöglich Tötungsdelikt. Ich muss, pfiat di, wir reden später weiter.« Sprach’s, drückte ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange, riss die Beifahrertür auf, sprang hinaus und knallte die Tür hinter sich zu.
Carola sah ihm hinterher. Also wenn du mich fragst, dachte sie, aber mich fragst du ja nicht, hab ich keinen weiteren Gesprächsbedarf. Meiner ist derzeit mit meinem Chef, den Mücken und schreckhaften Nachrückern vollauf gedeckt.
Mücken und andere Tote
Manchmal nervte ihn dieser Job. Nebeneinander und ohne ein Wort miteinander zu wechseln, ging er mit seinem Kollegen Franz Pollinger die wenigen Meter vom Echinger Parkplatz an dem stierblutroten Kiosk vorbei zur Badewiese. Lenz unterdrückte einen Fluch, als er die kleine Menschenansammlung beäugte, die sich am Ende des Fußwegs vor dem rot-weißen Absperrband gebildet hatte. Regten ihn wirklich die Gaffer auf, oder lag ihm noch das Gespräch mit Carola im Magen? Wenn man das überhaupt Gespräch nennen konnte.
»Haben die denn alle keine Arbeit?«
Aus dem Augenwinkel betrachtete er seinen Kollegen Franz Pollinger, der sich mit in die Hüften gestützten Händen umsah. Hatte er doch recht gehabt. Franz hatte sich, während er mit Beni telefonierte, noch einmal die Haare zurechtgelegt. Anders konnte er es sich nicht erklären, dass sie sich perfekt gestylt in der exakt richtigen Melange von Ordnung und Zerrauftheit über seine Ohren wellten. Dann dieses leichte Leinenhemd, schon etwas verwaschen, Ärmel nachlässig hochgekrempelt, und die nur ganz wenig zerfetzten Jeans. Dazu All Stars. Und natürlich war Franz braun gebrannt und bestens gelaunt. Lenz hätte kotzen können.
»Schon«, entgegnete der nichts ahnende Franz fröhlich, »aber du glaubst es kaum, die sind alle auf Urlaub hier. Komm, auf geht’s. Sonst ist die KTU noch vor uns da.« Ohne sich zu ihm umzudrehen, schob Franz sich zwischen die Schaulustigen und tauchte unter dem Absperrband hindurch.
Lenz klatschte mit der flachen Hand gegen sein Ohr, vor dem eine Mücke sirrte, und riss sich zusammen. Was half’s, ein Mensch war gestorben, da hatte das verunglückte Gespräch mit Carola zurückzustehen. Obwohl … was sie jetzt wohl dachte? Hatte er sie überrumpelt? Verärgert? Oder fand sie seinen Wunsch einfach nur lächerlich? Am liebsten hätte er sie angerufen, aber dafür war jetzt keine Zeit. Er reckte das Kinn, drängte sich ebenfalls zwischen den Wartenden hindurch und schloss zu Franz auf.
Die abgesperrte Wiese am nördlichen Ende des Ammersees, von Bürokraten »Echinger Erholungsgebiet« getauft, war menschenleer. Nur ganz unten am kiesigen Ufer, neben den zwei großen Weiden, die ihre Zweige dem Wasser entgegenreckten, standen neben einem Rettungswagen und zwei Polizeifahrzeugen rund zehn Leute zusammen. Über die weite Grünfläche hinweg konnte Lenz die Uniformen der Schutzpolizei, der Sanitäter und des Notarztes ausmachen. Von den Ereignissen unberührt lagerten am Rande der sauber gemähten Wiese die obligatorischen Graugänse im Morgenlicht.
Während er neben Franz die baumlose Fläche überquerte, spürte Lenz, wie ihm der Schweiß den Rücken hinunterlief. Die Frühlingssonne wanderte unerbittlich am blassblauen Himmel empor. Oder lag es an seiner erbärmlichen Kondition, dass ihm so heiß war? Er unterdrückte ein Schnaufen und ließ seinen Blick über den Ammersee schweifen, der sich von hier aus gesehen der Länge nach gen Süden erstreckte. Hinter der heute spiegelglatten silbrig glänzenden Wasserfläche erhoben sich die Alpen wie ein grauer Scherenschnitt. Nur weil er wusste, wo er suchen musste, konnte er ganz schwach die Raistinger Satellitenschüsseln und den schlanken Turm des Diessener Marienmünsters erkennen. Schnell wischte er sich die ersten Schweißtropfen von der Stirn.
»Servus miteinander«, grüßte er, um einen jovialen Tonfall bemüht, als sie sich den Uniformierten näherten. »Was ist passiert?«
Ein Schutzpolizist löste sich aus der Gruppe und trat vor. »Servus. Die Leitstelle hat den Notruf um neun Uhr vierzehn empfangen. Leblose Person im Erholungsgebiet Eching. Wir waren zeitgleich mit RKT und Notarzt hier, haben weiträumig abgesperrt. Es gibt Auffälligkeiten, deshalb haben wir euch angefordert«, knarzte er.
Lenz konnte spüren, dass Franz neben ihm grinste. »Danke«, erwiderte er, um Sachlichkeit in der Stimme bemüht. »Was sind das für Auffälligkeiten?« Er registrierte ein ungewöhnliches Geräusch in der Nähe. Weinte da jemand? Ein Junge?
»Spaziergänger wollen ein seltsames Flugobjekt am Himmel gesehen haben«, antwortete der Uniformierte.
Ein Flugobjekt? Morgens am Ammersee? Was sollte Lenz jetzt mit so einer Aussage anfangen? Ufos tauchten vor seinem inneren Auge auf. Langsam wurden wirklich alle irre.
»Ab jetzt übernehmen wir«, sagte er. »Dürfen wir?«
Der Schutzpolizist nickte und trat zur Seite. Lenz nahm eine Frau am Rand der Gruppe wahr, die einen zuckenden Jungen im Arm hielt. Weinte der so laut? Mit drei Schritten stand er neben dem Notarzt, der sich auf den zweiten Blick als Ärztin entpuppte. Die Frau kniete am Boden und beugte sich über einen Körper.
Im kurz gemähten Gras, genau dort, wo die Wiese in den Kiesstrand überging, lag eine weibliche Leiche ausgestreckt auf dem Rücken. Lenz registrierte, dass sie sich vom Wasser abgewandt hatte. War das nicht seltsam? Jeder wollte doch eigentlich den See sehen und nicht das Land. Wahrscheinlich unerheblich, dachte er und fokussierte seinen Blick wieder auf die Tote am Strand. Die dunklen Haare reichten ihr bis zur Schulter, die bloßen Arme waren leicht gebräunt. Ihre weiße taillierte Bluse war offen, sodass ein heller BH darunter hervorsah. Lenz bemerkte eine goldene Uhr mit Krokodillederarmband an ihrem Handgelenk und mehrere Ringe an ihren Fingern. Sie trug einen knielangen dunkelblauen Faltenrock und edel aussehende Lackpumps. Bis auf die aufgerissene Bluse war die Kleidung unversehrt. Allerdings kein Outfit für einen Ammersee-Spaziergang, dachte er. Und wieder flog ihn ein Gedanke an. Kannte er sie nicht von irgendwoher?
»Meisinger, Pollinger, Kripo Weilheim.« Er kniete sich neben die Ärztin. »Was haben wir?«
Die Medizinerin wandte ihren Blick nicht von der Toten ab, nickte nur eine wortlose Begrüßung. »Frau, Mitte dreißig.«
Ihr Tonfall war trocken, sachlich, norddeutsch. Passend zum Aussehen, dachte Lenz: blonder Pferdeschwanz, nicht nur schlank, sondern durchtrainiert. Blitzartig sah er Carola vor sich, und sein Herz machte einen kleinen Satz.
»Ist trotz beherzter Reanimation der Dame da drüben«, die Ärztin deutete auf die Frau mit dem weinenden Jungen im Arm, »vor rund dreißig Minuten verstorben. Als wir eintrafen, konnte ich keine Atmung mehr feststellen, und die Muskulatur war bereits erschlafft. Jetzt setzt die Livoresbildung ein. Sehen Sie hier?« Sie hob die Bluse der Toten an und deutete auf blaulila Flecken an der Taille, bevor sie den Stoffzipfel wieder fallen ließ und sich geschmeidig aufrichtete.
Im ersten Moment war er dankbar, nicht mehr in der unbequemen Hockhaltung ausharren zu müssen. Als er aufstehen wollte, musste er sich abstützen. Inständig hoffte er, dass niemand es bemerkt hatte. Ich muss dringend was für meine Fitness tun, dachte er.
Seine Wangen brannten. Mehr, um dies zu überspielen, als um seine Augen gegen die Morgensonne zu beschirmen, hob er die rechte Hand an die Stirn. »Haben Sie Hinweise auf einen Unfall? Brüche oder Abschürfungen?«
Die Ärztin schob die Unterlippe vor. »Ich konnte nichts feststellen.«
»Ich sehe, dass die Bluse geöffnet ist. Warum –«
»Wegen der Reanimation«, unterbrach ihn die Medizinerin. »Deshalb auch die Druckmale auf dem Brustkorb.«
»Ich weiß, das sollte ich eigentlich nicht fragen: Aber können Sie schon etwas zur Todesursache sagen, Frau Doktor …«, er las den in ihre Jacke eingestickten Namen, »Matthiessen?«
Sie musterte ihn mit einem kühlen Blick aus blauen Augen. »Es deutet einiges auf plötzlichen Herztod hin. Ihre Pupillen sind erweitert, die Haut um die Fingernägel grau verfärbt.« Als sie Lenz’ überraschten Gesichtsausdruck bemerkte, hob sie abwehrend die Hände. »Aber nageln Sie mich bitte nicht darauf fest«, erwiderte sie streng. »Insgesamt macht sie einen sportlichen Eindruck.«
»Das will ich meinen«, brummte Lenz, hörte aber selbst, wie viel Skepsis in seiner Stimme lag.
Die Notärztin zog spöttisch die linke Augenbraue nach oben, ihr Blick wurde noch eine Nuance kälter. »Plötzlicher Herztod gehört zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Rund zweihunderttausend Menschen versterben daran pro Jahr. Und nicht alle hatten einschlägige Vorerkrankungen oder ein durch einen überstandenen Infarkt geschädigtes Herz.« Sie schien Lenz’ kritischen Blick zu bemerken. »In etlichen Fällen bleiben Schädigungen des Herzens ein Leben lang unentdeckt. Sie können genetisch bedingte Fehlbildungen haben und nichts davon wissen. Per se kommt das auch bei jungen Menschen vor.«
Lenz dachte eine Sekunde nach. Was sollte dieser Hinweis? »Was schließen Sie daraus?«, fragte er dann.
Die erhobene linke Augenbraue zog sich mit der rechten zusammen, und eine tiefe Falte bildete sich auf der Stirn der Notärztin. Ob aus Zorn oder Genervtheit, konnte Lenz nicht sagen. Er tippte auf Letzteres.
»Wie Sie wissen oder zumindest wissen sollten, kann ein plötzlicher Herztod sowohl eine natürliche als auch unnatürliche Ursache haben«, entgegnete sie schnippisch.
Genervt also. Lenz sah in ihre blauen Augen. Nein, du bist nicht meine Caro, dachte er. Die hätte jetzt einen Witz auf meine Kosten gemacht und mich ausgelacht. Bei dem Gedanken an Carola wurde ihm warm ums Herz. »Sie meinen –«, hob er an.
»Was ich meine, ist«, unterbrach sie ihn unwirsch, »dass man einen plötzlichen Herztod mittels einer fahrlässig oder vorsätzlich fehlerhaften Medikamentengabe verursachen kann. Außerdem kann man sich überanstrengen oder sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode erschrecken. Auch das kann durch Zufall oder mit Vorsatz geschehen.«
Ein Fall vor zwei Jahren fiel Lenz ein, in dem Betablocker, die bei Herzproblemen ärztlich verordnet worden waren, eine fatale Rolle gespielt hatten. Vor diesem Hintergrund musste er der Ärztin zustimmen. Er wechselte das Thema. »Das wissen wir aber erst –«
»Wenn weitere Anhaltspunkte zur Todesursache ermittelt worden sind«, fiel sie ihm erneut ins Wort, »und zwar durch Sie. Mir bleibt nur, eine unnatürliche Todesursache festzustellen und eine Obduktion anzuordnen.«
Die lässt mich nicht ausreden, dachte er. Ich kann keinen Satz zu Ende bringen, geschweige denn einen Gedanken ausformulieren. Er beschloss, sich nicht anmerken zu lassen, dass ihre Art ihn stresste. »Sie vermerken das entsprechend auf dem Totenschein?«, fragte er, um einen sachlichen Ton bemüht.
»Sicherlich.« Doch ihr Blick strafte ihre Zustimmung Lügen. »Aber dafür müsste ich noch das Einverständnis der Angehörigen einholen, es sei denn, Sie veranlassen eine gerichtliche Obduktion. War es das jetzt?«
Diese Augen erinnern mich an die Farbe von Grönlandeis, dachte Lenz. So kalt. »Von meiner Seite aus –«
»Wenn dein Informationsbedarf gedeckt ist, Kollege Meisinger, hätte ich da noch eine Frage an Sie, verehrte Frau Dr. Matthiessen«, unterbrach ihn Franz und trat an seine Seite.