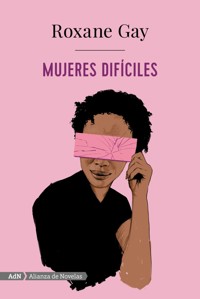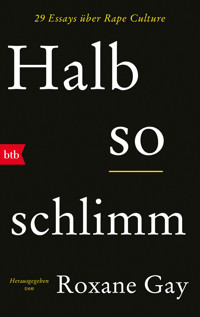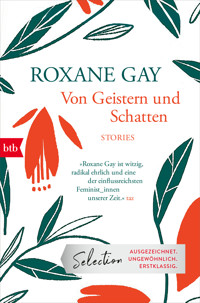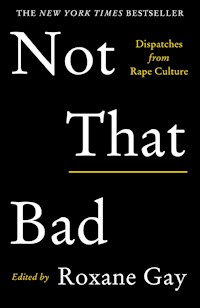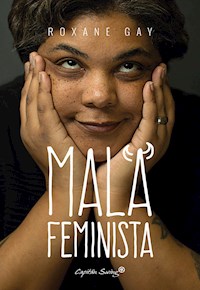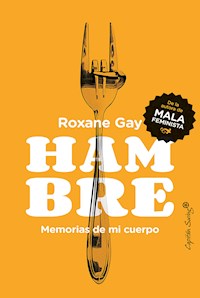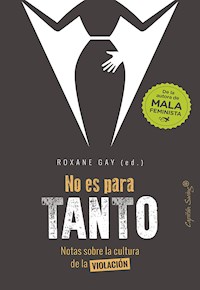9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Lesen! Lesen! Lesen!" Elle - Über Körperideale und Traumata. Der New-York-Times-Bestseller.
Sie schreibt die Geschichte ihres Hungers. Sie schreibt die Geschichte ihres Körpers. Es ist keine Geschichte des Triumphs. Es ist die eines Lebens, das in zwei Hälften geteilt ist. Es gibt das Vorher und das Nachher. Bevor sie zunahm und danach. Bevor sie vergewaltigt wurde und danach. Roxane Gay, eine der brillantesten, klügsten und aufregendsten Autorinnen der USA, erzählt eine Geschichte, die so noch nie geschrieben wurde: schonungslos offen, verstörend ehrlich und entwaffnend zart spricht sie über ihren »wilden und undisziplinierten« Körper, über Schmerz und Angst, über zwanghaftes Verlangen, zerstörende Verleugnung und Scham - »Ich war zerbrochen, und um den Schmerz dieser Zerbrochenheit zu betäuben, aß ich und aß und aß.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Sie schreibt die Geschichte ihres Hungers. Sie schreibt die Geschichte ihres Körpers. Es ist keine Geschichte des Triumphs. Es ist die eines Lebens, das in zwei Hälften geteilt ist. Es gibt das Vorher und das Nachher. Bevor sie zunahm und danach. Bevor sie vergewaltigt wurde und danach. Roxane Gay, eine der brillantesten, klügsten und aufregendsten weiblichen Stimmen der USA, erzählt eine Geschichte, die so noch nie geschrieben wurde: schonungslos offen, verstörend ehrlich und entwaffnend zart spricht sie über ihren »wilden und undisziplinierten« Körper, über Schmerz und Angst, über zwanghaftes Verlangen, zerstörende Verleugnung und Scham.
»Ein Buch von widerspenstiger Schönheit.« USA Today
»Was ich an Roxane Gay wirklich bewundere, ist ihre Unabhängigkeit – sie ist nichts und niemandem verpflichtet.« Sheila Heti
Zur Autorin
ROXANE GAY, geboren 1974, ist Autorin, Professorin für Literatur und eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen und literarischen Stimmen ihrer Zeit, der literarische Rockstar aus den USA. Sie schreibt u.a. für die New York Times und den Guardian, ist sie Mitautorin des Marvel-Comics »World of Wakanda«, der Vorlage für den hochgelobten Actionfilm »Black Panther« (2018), dem dritterfolgreichsten Film aller Zeiten in den USA. Roxane Gay ist Gewinnerin des PEN Center USA Freedom to Write Awards. Ihr Essayband und New-York-Times-Bestseller »Bad Feminist« ist ebenfalls bei btb erschienen. Sie lebt in Indiana und Los Angeles.
Die Geschichte meines Körpers
Aus dem amerikanischen Englisch von Anne Spielmann
für dich, mein Sonnenschein, weil du mir zeigst, was ich nicht länger brauche, und den Weg zu meiner Wärme findest
Teil I
1
Jeder Körper hat eine Geschichte. Hier erzähle ich meine. Es ist die Geschichte meines Körpers und meines Hungers.
2
Die Geschichte meines Körpers ist keine Geschichte des Triumphs. Sie erzählt nicht davon, wie ich erfolgreich abgenommen habe. Es gibt keine Vorher-Nachher-Bilder. Und auf dem Cover dieses Buches ist kein Foto einer schlanken Version von mir zu sehen oder ich mit einem Bein in der Jeans meines früheren dickeren Selbst. Dieses Buch ist kein Motivationsbuch. Ich habe nicht herausgefunden, wie man einen unbändigen Körper und unbändige Gelüste kontrolliert. Meine Geschichte ist keine Erfolgsgeschichte. Meine Geschichte ist einfach eine wahre Geschichte.
Ich wünschte, so sehr, ein Buch übers Abnehmen schreiben zu können und darüber, wie ich lernte, besser mit meinen Dämonen zu leben. Ich wünschte, ich könnte ein Buch darüber schreiben, wie ich mit mir selbst Frieden schloss und mich uneingeschränkt zu lieben lernte, egal, in welcher Größe. Stattdessen habe ich dieses Buch geschrieben, was mir ungeheuer schwerfiel. Viel schwerer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Als ich anfing, Hunger zu schreiben, war ich mir sicher, dass mir die Worte einfach zufliegen würden, so wie sonst auch. Und was konnte einfacher sein, als über den Körper zu schreiben, in dem ich seit über vierzig Jahren lebe? Doch ich merkte bald, dass ich nicht einfach irgendeine Geschichte über meinen Körper schreiben wollte; ich zwang mich dazu, hinzuschauen und zu sehen, was mein Körper zu tragen hat, welches Gewicht ich ihm zumute, und wie mühsam es ist, damit zu leben und immer wieder zu versuchen, es loszuwerden. Ich war gezwungen, meinen Blick auf meine dunkelsten Geheimnisse zu richten, auf die, die die Ursache meiner Schuldgefühle sind. Ich habe mich offenbart. Ich bin entblößt, schutzlos, nackt. Das ist nichts, was angenehm ist. Das ist nicht einfach.
Ich wünschte, ich hätte die Stärke und Willenskraft, die man braucht, um hier eine Erfolgsgeschichte zu erzählen. Ich bin auf der Suche nach dieser Art von Stärke und Willenskraft. Ich bin dazu entschlossen, mehr zu sein als mein Körper – mehr als das, was mein Körper ertragen hat, was mein Körper geworden ist. Aber Entschlossenheit hat mich bisher nicht sehr weit gebracht.
Dieses Buch ist ein Bekenntnis. Es geht um die hässlichsten, schwächsten, schutzlosesten Teile von mir. Das ist meine Wahrheit. Das ist die Geschichte (nicht nur) meines Körpers, denn sehr oft werden Geschichten von Körpern wie meinem ignoriert oder verworfen oder verhöhnt. Man sieht einen Körper wie meinen und zieht seine Schlüsse. Man glaubt, die Gründe zu kennen. Aber niemand kennt sie. Dieses Buch ist keine Erfolgsgeschichte, aber es ist eine Geschichte, die erzählt werden muss, und die es verdient, gehört zu werden.
Dieses Buch erzählt von meinem Körper, von meinem Hunger, und letztendlich erzählt es vom Verlorengehen und Verschwinden und von der Sehnsucht, der wirklich starken Sehnsucht, gesehen und verstanden zu werden. Dieses Buch erzählt davon, wie ich – so lange es auch gedauert haben mag – lernte, mir selbst zu erlauben, gesehen und verstanden zu werden.
3
Wenn ich die Geschichte meines Körpers erzähle, erzähle ich dann auch, wie viel ich gewogen habe, als ich am schwersten war? Soll ich diese Zahl nennen, deren beschämende Wahrheit mir immer noch den Atem stocken lässt? Oder soll ich lieber sagen, dass ich weiß, dass die Wahrheit meines Körpers kein Grund zur Scham sein sollte? Oder soll ich die Wahrheit doch einfach aussprechen, die Luft anhalten und auf das Urteil warten?
Als ich am schwersten war, wog ich 261 Kilo bei einer Körpergröße von einem Meter einundneunzig. Das ist eine atemberaubende Zahl, eine, die ich selbst kaum begreifen kann, aber es war die Wahrheit meines Körpers. Ich erfuhr diese Zahl in einer Klinik in Weston, Florida. Ich weiß nicht, wie die Dinge so außer Kontrolle geraten konnten, und ich weiß es doch.
Mein Vater fuhr mit mir in die Klinik. Ich war Ende zwanzig. Es war irgendwann im Juli. Draußen war es heiß und drückend und ausladend grün. In der Klinik war die Luft eiskalt und steril. Alles war glatt, überall teures Holz, Marmor. Ich dachte: So verbringe ichalso meine Sommerferien.
Außer mir waren noch sieben andere Leute im Konferenzraum der Klinik, wo die Orientierungsveranstaltung zum Thema Magenbypassoperationen stattfand – zwei dicke Männer, eine leicht übergewichtige Frau und ihr dünner Ehemann, zwei Leute in weißen Kitteln und noch eine sehr dicke Frau. Ich betrachtete sie und tat, was dicke Menschen gern in Gesellschaft anderer dicker Menschen tun: Ich verglich mich mit ihnen. Ich war dicker als fünf, dünner als zwei. So schätzte ich mich zumindest ein. Für 270 Dollar verbrachte ich fast den ganzen Tag damit, mir anzuhören, wie vorteilhaft es wäre, meine Anatomie drastisch zu verändern, um abzunehmen. Laut den Ärzten war das »die einzig wirkungsvolle Therapie bei Adipositas«. Sie waren Ärzte. Sie mussten wissen, was das Beste für mich war. Und ich wollte ihnen glauben.
Ein Psychiater erzählte uns, wie wir uns auf die OP vorbereiten sollten, worauf es beim Essen ankommen würde, wenn unsere Mägen erst einmal auf Daumengröße verkleinert worden waren, dass wir akzeptieren sollten, dass die »normalen Menschen« (sein Ausdruck, nicht meiner) um uns herum vielleicht versuchen würden, unseren Gewichtsverlust zu sabotieren, weil sie ihre eingefahrene Vorstellung von uns als Dicken nicht aufgeben wollen. Wir erfuhren, dass unser Körper für den Rest unseres Lebens unter dem Mangel an bestimmten Nährstoffen leiden würde, dass wir beim Essen und Trinken strengste Zeitvorgaben zu beachten hätten. Unsere Haare würden dünner werden, vielleicht ausfallen. Wir würden womöglich unter dem Dumping-Syndrom leiden, bei dem sich der Mageninhalt zu schnell entleert – mit äußerst unangenehmen Folgen. Und natürlich gab es die üblichen Risiken eines chirurgischen Eingriffs. Wir konnten auf dem OP-Tisch sterben oder in den darauffolgenden Tagen einer Infektion zum Opfer fallen.
Es gab Vorteile und Nachteile. Nachteil: Unser Leben und unser Körper würden nie mehr so sein wie jetzt (falls wir den Eingriff überlebten). Vorteil: Wir würden dünn sein. Wir würden im ersten Jahr nach der OP 75 Prozent unseres Übergewichts verlieren. Wir würden fast normal werden.
Was diese Ärzte uns da anboten, war wirklich sehr verlockend: die Aussicht darauf, ein paar Stunden lang tief zu schlafen, und ein paar Monate nach dem Aufwachen all unsere Probleme los zu sein. Das konnte natürlich nur funktionieren, wenn wir uns weiterhin einredeten, dass unser Körper unser größtes Problem sei.
Nach der Präsentation durften Fragen gestellt werden. Ich hatte keine Fragen, aber die Frau, die rechts von mir saß, die Frau, die hier offensichtlich fehl am Platz war, weil sie höchstens zwanzig Kilo Übergewicht hatte, dominierte die ganze Gruppe, indem sie so persönliche Fragen stellte, dass es mir fast das Herz brach. Während sie die Ärzte löcherte, saß ihr Mann neben ihr und grinste. Allen war klar, warum sie hier war. Es ging um ihn und wie er ihren Körper sah. Wie traurig, dachte ich und beschloss, nicht daran zu denken, warum ich mit ihr in diesem Raum saß, beschloss, nicht daran zu denken, dass es auch in meinem Leben sehr viele Leute gab, die meinen Körper sahen, bevor sie mich sahen.
Später zeigten uns die Ärzte dann Videos von der OP: Kameras und chirurgische Instrumente in schleimigen Körperhöhlen, die wesentliche Teile eines menschlichen Körpers auftrennten, verschoben, versperrten, entfernten. Die Körperhöhlen waren feucht und rot und rosa und gelb. Es war grotesk, und es war gruselig. Mein Vater, der links von mir saß, war aschfahl im Gesicht, weil ihn die brutalen Aufnahmen so erschütterten. »Was meinst du?«, fragte er leise. »Das ist eine krasse Freak Show«, sagte ich. Er nickte. Zum ersten Mal seit Jahren waren wir uns einig. Dann endete der Film, der Arzt lächelte und erklärte betont ruhig und freundlich, dass die ganze Prozedur nur kurz daure, da man sie laparoskopisch erledige. Er versicherte uns, dass er schon über dreitausend Operationen dieser Art durchgeführt habe und nur ein einziger Patient gestorben sei – ein Mann von 385 Kilo, sagte er, wobei er seine Stimme zu einem entschuldigenden Flüstern senkte, als ob die Schande dieses Körpers die volle Kraft seiner Stimme nicht verdiente. Dann teilte er uns mit, was uns die Glückseligkeit kostete: 25 000 Dollar, minus 270 Dollar Erlass der Gebühr für den Orientierungskurs, wenn man gleich zahlte.
Bevor diese Folterveranstaltung vorbei war, gab es noch eine Einzelkonsultation mit dem Arzt in einem kleineren Untersuchungsraum. Bevor der Arzt kam, nahm sein Assistent, ein Praktikant, meine Daten auf. Ich wurde gewogen, gemessen, still beurteilt. Der Praktikant hörte mein Herz ab, betastete meinen Hals, notierte irgendwas. Eine halbe Stunde später rauschte der Arzt herein. Er betrachtete mich von oben bis unten. Er warf einen Blick auf meinen Anmeldebogen, blätterte rasch mehrere Seiten durch. »Ja, ja«, sagte er. »Sie sind für diesen Eingriff perfekt geeignet. Wir machen gleich einen Termin.« Dann war er weg. Der Praktikant füllte ein Formular für die Tests aus, die ich noch machen musste, und ich verließ die Klinik mit einem Blatt Papier in der Hand, das bestätigte, dass ich an der Orientierungsveranstaltung teilgenommen hatte. Es war klar, dass sie das hier jeden Tag machten. Ich war nicht einzigartig. Ich war nichts Besonderes. Ich war ein Körper, der repariert werden musste, und es gibt viele von uns auf dieser Welt, die mit solchen absolut menschlichen Körpern leben.
Mein Vater, der in der luxuriös eingerichteten Empfangshalle gewartet hatte, legte mir die Hand auf die Schulter. »Du bist noch nicht so weit«, sagte er. »Ein bisschen mehr Selbstdisziplin. Zweimal am Tag Sport. Das ist alles, was du brauchst.« Ich stimmte ihm heftig nickend zu, aber später, allein in meinem Zimmer, studierte ich die Flyer, die ich bekommen hatte, und konnte meinen Blick nicht von den Vorher-Nachher-Bildern abwenden. Ich sehnte mich – und sehne mich noch immer – so sehr nach diesem Nachher.
Und ich dachte an die Zahl nach dem Messen und Wiegen und Bewertetwerden, an diese unfassbare Zahl: 261 Kilo. Ich hatte geglaubt, das Gefühl der Scham zu kennen, aber erst an diesem Abend wusste ich, was Scham wirklich ist. Ich wusste nicht, ob ich je einen Weg finden würde, der mich über diese Scham hinausführen würde, hin zu einem Ort, an dem ich meinen Körper anschauen, meinen Körper annehmen, meinen Körper verändern konnte.
4
Dieses Buch, Hunger, erzählt davon, wie sich das Leben anfühlt, wenn man nicht nur ein paar Pfund oder vielleicht sogar 20 Kilo Übergewicht hat. Es handelt davon, wie sich das Leben anfühlt, wenn man 140 oder 180 Kilo Übergewicht hat, wenn man nicht fettleibig oder krankhaft fettleibig, sondern extrem krankhaft fettleibig ist, laut dem Body-Mass-Index oder BMI.
BMI ist ein Begriff, der so technisch und inhuman klingt, dass ich immer dazu neige, ihn zu ignorieren. Doch es ist ein Begriff, ein Maßstab, der es Medizinern erlaubt, undisziplinierten Körpern ein Gefühl für Disziplin beizubringen.
Der BMI ist das Gewicht eines Menschen, geteilt durch das Quadrat seiner Körpergröße. Mathe ist schwer. Es gibt diverse Kategorien, durch die man dann das Ausmaß der Widerspenstigkeit definieren kann, das ein menschlicher Körper mit sich herumträgt. Wenn der BMI zwischen 18,5 und 24,9 liegt, ist man »normal«. Wenn der BMI 25 oder höher ist, ist man leicht übergewichtig. Wenn der BMI 30 oder höher ist, ist man adipös Grad I, wenn der BMI höher liegt als 35, ist man adipös Grad II, und wenn der Wert höher ist als 40, ist man adipös Grad III. Mein BMI ist höher als 50.
In Wahrheit sind viele medizinische Kennzeichnungen willkürlich. Man sollte im Kopf behalten, dass Mitglieder einer renommierten amerikanischen Forschungseinrichtung, des National Heart, Lung, and Blood Institutes, vor einiger Zeit den BMI-Grenzwert für »normale« Körper auf unter 25 senkten und damit die Zahl der adipösen Amerikaner verdoppelten. Einer ihrer Gründe für die Senkung des Werts: »Eine markante Zahl wie 25 prägt sich den Menschen leichter ein.«
Die Begriffe sind selbst schon erschreckend. »Adipös« kommt vom lateinischen »adeps«, das lauter negative Bedeutungen hat: Neben »Schmalz«, »Fett« und »Schmerbauch« bedeutet es auch »Schwulst«. Wenn man also »adipös« sagt, schwingt immer schon eine Anklage darin mit. Es ist seltsam und vielleicht traurig, dass gerade Ärzte, die eigentlich Schaden von Menschen abwenden sollten, diesen Terminus prägten. »Krankhafte Adipositas« als Bezeichnung für den extrem dicken Körper klingt für mich fast wie ein Todesurteil, und von vielen Medizinern wird man genau so behandelt.
Adipös scheint in der kulturellen Wahrnehmung jede Frau zu sein, die nicht in Größe 36 passt oder deren Körper nicht den Erwartungen des männlichen Blicks entspricht oder die an den Oberschenkeln Cellulite hat.
Ich wiege heute keine 261 Kilo mehr. Ich bin immer noch extrem dick, aber ich wiege 70 Kilo weniger. Mit jedem neuen Diätversuch verliere ich ein paar Kilo hier, ein paar Kilo dort. Aber das ist relativ. Ich bin nicht zierlich. Ich werde nie zierlich sein. Erstens, weil ich groß bin. Das ist sowohl ein Fluch als auch ein Segen. Ich höre oft, dass ich präsent sei. Ich nehme Raum ein. Ich schüchtere ein. Ich will möglichst wenig Raum einnehmen. Ich will, dass mich keiner bemerkt. Ich will mich verstecken. Ich will verschwinden, bis ich Kontrolle über meinen Körper gewonnen habe.
Ich weiß nicht, wie die Dinge so außer Kontrolle geraten konnten, und ich weiß es doch. Das ist mein Refrain. Die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren hieß zuzunehmen. Ich habe angefangen zu essen, um meinen Körper zu verändern. Das hatte ich wirklich gewollt. Ein paar Jungs hatten mich zerstört, und ich hatte es fast nicht überlebt. Ich wusste, ich würde keinen zweiten Übergriff dieser Art ertragen, und deshalb habe ich gegessen, weil ich dachte, wenn mein Körper abstoßend wäre, würde das die Männer von mir fernhalten. Schon als ich jung war, begriff ich, dass Dicksein hieß, von Männern nicht begehrt zu werden, von ihnen verachtet zu werden, und ich wusste schon viel zu viel darüber, was diese Verachtung bedeutete. Das ist es, was den meisten Mädchen beigebracht wird: dass wir schlank und zierlich sein sollen. Wir sollen keinen Raum einnehmen. Wir sollen gesehen und nicht gehört werden, und wenn wir gesehen werden, soll unser Anblick Männern gefallen und der Gesellschaft nicht negativ auffallen. Die meisten Frauen wissen, dass von uns erwartet wird, dass wir verschwinden, aber es ist etwas, was gesagt werden muss, laut und immer wieder, damit wir uns der Erwartung, der wir uns unterwerfen sollen, widersetzen können.
5
Es ist wichtig zu wissen, dass mein Leben in zwei Hälften geteilt ist, auch wenn diese an manchen Stellen ineinander übergehen. Es gibt das Vorher und das Nachher. Bevor ich zunahm und danach. Bevor ich vergewaltigt wurde und danach.
6
Im Vorher meines Lebens war ich jung und behütet. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, dass mir Leid widerfahren konnte, und ich wusste nicht, wie unendlich und tief das Leid, das Menschen widerfährt, sein kann. Ich wusste nicht, dass ich meinem Schmerz eine Stimme geben konnte, als es mir widerfahren war. Ich wusste nicht, dass ich mit meinem Leiden anders und besser hätte umgehen können. Von allem, was ich jetzt weiß und von dem ich wünschte, ich hätte es schon damals gewusst, wünschte ich vor allem, ich hätte gewusst, dass ich mit meinen Eltern hätte sprechen und mir Hilfe hätte holen können, dass es einen anderen Weg gegeben hätte als das Essen. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass es nicht mein Fehler war, so verletzt zu werden.
Was ich wusste, war, dass es Essen gab, also aß ich, weil ich verstanden hatte, dass ich damit mehr Raum einnehmen konnte. Ich konnte kräftiger und stärker werden, mich sicherer fühlen. Ich begriff – weil ich sah, wie die Leute dicke Menschen anstarrten, wie ich selbst dicke Menschen anstarrte –, dass zu viel Gewicht nicht begehrenswert ist. Wenn ich nicht begehrenswert war, konnte ich weiteren Schmerz verhindern. Wenigstens hoffte ich, weiteren Schmerz verhindern zu können. Im Nachher meines Lebens kannte ich mich schon viel zu gut mit dem Schmerz aus, aber obwohl ich mich schon so gut damit auskannte, wusste ich nicht, wie viel mehr ein Mädchen leiden kann, bevor ich es tat.
Aber. Das ist es, was ich tat. Das ist der Körper, den ich schuf. Ich bin sehr dick, ich bin fett – ich habe dicke Rollen aus braunem Fleisch an Armen und Schenkeln und Bauch. Das Fett passte irgendwann nirgends mehr hin, also schuf es sich seine eigene Gestalt um meinen Körper herum. Ich bin von Dehnungsstreifen zerklüftet, ich habe tiefe Cellulitetaschen an meinen massiven Oberschenkeln. Das Fett schuf einen neuen Körper, einen Körper, für den ich mich schämte, der mir aber auch das Gefühl von Sicherheit gab, und das war es, was ich so unbedingt brauchte, wonach ich mich so verzweifelt sehnte – mich sicher zu fühlen. Ich musste mich fühlen wie eine Festung, undurchdringbar. Ich wollte nicht, dass irgendetwas oder irgendjemand mich berührte.
Ich habe mir das selbst angetan. Es ist mein Fehler und meine Verantwortung. Das ist es, was ich mir selbst erzähle, obwohl ich die Verantwortung für diesen Körper nicht alleine tragen sollte.
7
In meinem Körper zu leben bedeutet: Ich bin gefangen in einem Käfig. Das Frustrierende an Käfigen ist, dass man darin sitzt, aber draußen genau das sehen kann, was man haben will. Man kann die Hand aus dem Käfig strecken, kommt aber nicht weit genug.
Es wäre einfach vorzugeben, dass ich mich in meinem Körper, so wie er ist, wohlfühle. Ich wünschte, ich würde meinen Körper nicht als etwas betrachten, für das ich mich entschuldigen oder das ich erklären muss. Als Feministin glaube ich, dass es richtig wäre, die rigiden Schönheitsmaßstäbe abzuschaffen, die Frauen dazu nötigen, sich unrealistischen Idealen anzupassen. Ich glaube, wir sollten unsere Definition von Schönheit auf unterschiedliche Arten von Körpern ausdehnen. Ich glaube, dass es für Frauen extrem wichtig ist, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, ohne dass sie jeden einzelnen Teil dieses Körpers ändern wollen. Ich glaube (oder ich möchte gerne glauben), dass mein Wert als Mensch nicht mit meiner Körpergröße, meinem Gewicht oder meinem Aussehen zusammenhängt. Da ich in einer Kultur aufgewachsen bin, die auf Frauen toxisch wirkt und die ständig versucht, Frauenkörper zu disziplinieren, weiß ich, dass es wichtig ist, sich unangemessenen Normen zu widersetzen, die meinem oder irgendjemandes Körper vorschreiben wollen, wie er auszusehen hat.
Was ich weiß und was ich fühle sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn ich mich in meinem Körper wohlfühlen möchte, hat das nicht nur etwas mit Schönheitsnormen zu tun. Auch nicht nur mit Idealen. Es geht darum, wie ich mich in meiner Haut fühle, jeden einzelnen Tag.
Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Fast alles Physische fällt mir schwer. Wenn ich mich bewege, spüre ich jedes Kilo Übergewicht, das ich mit mir herumtrage. Ich habe keine Kondition. Wenn ich längere Zeit zu Fuß gehe, tun mir Oberschenkel und Waden weh. Die Füße tun mir weh. Der untere Rücken tut mir weh. Sehr oft habe ich körperliche Schmerzen. Morgens bin ich so steif, dass ich mich frage, ob es nicht besser wäre, einfach den ganzen Tag im Bett liegen zu bleiben. Ich habe einen eingeklemmten Nerv, und wenn ich zu lange stehe, wird mein rechtes Bein taub, und ich muss eine Weile herumhumpeln, bevor das Gefühl darin zurückkehrt.
Wenn es heiß ist, schwitze ich unmäßig, hauptsächlich am Kopf, und das ist mir dann peinlich, und ich wische mir ständig den Schweiß vom Gesicht. Bäche von Schweiß entspringen zwischen meinen Brüsten, oberhalb des Steißbeins bilden sich salzige Pfützen. Mein Shirt wird feucht, und auf dem Stoff sieht man dunkle Schweißflecken. Ich habe das Gefühl, die Leute starren auf meine feuchte Haut und verurteilen mich für diesen widerspenstigen Körper, der so schamlos schwitzt und es wagt zu zeigen, wie sehr ihn jede Bewegung anstrengt.
Es gibt Dinge, die ich mit meinem Körper tun will und nicht tun kann. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, kann ich nicht mit ihnen Schritt halten, deshalb denke ich mir ständig Ausreden aus, um meine Langsamkeit zu erklären – als wüssten sie nicht, was los ist. Manchmal tun sie, als wüssten sie es wirklich nicht, und manchmal ist es, als würden sie tatsächlich vergessen, dass es Unterschiede darin gibt, wie Körper sich bewegen und welchen Raum sie einnehmen. Sie drehen sich zu mir um und schlagen unmögliche Dinge vor, zum Beispiel, dass wir in einen Vergnügungspark oder eine Meile bergauf oder in ein Stadion gehen oder eine Wanderung zu einem Aussichtspunkt in der Gegend machen könnten.
Mein Körper ist ein Käfig. Mein Körper ist ein von mir selbst geschaffener Käfig. Ich versuche immer noch, einen Weg zu finden, wie ich aus ihm herauskomme. Seit über zwanzig Jahren versuche ich schon, einen Weg zu finden, wie ich aus ihm herauskomme.
8
Wenn ich über meinen Körper schreibe, sollte ich dieses Fleisch, diese Überfülle an Fleisch vielleicht studieren wie einen Ort, an dem ein Verbrechen geschah. Ich sollte diesen Körper als ein Indiz betrachten, um das Motiv für das Verbrechen aufzudecken.
Ich will meinen Körper nicht als einen Tatort verstehen. Ich will meinen Körper nicht als etwas betrachten, was entsetzlich schiefgegangen ist, was abgesperrt und kriminalistisch untersucht werden muss.
Ist mein Körper ein Tatort, wenn ich schon weiß, dass ich der Täter bin oder wenigstens einer der Täter?
Oder sollte ich mich selbst als Opfer des Verbrechens sehen, das in meinem Körper stattfand?
Ich bin gezeichnet, auf so viele Weisen gezeichnet, durch das, was ich durchgemacht habe. Ich habe es überlebt, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, wie wichtig es ist zu überleben und sich als »Überlebende« zu bezeichnen, aber ich habe auch nichts gegen die Bezeichnung »Opfer«. Ich glaube auch nicht, dass es demütigend wäre zu sagen: Als ich vergewaltigt wurde, wurde ich zum Opfer, und bis heute bin ich, obwohl ich auch noch vieles andere bin, immer noch auch Opfer.
Ich brauchte ziemlich lange dafür, aber heute ziehe ich das Wort »Opfer« dem Wort »Überlebende« vor. Ich will das Gewicht dessen, was passiert ist, nicht kleinreden. Ich will nicht so tun, als wäre ich auf irgendeiner erfolgreichen, erbaulichen Reise. Ich will nicht so tun, als wäre alles okay. Ich lebe mit dem, was passiert ist, ich gehe meinen Weg, ohne zu vergessen, ich gehe meinen Weg, ohne vorzugeben, ich hätte keine Narben davongetragen.
Das ist die Geschichte meines Körpers. Mein Körper wurde zerbrochen. Ich wurde zerbrochen. Ich wusste nicht, wie ich mich wieder zusammensetzen sollte. Ich war zersplittert. Ein Teil von mir war tot. Ein Teil von mir war stumm und sollte viele Jahre lang stumm bleiben.
Ich war ausgehöhlt. Ich war entschlossen, die Leere in mir zu füllen, und Essen war das, was ich benutzte, um einen Panzer entstehen zu lassen. Einen Panzer, der das Wenige schützte, was von mir geblieben war. Ich aß und aß und aß in der Hoffnung, dass mein Körper sicher wäre, wenn ich ihn dick machte. Ich begrub das Mädchen, das ich gewesen bin, weil es immer in alle möglichen Schwierigkeiten geriet. Ich versuchte, jede Erinnerung an dieses Mädchen zu tilgen, aber es ist immer noch da, irgendwo. Es ist immer noch klein und zierlich und verängstigt und schämt sich, und vielleicht schreibe ich mich zu ihm zurück, indem ich ihm alles sage, was es erfahren muss.
9
Ich war zerbrochen, und um den Schmerz dieser Zerbrochenheit zu betäuben, aß ich und aß und aß, und dann war ich nicht einfach übergewichtig oder dick. Weniger als zehn Jahre später war ich krankhaft fettleibig, und dann war ich extrem krankhaft fettleibig. Ich war gefangen in einem Körper, den ich selbst geschaffen hatte, aber kaum kannte und nicht verstand. Ich fühlte mich furchtbar, aber ich war sicher. Oder wenigstens konnte ich mir einreden, dass ich sicher sei.
Meine Erinnerungen an das Nachher sind zerstreut, fragmentarisch, aber woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass ich aß und aß und aß, um zu vergessen und meinen Körper so groß und dick werden zu lassen, dass er nie wieder zerbrechen konnte. Ich erinnere mich an den stillen Trost des Essens, wenn ich einsam oder traurig war und sogar, wenn es mir gutging.
Heute bin ich eine sehr dicke Frau. Ich glaube nicht, dass ich hässlich bin. Ich hasse mich nicht so sehr, wie es gesellschaftlich erwünscht wäre, und doch lebe ich in dieser Welt. Ich lebe in diesem Körper in dieser Welt, und ich hasse es, wie die Welt auf diesen Körper reagiert. Mein Verstand weiß, dass ich nicht das Problem bin. Diese Welt und ihre Weigerung, mich zu akzeptieren und anzuerkennen, sind das Problem. Aber wahrscheinlich werde eher ich mich selbst ändern, bevor diese Kultur und ihre Haltung dicken Menschen gegenüber sich verändert. Ich muss den Kampf für Body Positivity kämpfen, aber ich muss auch über meine Lebensqualität im Hier und Jetzt nachdenken.
Seit über zwanzig Jahre lebe ich jetzt schon in diesem nicht zu bändigenden Körper. Ich habe versucht, mit diesem Körper Frieden zu schließen. In einer Welt, die nur Verachtung für meinen Körper übrig hat, habe ich versucht, ihn zu lieben oder wenigstens zu tolerieren. Ich habe versucht, das Trauma zu überwinden, das mich dazu gebracht hat, mir diesen Körper zu schaffen. Ich habe versucht, zu lieben und zuzulassen, geliebt zu werden. In einer Welt, in der jeder und jede glaubt zu wissen, warum mein Körper so ist, wie er ist, und warum der Körper anderer dicker Menschen so ist, wie er ist, bin ich stumm geblieben und habe meine Geschichte verschwiegen. Und jetzt will ich nicht länger schweigen. Ich zeichne die Geschichte meines Körpers nach, von der Zeit, als ich ein junges Mädchen war, das seinem Körper vertrauen konnte und sich in seinem Körper sicher fühlte, bis zu dem Moment, als die Sicherheit zerstört wurde, und zu der Zeit des Danach, die noch immer andauert, obwohl ich so sehr versuche, vieles von dem ungeschehen zu machen, was mir angetan wurde.
Teil II
10
Es gibt ein Foto von mir. Meine ältere Cousine hält mich am Tag meiner Taufe auf dem Arm. Ich bin ein kleines Kind in einem langen weißen Satinkleid. Wir sitzen auf einer Couch mit Plastikbezug in New York. Auf diesem Foto ist meine Cousine älter, vielleicht fünf oder sechs. Ich krümme mich in besinnungsloser Babywut und verrenke dabei Arme und Beine.
Ich bin dankbar dafür, dass es so viele Kinderfotos von mir gibt, weil es so vieles gibt, was ich inzwischen vergessen habe.
Es gibt viele Jahre meines Lebens, an die ich keinerlei Erinnerung habe. Jemand aus meiner Familie sagt: »Weißt du noch [hier kann fast jedes wichtige Familienereignis eingesetzt werden]?« Und ich kann mein Gegenüber nur ratlos anschauen, denn ich erinnere mich an absolut nichts. Wir teilen eine Geschichte und doch auch wieder nicht. Das ist in vielerlei Hinsicht die beste Beschreibung der Beziehung zu meiner Familie und zu fast jedem Menschen in meinem Leben. Es gibt das übergeordnete Leben, das wir teilen, und dann die schwierigeren Teile meines Lebens, die wir nicht teilen und von denen sie alle sehr wenig wissen. Woran ich mich erinnere und woran nicht, folgt keiner Logik oder Struktur. Dass ich so viel vergesse, ist seltsam, denn es gibt Momente in meiner Kindheit, an die ich mich so deutlich erinnere, als wären sie gestern passiert.
Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich kann mich noch Jahre später fast wörtlich an Gespräche erinnern, die ich einmal mit Freunden und Freundinnen führte. Ich erinnere mich daran, dass die Haare meiner Lehrerin in der vierten Klasse platinblond waren und dass ich in der dritten Klasse Ärger bekam, weil ich während des Unterrichts aus Langeweile ein Buch las. Ich erinnere mich an die Hochzeit meiner Tante und meines Onkels in Port-au-Prince und dass mein Knie nach einem Mückenstich so dick wurde wie eine Orange. Ich erinnere mich an Gutes. Ich erinnere mich an Schlechtes. Wenn ich muss, kann ich Erinnerungen auslöschen, und das habe ich manchmal, wenn es nötig war, getan.
Ich habe mehrere Fotoalben mit Bildern aus dem Haus meiner Eltern mitgenommen, Alben voller vergilbter Kinderfotos von meinen beiden Brüdern und mir. Die digitale Ära war noch nicht angebrochen, und doch scheint es, als sei fast jeder Augenblick meines Lebens fotografiert und jedes Foto entwickelt und sorgfältig archiviert worden. Auf jedem Album steht eine große Zahl mit einem Kreis darum. In vielen Alben gibt es kurze Bildunterschriften mit Namen und Angaben zu Alter und Orten. Es ist, als hätte meine Mutter gewusst, dass diese Erinnerungen aus einem bestimmten Grund aufbewahrt werden müssen. Sie hat meine Brüder und mich mit eisernem Willen und ihrem ganz eigenen Charme erzogen. Die Leidenschaft ihrer Liebe und ihrer Hingabe ist bemerkenswert, und diese Leidenschaft wird stärker, je älter wir werden. Als ich klein war, legte meine Mutter diese Alben mit größter Sorgfalt an. Immer wenn eines vollgeklebt war, kaufte sie das nächste und klebte es ebenfalls voll.
Meine Mutter hat die Leerstellen meiner Kindheit auszufüllen versucht, auch wenn ihr nicht bewusst war, dass sie es tat. Sie erinnert sich an alles, jedenfalls kommt es mir so vor oder jedenfalls war es so, bis ich mit dreizehn auf ein Internat kam, und dann gab es niemanden mehr, der meine Erinnerungen für mich aufbewahrte.
Meine Mom fotografiert auch heute noch alles Mögliche und hat über zwanzigtausend Fotos auf Flickr, Bilder von ihrem Leben und von unserem Leben und den Menschen und Orten unseres Lebens. Bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit war sie da, natürlich mit ihrer Kamera, vor Stolz ließ sie mich nicht aus den Augen, schoss alle paar Minuten ein Bild, um jede Sekunde dieses wichtigen Ereignisses festzuhalten. Bei einer Lesung aus meinem ersten Buch in New York war sie auch wieder da, mit ihrer Kamera, fotografierte, dokumentierte ein anderes wichtiges Ereignis.
Viele Leute bemerken, dass ich selbst ständig alles fotografiere. Ich sage ihnen, dass ich das tue, um all das Schöne, das ich sehe und erfahren darf, nicht zu vergessen, um es nicht vergessen zu können. Ich erkläre ihnen nicht, dass mir Erinnerungen heute wichtiger sind, weil mein Leben anders geworden ist. Tatsächlich ist es mehr als das. Ich bin in so vielerlei Hinsicht die Tochter meiner Mutter, dass selbst unendlich viele Worte nicht ausreichen würden, um unsere Ähnlichkeit zu beschreiben.
Der Einband meines Babyalbums ist weiß mit glitzernden Punkten. »Es ist ein Mädchen!«, prangt in großen Buchstaben darauf. Auf der ersten Seite stehen die Namen meiner Eltern, mein Geburtsdatum, meine Größe und mein Gewicht sind verzeichnet, meine Haar- und Augenfarbe. Es gibt zwei schwarze Abdrücke meiner kleinen Füße, darüber steht: »Ein Gay-Mädchen«. Ich kam morgens um 7 Uhr 48 auf die Welt, weshalb ich, da bin ich mir sicher, kein Morgenmensch bin. Unter der Überschrift »Aufregende Momente im Leben unserer Kleinen« sind alle vorgedruckten Linien ausgefüllt mit meinen ersten winzigen Erfolgen. Offensichtlich kannte ich mit zweieinhalb schon alle Buchstaben des Alphabets und konnte mit drei die Uhr lesen. Stolz schrieb meine Mutter: »Mit fünf liest sie schon fast alles.« Genau so steht es dort geschrieben, in ihrer schönen, akkuraten Handschrift, obwohl man sich heute in meiner Familie erzählt, dass ich schon anderthalb Jahre früher mit meinem Dad zusammen die Zeitung studierte.
In den ersten fünf Jahren meines Lebens dokumentierte meine Mutter regelmäßig meine Größe und mein Gewicht. Ich hatte einen großen dreieckigen Kopf, was bei einem erstgeborenen Kind gelegentlich vorkommt. Meine Mutter sagt, dass sie Stunden damit verbrachte, meinen Neugeborenen-kopf in eine rundere Form zu streicheln. Im Omaha World-Herald stand am 28. Oktober 1974, dreizehn Tage nach meinem Geburtstag, eine Geburtsanzeige, die sich ebenfalls in dem Album befindet, neben der Geburtsurkunde und der kleinen Karte, die mein Bettchen im Krankenhaus zierte. Meine Mutter war fünfundzwanzig und mein Vater siebenundzwanzig, sie waren so jung, wenn auch für diese Zeit, in der viele andere viel früher Familien gründeten, nicht besonders jung. Auf der Geburtsurkunde ist mein Vorname richtig geschrieben, mit einem n, und das Papier ist rosa. Ein differenziertes kulturelles Geschlechterverständnis gab es damals nicht – Mädchen waren rosa und Jungen blau, und damit war der Fall erledigt.
Auf dem allerersten Bild von meiner Mutter und mir hält sie mich auf dem Arm, und ihr tiefschwarzes Haar fällt in einem dicken Pferdeschwanz über ihren Rücken. Sie sieht ungeheuer jung und wunderschön aus. Ich bin drei Tage alt. Eigentlich ist es nicht das erste Bild von uns beiden. Es gibt noch ein Foto meiner Mom mit riesigem Babybauch. Sie trägt einen schicken blauen Minirock und hohe Schuhe mit klobigen Absätzen. Ihr Haar trägt sie offen und wild. An ein Auto gelehnt schaut sie den Fotografen, meinen Vater, mit einem so innigen Blick an, dass ich weglaufen will, um ihr vertrautes Zusammensein nicht zu stören. Sie hat dieses Foto in das Album geklebt, obwohl sie zu den diskretesten Menschen gehört, die ich kenne. Sie wollte, dass ich dieses wunderschöne Bild sehe, damit ich weiß, dass sie und mein Vater sich immer geliebt haben.
Diese Fotos sind schon so alt, dass die Seiten des Albums an ihnen zusammenkleben. Wenn man sie entfernen würde, würden sie kaputtgehen.
Jedes Bild, auf dem ich als Kleinkind mit meinen Eltern zu sehen bin, zeigt sie mit einem Lächeln, als wäre ich das Zentrum ihrer Welt. Das war ich. Das bin ich. Eine Sache, die ich ganz sicher über mich weiß, ist, alles, was gut und stark an mir ist, beginnt mit meinen Eltern, absolut alles. Fast jedes Foto von mir als kleines Kind zeigt mich mit einem so ansteckenden Lächeln, dass ich heute noch zurücklächeln muss, wenn ich sie betrachte. Es gibt solche und andere glückliche Babys. Ich war ein glückliches Baby. Das ist nicht zu bestreiten.
Babys sind süß, aber eigentlich zu nichts zu gebrauchen, sagt meine beste Freundin. Sie können nicht besonders viel alleine tun. Man muss sie für ihre Nutzlosigkeit lieben. Auf den Bildern, auf denen ich allein zu sehen bin, sitze ich gestützt von einer Stuhllehne oder ein paar Kissen. Auf einem Bild sitze ich auf einer hässlich gemusterten roten Couch. Ich bin allein und schreie mir offenbar die Seele aus dem Leib. Es gibt mehr als ein Bild von mir, wie ich mir die Seele aus dem Leib schreie. Bilder von schreienden Babys sind lustig, wenn man weiß, es sind Bilder von glücklichen Babys, die einfach einen kindischen Wutanfall haben. Ich betrachte diese Babyfotos und denke: Ich sehe aus wie meineNichte, aber eigentlich sieht meine kleine Nichte so aus wie ich. Familie ist etwas Großes, dagegen kommt man nicht an. Man ist für immer miteinander verbunden, durch Augen und Lippen und Blut und unsere blutigen Herzen. Als ich drei war, wurde mein Bruder Joel geboren. Es gibt Fotos von ihm, wie er neben mir sitzt oder steht, braun und rundlich, mit dichtem schwarzem Haar.
Als erwachsene Frau habe ich mir diese Alben oft angeschaut. Ich versuchte, mich zu erinnern. Zuerst fahndete ich nach Bildern, die ich einem eigenen Kind zeigen könnte, um ihm zu sagen: »Da kommst du her.« Wenn ich dieses Kind hätte, sollte es wissen, dass seine Familie weiß, wie man liebt, wie unvollkommen auch immer. Es sollte wissen, dass ihre Mutter immer geliebt worden ist, und es sollte wissen, dass deshalb auch es selbst immer geliebt werden wird. Es ist wichtig, einem Kind zu zeigen, dass man es liebt, auf jegliche Art und Weise. Und das ist etwas, was ich ihm geben kann, ganz egal, wie dieses Kind in mein Leben treten wird. Später begann ich, die Fotos hinsichtlich der Menschen, die ich darauf sah, zu studieren; so kann ich mich an die Namen und die Orte, die Augenblicke erinnern, die zählen, und von denen so viele mich verlassen hatten. Ich versuche, die Erinnerungen wieder zusammenzusetzen, die ich so sorgfältig gelöscht hatte. Ich versuche, mir zu erklären, wie ich von dem Kind in diesen perfekt fotografierten Momenten zu dem Menschen geworden bin, der ich heute bin.
Ich weiß es, ich weiß es genau, und doch weiß ich es nicht. Ich weiß es, aber ich glaube, was ich wirklich will, ist zu verstehen, warum diese Distanz zwischen dem Damals und dem Heute entstehen konnte. Dieses Warum ist kompliziert, ich kriege es kaum zu fassen. Ich will es in den Händen halten, es zerschneiden oder in Stücke reißen oder verbrennen und dann in der Asche lesen, obwohl ich Angst davor habe, was ich darin sehe, und davor, nicht zu wissen, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß nicht, ob ein solches Verstehen möglich ist, aber wenn ich alleine bin, blättere ich geradezu obsessiv durch diese alten Alben. Ich will sehen, was da ist und was fehlt und was da geschehen ist, obwohl ich das Warum dafür noch immer nicht greifen kann.
Es gibt ein Bild von mir. Ich bin fünf. Ich habe große Augen und einen dünnen Hals. Ich liege mit gekreuzten Füßen auf dem Bauch auf einem Sofa und betrachte vor mich hinträumend eine Schreibmaschine aus Plastik. Ich habe immer geträumt. Selbst damals war ich schon Schriftstellerin. Seit ich klein war, zeichnete ich kleine Dörfer auf Papierservietten und schrieb Geschichten über die Leute, die in diesen Dörfern lebten. Ich liebte es, durch das Schreiben dieser Geschichten allem kurz entfliehen zu können, und ich liebte es, mir Leben vorzustellen, die anders waren als mein eigenes. Ich hatte eine wilde Fantasie. Ich träumte mit offenen Augen und hasste es, aus meinen Träumen gerissen zu werden, nur um irgendwelche alltäglichen Dinge tun zu müssen. In meinen Geschichten konnte ich mir die Freundinnen erschreiben, die ich nicht hatte. Ich konnte so viel sein, von dem ich im echten Leben nicht einmal wagte, es auch nur mit mir im Zusammenhang zu denken. Ich konnte tapfer sein. Ich konnte klug sein. Ich konnte lustig sein. Ich konnte alles sein, was ich wollte. Wenn ich schrieb, war es so einfach, glücklich zu sein.
Es gibt ein Bild von mir. Ich bin sieben; ich bin glücklich, weil ich einen Overall trage. Als Kind trug ich oft Overalls. Ich mochte sie aus vielen Gründen, aber hauptsächlich deshalb, weil sie viele Taschen hatten, in denen ich Dinge verstecken konnte, und weil sie kompliziert waren und viele Knöpfe und Ösen und Laschen hatten. In Overalls fühlte ich mich sicher, sie waren gemütlich. Auf wahrscheinlich jedem dritten oder vierten Foto aus dieser Zeit trage ich einen Overall. Das ist seltsam, aber ich war seltsam. Auf diesem speziellen Bild bin ich mit meinem Bruder Joel zu sehen, der versucht, mich im Karatestil zu attackieren, und ich weiche seinem kleinen Fuß aus. Er war immer voller Energie und ist es noch heute. Er ist drei Jahre jünger als ich. Wir haben Spaß. Wir sind uns immer noch sehr nahe. Wir waren süße Kinder. Es bricht mir das Herz zu sehen, wie glücklich ich auf diesem Foto bin. Ich würde fast alles dafür geben, wieder so frei sein zu können.
Als ich acht war, kam mein Bruder Michael Jr. zur Welt, und von da an sind wir zu dritt auf all diesen Bildern zu sehen, oft schmiegen wir uns aneinander oder fassen uns an den Händen, wenn wir in die Kamera blicken.
Ich schrieb viel und verlor mich noch mehr in Büchern. Ich las alles, was mir in die Hände fiel. Meine Lieblingsbücher waren die Bände der Serie Unsere kleine Farm. Mir leuchtete die Idee ein, dass Laura Ingalls, ein gewöhnliches Mädchen aus dem Mittleren Westen, ein gewöhnliches und doch außerordentliches Leben führen konnte, in einer Zeit, die völlig anders war als meine. Ich liebte alles in diesen Büchern – wie Pa die köstlichen Orangen nach Hause bringt, wie er aus Ahornsirup im Schnee Bonbons herstellt, den Zusammenhalt der Ingalls-Schwestern, Laura, den »Dreikäsehoch«. Ich verfolgte begierig, wie Laura später die Rivalin von Nellie Oleson ist und wie sie Almanzo Wilder kennenlernte, der dann ihr Mann wird. Atemlos las ich den Band über die ersten Jahre ihrer Ehe auf dem eigenen Hof, mit all den Problemen, die sie mit dem Land und mit ihrer Tochter Rose haben. Ich wünschte mir auch genau diese Art von beständiger, wahrer Liebe, und ich wünschte mir eine Beziehung, in der ich unabhängig sein konnte und gleichzeitig geliebt und umsorgt wäre.
Nach Unsere kleine Farm las ich alles von Judy Blume. Was ich über Sex wusste, lernte ich aus ihrem Roman Forever: Die Geschichte einer ersten Liebe und ich glaubte viele Jahre lang, dass alle Männer ihren Penis »Ralph« nennen. Ich las Bücher über Abenteuer suchende Mädchen, die als Goldgräberinnen nach Kalifornien ziehen und die Probleme und Sorgen der Planwagentrails überleben. Ich war fast besessen von der Konkurrenz zwischen Jessica und Elizabeth Wakefield im idyllischen kalifornischen Städtchen Sweet Valley. Ich las Ayla und der Clan des Bären und erfuhr, dass Sex viel interessanter sein kann als die jugendlichen Fummeleien von Katherine und Michael in Forever. Ich las und las und las. Meine Fantasie eroberte unermessliche Weiten.
Es gibt zahllose Bilder von mir in Röcken und Kleidern, Bilder, auf denen ich ein mädchenhaftes Mädchen bin mit langem, hochgestecktem Haar, mit Halsketten und Armreifen und Ringen, das ganze Prinzessinnen-Ding. Ich selbst sah mich lange eher als Tomboy, weil ich das einzige Mädchen in der Familie war. Manchmal versuchen wir, uns selbst von Dingen zu überzeugen, die nicht wahr sind, und interpretieren die Vergangenheit so, dass sie uns die Gegenwart erklären kann. Wenn ich diese Fotos betrachte, wird mir klar, dass ich die wilden Spiele – sich gegenseitig mit Matsch bewerfen und so weiter – mit meinen Brüdern zwar genoss, dass ich aber kein Tomboy war, nicht wirklich.