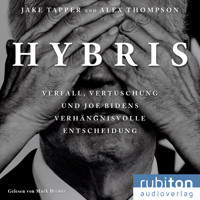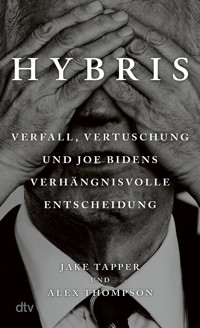
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die amerikanische Tragödie: Wie die Demokraten Trump den Teppich ausgerollt haben »Biden, seine Familie und sein Team haben sich von ihrem Eigeninteresse und der Angst vor einer weiteren Amtszeit Trumps leiten lassen, und deshalb versucht, einen zuweilen verwirrten alten Mann für vier weitere Jahre ins Oval Office zu bringen. Wie viele wussten davon? Was wurde vertuscht? War es eine Verschwörung?« Jake Tapper und Alex Thompson Zwei der angesehensten Journalisten Amerikas liefern eine schonungslose und dramatische Abrechnung mit einer der schicksalhaftesten Entscheidungen der amerikanischen Politikgeschichte: Joe Bidens Kandidatur zur Wiederwahl – trotz Anzeichen seines körperlichen und kognitiven Verfalls, trotz verzweifelter Bemühungen, das Ausmaß seines Zustands zu verbergen. Jetzt kommt zum ersten Mal die ganze, beunruhigende Wahrheit ans Licht. Jake Tapper und Alex Thompson nehmen uns mit hinter verschlossene Türen und in private Gespräche zwischen den wichtigsten Personen und enthüllen, wie groß das Problem war und wie viele Leute davon wussten. Bidens Entscheidung, erneut zu kandidieren, hatte eine Kampagne der Verleugnung und Vertuschung zur Folge, die direkt zu Donald Trumps Rückkehr an die Macht geführt hat – und zu allem, was in der Folge geschehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
In der griechischen Tragödie besiegelt das Bemühen des Helden, sein Schicksal zu vermeiden, sein Schicksal. Im Jahr 2024 wurde die amerikanische Politik zu einer griechischen Tragödie: Joe Biden trat noch einmal an, mit dem erklärten Ziel, die Nation vor einer zweiten Amtszeit Trumps zu bewahren. Er, seine Familie und seine hochrangigen Berater waren so überzeugt, dass nur er Trump erneut schlagen konnte, dass sie sich selbst, Verbündete und die Öffentlichkeit über seinen Zustand und seine Grenzen belogen.
Jetzt kommt zum ersten Mal die ganze, beunruhigende Wahrheit ans Licht. Jake Tapper und Alex Thompson nehmen uns mit hinter verschlossene Türen und in private Gespräche zwischen den wichtigsten Personen und enthüllen, wie groß das Problem war und wie viele Leute davon wussten. Von Mitarbeitern des Weißen Hauses auf höchster und niedrigster Ebene bis hin zu führenden Vertretern des Kongresses und des Kabinetts, von Gouverneuren bis hin zu Spendern und Hollywood-Akteuren – jetzt wird endlich die Wahrheit gesagt. Was Sie erfahren werden, lässt die Entscheidung von Präsident Biden, zur Wiederwahl anzutreten, schockierend narzisstisch, selbsttäuschend und rücksichtslos erscheinen. Diese Entscheidung hatte eine Kampagne der Verleugnung und Vertuschung zur Folge, die direkt zu Donald Trumps Rückkehr an die Macht geführt hat – und zu allem, was in der Folge geschehen ist. Wo auch immer Sie politisch stehen, ›Hybris‹ ist eine unverzichtbare Lektüre.
Jake Tapper / Alex Thompson
HYBRIS
Verfall, Vertuschung und Joe Bidens verhängnisvolle Entscheidung
Aus dem Englischen übersetzt von Henning Dedekind, Christina Hackenberg, Ursula Held, Hans-Peter Remmler, Karin Schuler und Violeta Topalova
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Anmerkung der Autoren
KAPITEL 1 »Er hat uns total in die Scheiße geritten!«
KAPITEL 2 »Steh auf!«
KAPITEL 3 Das »Politbüro«
2020
Der innere Kreis
Im Corona-Kokon
Virtueller Parteitag
Virale Clips
KAPITEL 4 Die Biden’sche Art
KAPITEL 5 »Ich, Joseph Robinette Biden Jr., schwöre feierlich«
2021
Beautiful Things
Doc O’Connor
KAPITEL 6 »Das privilegierteste Seniorenheim im ganzen Land«
KAPITEL 7 Wer soll es denn sonst machen?
2022
Kurz und bündig
David Axelrod, Teil 1
Der Sturz
November 2022
Steve
Kein Prozess
Die Kamala-Ausrede
Der Laptop
KAPITEL 8 Dr. Biden
KAPITEL 9 »Sind wir sicher, dass das eine gute Idee ist?«
2023
Doc O’Connors Untersuchung im Jahr 2023
Überschwang
März 2023
Irland
»Zwischen 10 und 16 Uhr«
Das verlorene Kampagnenjahr 2023
Die Unterstützer
Sonderermittler Robert Hur, Teil 1
Der Deal vor Gericht
Die Boten sind schuld
Navy Joan Roberts
Sonderermittler Robert Hur, Teil 2
Ari Emanuel und »The Weekend«
Bill Daley, Teil 1
David Axelrod, Teil 2
Die Pinguine
Die Weihnachtsfeier
KAPITEL 10 Dean Phillips
KAPITEL 11 2024
Die Ukraine-Konferenz
Der Deal
Ballverlust
Sonderermittler Robert Hur, Teil 3
Die letzte Untersuchung
Eine seltsame Zeit
Zur Lage der Nation
Bill Daley, Teil 2
Katzenberg
Die Meinungsforscher, Teil 1
Debatte oder lieber nicht?
KAPITEL 12 D-Day
Normandie
KAPITEL 13 Das Urteil
George Clooney, Teil 1
Die Veranstaltung zur Einwanderung
Vorbereitung auf die Fernsehdebatte
KAPITEL 14 Die Debatte
KAPITEL 15 Die Welt reagiert
KAPITEL 16 Die schwere Zeit
Freitag, 28. Juni 2024
Kartenhaus
Samstag, 29. Juni
Montag, 1. Juli
Dienstag, 2. Juli
Mittwoch, 3. Juli
Donnerstag, 4. Juli
Freitag, 5. Juli
Sonntag, 7. Juli
Montag, 8. Juli
Dienstag, 9. Juli
George Clooney, Teil 2
Mittwoch, 10. Juli
Donnerstag, 11. Juli
Freitag, 12. Juli
Samstag, 13. Juli
Montag, 15. Juli
Mittwoch, 17. Juli
Die Was-wäre-wenn-Kommission
Die Meinungsforscher, Teil 2
Samstag, 20. Juli
Sonntag, 21. Juli
KAPITEL 17 Freude
KAPITEL 18 Abgang
KAPITEL 19 Zusammenfassung
Danksagung und Quellen
Register
Für Jennifer, Alice und Jack.
Ihr seid mein Ein und Alles.
Jake
Für Mom und Dad.
Danke, dass ihr mich ertragt.
Alex
Viel ist gewonnen – viel bleibt übrig! Sind
wir auch die Kraft nicht mehr, die Erd’ und Himmel
vordem bewegte: Was wir sind, das sind wir!
Ein einz’ger Wille heldenhafter Herzen,
durch Zeit und Schicksal schwach gemacht, doch stark
im Ringen, Suchen, Finden, Nimmerweichen!
Ulysses, Alfred Lord Tennyson
Sie sagten mir, ich sei alles: das ist eine Lüge,
ich bin nicht fieberfest.
König Lear, William Shakespeare
Anmerkung der Autoren
Wir wollen mit diesem Buch zeigen, was sich im Weißen Haus und in der Kampagne der Demokratischen Partei für die Präsidentschaftswahl in den Jahren 2023 und 2024 abgespielt hat und wie verstörend das war. Das ist unsere einzige Agenda. Die Geschehnisse wurden uns von annähernd 200 Personen berichtet, darunter Abgeordnete und Insider aus dem Weißen Haus und dem Wahlkampfteam. Einige von ihnen werden sich möglicherweise niemals dazu bekennen, mit uns geredet zu haben, aber sie alle wissen, dass wahr ist, was auf den folgenden Seiten beschrieben wird. Die meisten der in diesem Buch präsentierten Informationen wurden nach den Wahlen von 2024 mit uns geteilt, als sich Funktionsträger und Helfer wesentlich freier fühlten, offen zu sprechen. Nur mit sehr wenigen der in diesem Buch namentlich Genannten haben wir nicht persönlich gesprochen.
Unsere wichtigsten Quellen waren Politikerinnen und Politiker der Demokraten innerhalb und außerhalb des Weißen Hauses, die damit zurechtkommen wollten, dass viele von ihnen derart fokussiert darauf gewesen waren, das Wahlvolk davon zu überzeugen, dass Donald Trump eine reale und existenzielle Gefahr für die Nation darstellte – und sich dabei gewissermaßen selbst Scheuklappen anlegten und an einer Farce beteiligten, die Trump den Wahlsieg auf dem Silbertablett servierte.
Einige äußerten uns gegenüber ihr Bedauern, nicht mehr unternommen zu haben, oder so lange gewartet zu haben, bevor sie sich mit dem Geschehen hinter den Kulissen an die Presse wandten. Viele waren wütend und fühlten sich zutiefst getäuscht, nicht nur von Biden selbst, sondern von seinem inneren Kreis von Beratern, seinen Gefolgsleuten und seiner Familie. Sie hatten bedenkliche Momente außerhalb des Lichts der Öffentlichkeit miterlebt, aber man hatte ihnen trotzdem versichert, alles stehe zum Besten. Und dann kam das Fernsehduell.
Leserinnen und Leser, die überzeugt sind, Joe Biden sei vom Beginn seiner Amtszeit an ohnehin nicht viel mehr als eine leere Hülle gewesen, kaum in der Lage, zwei zusammenhängende Sätze auf die Reihe zu bekommen, werden in diesem Buch dafür keine Bestätigung finden. Ebenso wenig wird dieses Buch diejenigen zufriedenstellen, die Trost in der Behauptung suchen, er habe bis zum Ende stets einen klaren Kopf behalten und sei uneingeschränkt in der Lage gewesen, Tag für Tag rund um die Uhr seinen Pflichten als Präsident nachzukommen. Die Gerüchte um die Verschlechterung seines Allgemeinzustands seien also nichts weiter als Propaganda der Rechten gewesen. Auch das ist falsch. Gegen Ende von Bidens Amtszeit gab es außerhalb seines innersten Kreises von Familie und engen Mitarbeitern nicht mehr viele hochrangige Demokraten, die der Ansicht gewesen wären, er könnte eine zweite vierjährige Amtszeit bewältigen.
Dieses Buch soll keine Rechtfertigung der Kandidatur oder der Präsidentschaften von Bidens Widersacher Donald Trump darstellen. Eine journalistische Arbeit über Biden entschuldigt oder rechtfertigt keine Handlungen oder Aussagen von irgendjemand anderem, den 45. und inzwischen 47. Präsidenten eingeschlossen. Gerade diejenigen, die versuchten, ihr in diesem Buch beschriebenes Verhalten mit der drohenden Gefahr einer zweiten Amtszeit Trumps zu rechtfertigen, hätte diese Befürchtung zurück auf den Boden der Realität bringen müssen, nicht weiter von ihr weg.
Die Lehren aus diesem Buch gehen über diesen einen Menschen und über diese eine politische Partei hinaus. Sie zielen auf universell gültige Fragen von kognitiver Dissonanz, Gruppendenken, Courage, Feigheit und Patriotismus.
George Orwell schrieb einst, wir alle seien »fähig, Dinge zu glauben, von denen wir wissen, dass sie unwahr sind, und wenn wir dann widerlegt werden, können wir schamlos die Fakten verdrehen, um zu zeigen, dass wir eben doch recht hatten. Auf intellektueller Ebene ist es möglich, diesen Prozess endlos fortzuführen: Der einzige Härtetest für diesen Prozess besteht darin, dass eine falsche Überzeugung früher oder später mit der handfesten Wirklichkeit kollidiert – in der Regel auf einem Schlachtfeld.«
Orwell schrieb damals über den Zweiten Weltkrieg, aber es könnte auch jede andere Zeit, jede beliebige Epoche damit gemeint sein. »Die Deutschen und die Japaner haben den Krieg vor allem deshalb verloren, weil ihre Führer unfähig waren, die Tatsachen zu erkennen, die sich jedem leidenschaftslosen Blick ganz offenkundig darboten«, so Orwell weiter. »Um zu erkennen, was sich direkt vor unserer Nase abspielt, bedarf es eines ständigen Kampfes.«
Hier ist das, was sich direkt vor unserer Nase abgespielt hat.
Jake Tapper und Alex Thompson
KAPITEL 1»Er hat uns total in die Scheiße geritten!«
Joe Biden stand am Morgen nach der Präsidentschaftswahl 2024 auf und war überzeugt, dass man ihm Unrecht getan hatte.
Die gesellschaftlichen Eliten, die Funktionsträger der Demokratischen Partei, die Medien, Nancy Pelosi, Barack Obama – sie alle hätten ihn nicht aus dem Rennen drängen dürfen. Wäre er der Kandidat geblieben, dann hätte er Donald Trump besiegt. Das zeigten jedenfalls die Umfragen, behauptete er immer und immer wieder.
Die Meinungsforscher sagten uns, dass solche Umfragen nicht existierten. Es gebe keine belastbaren Daten, die die Behauptung stützen könnten, dass er gewonnen hätte. Sämtliche glaubwürdigen Informationen legen nahe, dass es eine Niederlage geworden wäre, vermutlich sogar eine krachende, weitaus heftiger als jene, die Vizepräsidentin Kamala Harris, die Ersatzkandidatin der Demokraten, hinnehmen musste.
Die Diskrepanz zwischen Bidens Optimismus und der unerfreulichen Realität der Umfrageergebnisse zog sich durch seine gesamte Amtszeit. Viele Insider hatten das Gefühl, sein engster Kreis schirme ihn vor schlechten Nachrichten ab.
Um diese Umfragezahlen zu akzeptieren, hätte sich Biden das größte Problem eingestehen müssen, das diesen Zahlen zugrunde lag: Die Öffentlichkeit hatte – lange vor den meisten Funktionsträgern der Demokraten, den Medien und anderen Eliten – den Schluss gezogen, dass er viel zu alt für eine zweite Amtszeit war. In Wahrheit hatten schon vor jener folgenschweren Fernsehdebatte am 27. Juni 2024 viele Insider – Leute, die einen viel besseren Einblick in Bidens körperliche und geistige Verfassung hatten als die breite Öffentlichkeit – Dinge gesehen, die sie schlicht schockiert hatten. Die meisten von ihnen schwiegen darüber.
Präsident Biden wachte am Morgen nach der Wahl auf mit der Gewissheit, ihm sei nichts vorzuwerfen.
Zweieinhalb Meilen weiter nördlich, entlang der Connecticut Avenue Northwest, und weiter in Richtung Westen auf der Massachusetts Avenue, betrat Kamala Harris sehr ernst den Speisesaal der Residenz der Vizepräsidentin auf dem Gelände des US Naval Observatory.
An jenem Morgen war nur ihr engstes Umfeld anwesend, ihr Mann Doug Emhoff, ihre Schwester Maya und ihr Schwager Tony West. Sie konnten es nicht glauben. Es war real. Es war kein Albtraum. Es war tatsächlich passiert.
Sie wussten, dass sie spät ins Rennen gestartet waren, dass sie eine gewaltige Aufgabe vor sich gehabt hatten. Innerhalb von lediglich 107 Tagen hätten sie Amerika davon überzeugen müssen, dass die Vizepräsidentin eines historisch unbeliebten Präsidenten das Zeug dazu hätte, Veränderungen auf den Weg zu bringen. Sie hatten gehofft, die Fehlertoleranz in den Umfragen, die ihnen vorgelegt wurden, werde sich zu ihren Gunsten korrigieren. Der Enthusiasmus im Land, den sie auf der Wahlkampftour verspürt hatten, war greifbar gewesen. Sie waren voller Hoffnung gewesen.
Aber im Lauf der Nacht hatten die Fernsehsender Donald Trump zum Sieger erklärt.
Harris saß am Frühstückstisch und wusste, dass sie den gewählten Präsidenten anrufen und ihre Niederlage würde eingestehen müssen. Und dann würde sie die Rede fertig schreiben, die sie niemals hatte halten wollen.
Der Sieg hat hundert Väter, die Niederlage ist ein Waisenkind, wie John F. Kennedy nach dem Fiasko in der Schweinebucht sagte. Von Demokraten, die sich zur Vaterschaft des politischen Desasters, das der Präsidentschaftswahlkampf 2024 darstellte, bekannt hätten, war nicht viel zu sehen.
Niemand hat behauptet, die Harris-Kampagne sei frei von Fehlern gewesen. Aber für die meisten eingeweihten Offiziellen und Unterstützer, und auch für die Führungsriege ihres Wahlkampfteams, gab es keine Frage, wer der Vater dieser Wahlniederlage war: Es war Joe Biden.
Harris würde in ihrer unverbrüchlichen Loyalität zu ihm so etwas nie sagen, viele Leute in ihrem Umfeld aber schon.
»Wir als Partei sind von Biden dermaßen betrogen worden«, sagte uns David Plouffe, einer der Berater ihres Teams.
Plouffe hatte 2008 den Wahlkampf von Senator Barack Obama geleitet und war als führender Berater für Präsident Obama tätig, bevor er sich 2013 weitgehend aus der Politik zurückzog. Nach Bidens Ausstieg aus dem Rennen am 21. Juli 2024 wurde Plouffe für eine – wie er es einschätzte – »Rettungsmission« der Harris-Kampagne an Bord geholt. Harris, sagte er, sei eine »große Kämpferin«, aber das auf 107 Tage komprimierte Rennen ums Weiße Haus sei ein »beschissener Albtraum gewesen«.
»Und alles wegen Biden«, sagte Plouffe. Zu Bidens Entscheidung, erst zur Wiederwahl anzutreten und dann nach der katastrophalen Fernsehdebatte noch einmal drei Wochen zu warten, bis er das Handtuch warf, meinte er noch: »Er hat uns total in die Scheiße geritten.«
Das hat mit den typischen Schuldzuweisungen nach einer verlorenen Wahl nichts zu tun.
Noch vor den Vorwahlen des Jahres 2020, im Dezember 2019, erzählten vier Berater Bidens gegenüber Ryan Lizza, einem Journalisten von Politico, es sei »praktisch undenkbar, dass er 2024 zur Wiederwahl anträte – immerhin wäre er dann der erste Präsident über achtzig«. Lizza interpretierte das Ganze als strategische Indiskretion, die den Gedanken an die Öffentlichkeit bringen sollte.
»Keine Sorge, ich sehe mich als Brücke, als Übergang, nichts weiter«, bekräftigte Biden im März 2020, kurz bevor er sich in den Vorwahlen als Kandidat der Demokratischen Partei durchsetzen konnte.
Stattdessen ließ der älteste Präsident der amerikanischen Geschichte, unterstützt von seinen wichtigsten Beratern sowie seiner Frau und der Familie, im April 2023 verlauten, er werde erneut antreten. Bei einer Wiederwahl wäre er bis zum Alter von 86 Jahren Präsident geblieben.
Das eigentliche Problem war nicht sein Alter als solches. Es waren die klar erkennbare Verminderung seiner Fähigkeiten, die im Verlauf seiner Amtszeit immer deutlicher wurde. Schon was die Öffentlichkeit von seiner Fähigkeit, das Amt auszuüben, zu sehen bekam, gab Anlass zur Sorge. Aber was sich hinter den Kulissen abspielte, war noch viel schlimmer.
Gewiss konnte Biden tagein, tagaus Entscheidungen treffen, seine Erfahrung beisteuern und die Rolle eines Präsidenten ausüben, aber es gab bedeutende Schwierigkeiten, die zu einer Belastung für seine Präsidentschaft wurden: die begrenzte Anzahl von Stunden, während der er zuverlässig arbeitsfähig war, und die immer zahlreicher werdenden Momente, in denen er augenscheinlich erstarrt war, den Faden verlor, die Namen wichtiger Mitarbeiter vergaß oder sich sogar kurzzeitig nicht mehr an Freunde erinnern konnte, die er schon seit Jahrzehnten kannte. Von den Beeinträchtigungen seiner Kommunikationsfähigkeit – was nichts mit seinem lebenslangen Stottern zu tun hatte – ganz zu schweigen.
Dieser Niedergang verlief nicht in einer geraden Linie. Er hatte gute und schlechte Tage. Aber bis zum letzten Tag seiner Präsidentschaft weigerten sich Joe Biden und die Leute in seinem engsten Kreis, der Realität ins Auge zu blicken: dass nämlich seine Energie, seine kognitiven Fähigkeiten und seine Kommunikationskompetenz deutlich nachgelassen hatten. Und was noch schlimmer ist: Sie versuchten, diese Tatsachen mit diversen Mitteln zu verschleiern.
Der Sündenfall der Wahlen von 2024 war Bidens Entscheidung, überhaupt zur Wiederwahl anzutreten – gefolgt von aggressiven Bemühungen, seinen kognitiven Verfall zu kaschieren.
Und dann kam jenes Fernsehduell mit Trump am 27. Juni, in dem Bidens Zustand vor aller Welt sichtbar wurde.
Das war nicht einfach bloß ein schlechter Abend, wie Biden und sein Team hinterher behaupteten. Millionen Menschen waren entsetzt angesichts von Bidens Auftritt bei der Debatte, seinem hängenden Unterkiefer, seinem unverständlichen Gebrabbel. Einige Demokraten waren allerdings kein bisschen überrascht. Hinter verschlossenen Türen hatten sie ihn auch schon so erlebt, aber nichts gesagt. Aus unterschiedlichen Gründen versuchten sie, ihr eigenes Schweigen für vernünftig zu erklären.
Am Ende taumelten die Demokraten in den Herbst 2024 mit einer Kandidatin ohne interne Konkurrenz und begleitet von einem wachsenden Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem Weißen Haus, das das amerikanische Volk gezielt in die Irre geführt hatte. Angesichts von nur dreieinhalb Monaten Zeit, um einen Wahlkampf gegen einen Kandidaten und eine Maschinerie zu führen, die im Grunde seit 2015 auf Hochtouren lief, fürchtete sich Kamala Harris davor, zu ihrem Chef auf Distanz zu gehen – sie war nicht in der Lage, öffentlich auch nur das einzugestehen, was der Rest der Welt von Bidens Niedergang ohnehin mitbekam.
Harris beging Fehler, sowohl vor Bidens Kandidatur als auch nach deren Ende, aber keine der Entscheidungen, die sie und ihr Wahlkampfteam trafen, war auch nur annähernd so folgenschwer wie Bidens Entschluss, zunächst zur Wiederwahl anzutreten und der Öffentlichkeit weiszumachen, er werdee eben nicht vor aller Augen geistig dahinwelken.
»Es war grauenhaft«, sagte uns ein prominenter Strategieexperte der Demokraten – der sich öffentlich hinter Biden gestellt hatte. »Er hat der Demokratischen Partei eine Wahl gestohlen, er hat sie dem amerikanischen Volk gestohlen.«
Biden hatte seine gesamte Präsidentschaft als offene Feldschlacht angelegt, die zum Ziel hatte, eine Rückkehr Trumps ins Oval Office zu verhindern. Sein Klammern an die Macht und seine Unehrlichkeit sich selbst und dem ganzen Land gegenüber, was seinen körperlichen und geistigen Niedergang betraf, waren die Garantie dafür, dass genau dies geschehen würde.
Ein weiterer hochrangiger Demokrat, einer, der einen Großteil des Jahres 2023 und den Anfang von 2024 damit zubrachte, den Präsidenten und dessen Geisteskraft öffentlich und hinter verschlossenen Türen zu verteidigen, sprach regelmäßig mit Leuten aus dem Weißen Haus und des Wahlkampfteams und bekam wieder und wieder Beschwichtigungen zu hören. »Ihm geht’s gut, ihm geht’s gut, ihm geht’s gut!«, behaupteten sie alle.
So erlebten es Dutzende Akteure, von Politikern über Unterstützer bis hin zu linksliberalen Kommentatoren.
Im Frühjahr 2024 rief besagter Demokrat bei Spitzenbeamten des Weißen Hauses an. »Tag für Tag verteidige ich diesen Kerl«, beschwerte. »Irgendwer sagt mir dann, ihm geht’s prima. Aber mal ehrlich, es sieht nicht gut aus. Die Pressekonferenzen sehen nicht gut aus.« Man beruhigte ihn ein ums andere Mal, erzählte uns dieser hochrangige Demokrat. »Anita [Dunn] sagte mir, ihm geht es gut. [Jeff] Zients sagte mir, ihm geht es gut. [Mike] Donilon meinte: ›Ich verspreche dir, er ist okay.‹«
2024, nach Bidens Rückzug aus dem Präsidentschaftsrennen, traf sich dieser Demokrat privat mit dem Präsidenten und der First Lady. Und konnte sich mit eigenen Augen ein Bild von der Realität machen.
»Es ging ihm eben nicht gut. Sie [die First Lady] musste einige der von ihm begonnenen Gedankengänge zu Ende bringen. Nichts war in Ordnung. Ich war sehr aufgewühlt, als ich das Weiße Haus verließ, denn, verdammt noch mal, er war alles andere als okay.«
Wir möchten glauben, sagt er, dass Bidens Topberater »niemanden vorsätzlich getäuscht haben. Ich denke, manchmal glauben die Leute einfach nur an das Beste. Ich schätze, in der Theorie hieß es immer: ›Er ist eben ein Zocker; er packt’s dann schon, wenn es drauf ankommt.‹ Und ich denke, sie glaubten auch daran. Aber wenn du jeden Tag mit ihm zusammen bist, müssen sie doch Momente gehabt haben, wie ich sie mit ihm erlebt habe, und da denkst du dir doch: ›Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus.‹ Und dann kommt doch irgendwann der Punkt, wo du die Tür hinter dir zuziehst und zu ihm sagst: ›Ehrlich, Sie schaffen das nicht mehr.‹«
Trump gewann am Ende mit 312 zu 226 Wahlmännerstimmen. Und er holte auch 2,2 Millionen mehr Wählerstimmen als Harris. Dabei war das Rennen enger, als diese Zahlen vermuten lassen. Harris verlor drei entscheidende Bundesstaaten, die »Blue Wall«, mit insgesamt rund 230000 Stimmen Rückstand. Hätte sie die Differenz von 1,44 Prozent in Michigan, 1,73 Prozent in Pennsylvania und 0,87 Prozent in Wisconsin aufgeholt, dann wäre sie heute Präsidentin.
Demokraten und Demokratinnen wie Harris und andere, die 2024 möglicherweise angetreten wären – Transportminister Pete Buttigieg, Senatorin Amy Klobuchar aus Minnesota, Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien, Gouverneur JB Pritzker aus Illinois, Gouverneurin Gretchen Whitmer aus Michigan –, spielen in Gedanken eine Frage durch: Wäre Joe Biden nicht zur Wiederwahl angetreten oder hätte er irgendwann im Jahr 2023 seinen Verfall eingestanden und seine Haltung geändert: Was wäre dann passiert?
Wenn die Geschichte uns etwas lehren kann, dann dies: Aus einem offenen und umkämpften Vorwahlprozess wäre eine stärkere demokratische Kandidatin oder ein stärkerer Kandidat hervorgegangen. Jemand mit mehr Debattenerfahrung und jemand, der sich den Fragen von Journalisten stellt, jemand mit überzeugenderen und präziseren Antworten darauf, warum er oder sie sich um das Amt bewirbt, jemand, der dann ausreichend Zeit gehabt hätte, sich dem amerikanischen Volk zu präsentieren. Vergangene Wankelmütigkeit bei diesem oder jenem Thema hätte ausgeräumt werden können, politische Vorschläge wären konkretisiert und erfolgreiche Botschaften an die Wählerschaft formuliert worden. Der Kandidat oder die Kandidatin hätte einen Weg gefunden, respektvoll, aber nachdrücklich auf Abstand zum unpopulären Amtsinhaber zu gehen, und er oder sie hätte einen neuen Weg aufzeigen können, der für politischen Wandel steht.
Hätte dieser Kandidat, diese Kandidatin es geschafft, 1,5 Prozent mehr Stimmen in Michigan, 1,8 Prozent mehr in Pennsylvania, 0,9 Prozent mehr in Wisconsin zu holen?
Für die Plouffes dieser Welt ist die Antwort darauf klar: ja.
»Wenn Biden schon 2023 seinen Ausstieg beschlossen hätte, hätten wir einen soliden Vorwahlprozess gehabt«, sagte Plouffe. »Whitmer, Pritzker, Newsom, Buttigieg, Harris und Klobuchar wären angetreten. Warnock und Shapiro hätten den Bewerbern auf den Zahn gefühlt. Vielleicht auch Mark Cuban oder jemand anderes aus der Wirtschaft. 20 Prozent der Gouverneure und 30 Prozent der Senatoren hätten es zumindest in Erwägung gezogen. Wir wären unvergleichlich viel stärker gewesen.«
Sobald es für alle Welt offenkundig war, dass Biden sich zurückziehen müsste, drängten Barack Obama, Nancy Pelosi (bis 2023 Sprecherin des Repräsentantenhauses) und andere auf irgendeine Form von offenem Prozess im Juli oder August. Bidens bis zum 21. Juli bestehende Weigerung, den Weg frei zu machen, und seine anschließende sofortige Parteinahme für Harris bedeuteten, dass auch daraus nichts werden konnte.
Das ist mehr als bloß eine späte Einsicht. Alle konnten sehen, was sich da abspielte.
Über das ganze Jahr 2023 und bis 2024 hinein wurde Bidens Gang immer steifer, seine Stimme brüchiger. Die Leute riefen bei Plouffe an – der Präsident wirkte gebrechlich und hörte sich schwach an. Oft bewältigte er kleinere Veranstaltungen zum Einwerben von Spenden nur mithilfe eines Teleprompters, und oft verließ er diese Events vorzeitig. Die Leute, die hohe Beträge lockermachten, wollten von ihm wissen, ob wirklich alles in Ordnung sei. Das sei nicht normal.
Plouffe fragte die Leute im Weißen Haus und bei der Partei, ob sie wirklich sicher seien, dass er gewinnen könne. Ja, meinten diese und verwiesen darauf, dass Biden Trump schließlich schon 2020 besiegt habe, dass die Zwischenwahlen 2022 nicht so übel für die Demokraten gelaufen seien, wie sie befürchtet hätten, und dass er praktische Erfolge vorweisen könne, die an die Bilanz von Franklin D. Roosevelt heranreichten. Das Biden-Team argumentierte auch, im Falle seines Rückzugs würde wahrscheinlich Vizepräsidentin Harris Präsidentschaftskandidatin werden, und sie hatten nur geringes Vertrauen in ihre Fähigkeiten.
Plouffe hielt diese Theorie für bizarr. Kein Mensch konnte sagen, wer aus einem umkämpften Vorwahlprozess bei den Demokraten als Sieger hervorgehen würde. Wenn – wenn – Harris die Siegerin wäre, dann läge das doch gerade an den politischen Fähigkeiten, die die Biden-Leute ihr absprachen. Und was ihn an deren Anti-Harris-Argumentation besonders wütend machte, war die Tatsache, dass doch Biden selbst sie zu seiner Vizepräsidentin auserkoren hatte.
Wir sind im Jahr 2023. Plouffe hatte sich aus der Politik zurückgezogen, und sein früherer Boss, Barack Obama, hielt sich aus der Parteipolitik heraus. Biden war noch immer wütend auf Obama, weil dieser 2016 seine geplante Kandidatur nicht unterstützt und sich stattdessen hinter Ex-Außenministerin Hillary Clinton gestellt hatte.
Obama hatte Biden niemals direkt gesagt, er solle auf eine Kandidatur verzichten, er hatte aber seinem Vizepräsidenten – der noch immer in tiefer Trauer über den Tod seines Sohnes Beau war – geraten, sich mehr auf sich selbst zu besinnen. Plouffe hatte Biden von einer Kandidatur abgeraten – Hillary Clinton und Senator Bernie Sanders waren viel zu beliebt –, und Obamas politischer Direktor im Weißen Haus, David Simas, hatte Biden mit Umfragen konfrontiert, aus denen die geringe Wahrscheinlichkeit seines Sieges hervorging.
»Der Präsident war nicht sehr motivierend«, drückte Biden das aus.
Die Leute aus dem Obama-Lager hatten damals das Gefühl, sie hätten Biden nach dessen Scheitern in den Jahren 1988 und 2008 ein drittes Vorwahldesaster erspart.
Dann versammelte sich 2020 die Partei hinter ihm, weil er die besten Chancen hatte, gegen Trump zu gewinnen. Das tat er dann auch, und viele hatten den Eindruck, dass in seiner Präsidentschaft wirklich sehr viel erreicht wurde. Die Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Corona-Krise, die erfolgreiche Impfkampagne. Ein historisches Infrastrukturgesetz. Der Aufschwung der Halbleiterfertigung in den USA. Ein parteiübergreifendes Gesetzespaket zum Schutz vor Waffengewalt.
Im Juni 2023 kam Obama zu einem Besuch bei Biden vorbei. Er wollte ein wenig vorfühlen, ob der alte Knabe der Sache wirklich noch gewachsen war. Biden schien okay zu sein – alt, ja natürlich, er war nun einmal Biden, aber durchaus noch fit. Obama warnte, Trump sei ein gewaltiger Widersacher aufgrund der zunehmend polarisierten Nation, Trumps eingeschworener Basis und der gespaltenen Medienlandschaft.
»Sieh einfach zu, dass du das Rennen gewinnst«, war alles, was Obama Biden bei dieser Gelegenheit mit auf den Weg gab, ungeachtet eventuell vorhandener Zweifel.
Was konnte Obama auch sonst tun? Es war Bidens Entscheidung.
Er war ja der Präsident.
So viel zum politischen Kontext des Sündenfalls, zum Was-wäre-gewesen-wenn.
Konkreter wird es bei den Fakten, die wir über Bidens Gesundheitszustand und seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in Erfahrung brachten; dem Schweigen der Zeugen; der Komplizenschaft der Steigbügelhalter; und den Machenschaften derjenigen, die sich darum bemühten, diese Fakten vor anderen und vor der Allgemeinheit zu verbergen.
Auch jetzt, Anfang 2025, ist Biden natürlich nach wie vor in der Lage, ein kohärentes Gespräch zu führen, vorausgesetzt, er ist gut vorbereitet und ausgeruht. Ehemalige führende Mitarbeiter von ihm betonen, seine Entscheidungsprozesse funktionierten nach wie vor.
Aber die Zahl der Stunden, in denen Biden Leistung bringen kann, ist sehr begrenzt. Seit mindestens 2022 gab es immer wieder Momente, in denen er die Namen wichtiger Mitarbeiter vergaß, mit denen er jeden Tag zu tun hatte. Manchmal wirkt er verwirrt. Er neigt zunehmend dazu, den Faden zu verlieren, mitunter wird seine Stimme so schwach, dass er gar nicht mehr zu verstehen ist, selbst wenn er direkt ins Mikrofon spricht.
Das Amt des Präsidenten verlangt, im Notfall auch dann auf Zack zu sein, wenn man nachts um zwei Uhr aus dem Bett geholt wird. Minister seines Kabinetts sagten uns, 2024 konnte man sich in dieser Hinsicht bei Biden nicht mehr sicher sein.
Was die Weltöffentlichkeit bei seiner ersten und einzigen Fernsehdebatte 2024 zu sehen bekam, war keine Ausnahme. Es war keine Erkältung. Es war nicht jemand, der sich zu viel oder zu wenig vorbereitet hatte. Es war nicht jemand, der einfach bloß ein wenig übermüdet war. Es war das natürliche Ergebnis bei einem 81-Jährigen, dessen geistige Fähigkeiten seit Jahren im Niedergang begriffen waren. Biden, seine Familie und sein Team haben sich von ihrem Eigeninteresse und der Angst vor einer weiteren Amtszeit Trumps leiten lassen, und damit den Versuch gerechtfertigt, einen zuweilen verwirrten alten Mann für vier weitere Jahre ins Oval Office zu bringen.
Wie viele wussten davon? Was wurde vertuscht? War es eine Verschwörung?
Wir werden die Fakten für sich selbst sprechen lassen.
KAPITEL 2»Steh auf!«
Um zu begreifen, wie Joe Biden zu dem Entschluss kommen konnte, in einem historisch hohen Alter zur Wiederwahl anzutreten, müssen wir Bidens ganz eigene »Mythologie« verstehen. Noch bevor wir uns mit seiner Überzeugung befassen, er und nur er allein wäre in der Lage, Donald Trump zu schlagen, müssen wir uns die Legende des Joe Biden vor Augen führen, die besagt: alle Erwartungen übertreffen, mäßigen Erfolgschancen trotzen und schlicht überleben.
»Steh auf!«, schrieb er in seinem ersten Memoirenbuch, Promises to Keep. »Für mich ist es das erste Prinzip im Leben, der wichtigste Grundsatz. Und eine Lektion, die du nicht zu Füßen irgendeines weisen Mannes lernen kannst. Steh auf! Die Kunst zu leben besteht schlicht darin, dich wieder aufzurappeln, nachdem du einen Niederschlag hast einstecken müssen.«
Es war eine Lehre seines Vaters, Joseph Robinette Biden Sr.; der hatte schwere Schicksalsschläge verkraften müssen, aber »keine Zeit für Selbstmitleid«. Und Vater Biden hatte es in der Tat schwer. Mit seiner Schädlingsbekämpfungsfirma auf Long Island ging er bankrott, dann zog er mit der Familie zurück nach Scranton, Pennsylvania, wo sie bei den Eltern seiner Frau lebten. Vater Biden war verarmt und fand keinen Job, also begann er, nach Delaware zu pendeln, wo er als Heizungskesselreiniger arbeitete und auf Märkten billigen Modeschmuck verkaufte. Am Ende holte er auch den Rest der Familie nach Delaware.
»Champ, es kommt nicht darauf an, wie oft du zu Boden gehst«, lehrte Biden senior seinen Sohn. »Es kommt darauf an, wie schnell du wieder aufstehst.«
»›Steh auf!‹«, schrieb Biden, »ist wie ein Echo, das sich durch mein ganzes Leben zieht.«
Steh auf!
Die anderen Kinder in Scranton machten sich über Bidens Stottern lustig. In der Highschool tauften sie ihn »Dash« (»Strich«) – nicht, weil er auf dem Footballfeld besonders flitzte, sondern weil seine Sprechweise etwas von Morsezeichen hatte, dot-dot-dash-dash (kurz-kurz-lang-lang). Kinder können grausam sein; deshalb nahm sich Biden in späteren Jahren im Wahlkampf die Zeit, um mit Kindern zu sprechen, die ebenfalls unter Stottern litten. Sie sollten wissen, dass sie den Großmäulern nicht gestatten durften, sie auf diese Eigenschaft zu reduzieren.
Steh auf!
Als kaum bekannter Gemeinderat in seinem Heimatbezirk New Castle trat Biden 1972 gegen Delawares populären Senator James Caleb »Cale« Boggs von der Republikanischen Partei an. Er hielt Boggs vor, er sei zu alt (der war damals 63) und weltfremd. Niemand traute Biden zu, diese Wahl zu gewinnen. Und dann gewann er sie doch.
Nur etwa einen Monat später kam jener furchtbare Tag, an dem sein Bruder Jimmy aus Wilmington anrief. Er sprach mit Val, der gemeinsamen Schwester, die mit dem gerade gewählten Senator Biden in einem Büro auf dem Capitol Hill war. »Es hat einen kleinen Unfall gegeben«, sagte Val danach zu Biden. »Nichts, weshalb man sich Sorgen machen müsste. Aber wir sollten nach Hause fahren.«
Bidens Frau Neilia und ihr dreizehn Monate altes Töchterchen Naomi waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. »Tut mir leid, Joe, aber wir konnten nichts mehr für sie tun«, wurde ihm gesagt. Seine Söhne Beau und Hunter hatten den Unfall schwer verletzt überlebt und lagen im Krankenhaus. Der Schmerz und der Kummer, das schwarze Loch, in das Biden von einer Sekunde auf die andere gefallen sein muss, sind kaum vorstellbar.
Steh auf!
Seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 1988 endete mit einem Plagiatsskandal, noch bevor das Jahr 1987 vorbei war.
Wenige Monate später, im Februar 1988, wurde er wegen der Kopfschmerzen, die er im Jahr zuvor ignoriert hatte, eilends ins Saint Francis Hospital in Wilmington gebracht. Seine zweite Frau Jill wurde gebeten, nicht ins Krankenzimmer zu gehen, weil er dort gerade die Letzte Ölung empfing. Er hatte Blut in der Rückenmarksflüssigkeit und ein geplatztes Aneurysma unterhalb der Hirnbasis. Man warnte ihn, der notwendige neurochirurgische Eingriff könnte den Verlust der Sprachfähigkeit zur Folge haben. Jill wies darauf hin, dass er, hätte er sich nicht aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen, zu dem Zeitpunkt, als das Aneurysma platzte und zu bluten begann, auf Wahlkampftour in New Hampshire gewesen wäre und diese nicht abgebrochen hätte: »Du wärst jetzt tot«, sagte sie. »Nichts geschieht ohne Grund.«
Steh auf!
Seine Kandidatur im Jahr 2008 endete ebenfalls mit einem peinlichen Fehlschlag – in Iowa kam er mit weniger als einem Prozent der Stimmen nur auf Platz fünf.
Aber der Gewinner der Vorwahlen und am Ende erfolgreiche Bewerber, Senator Barack Obama, entschied sich für ihn als seinen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, und Biden wurde einer der einflussreichsten Vizepräsidenten in der modernen Geschichte, der bisweilen sogar Obama an Beliebtheit hinter sich ließ.
Steh auf!
Im Mai 2015 starb Bidens Sohn Beau an einem Hirntumor.
Das versetzte ihm einen furchtbaren Schlag.
Sein 45-jähriger Sohn Hunter glitt in die Drogensucht ab, Hunters Familie fiel auseinander. Joe Biden sagte, erstmals in vielen Jahrzehnten habe er keinen Sinn mehr in seinem Leben erkennen können.
Steh auf!
Biden kandidierte erneut im Jahr 2020 erneut. Obama unterstützte ihn bei den Vorwahlen nicht, und auch die Medien formulierten Zweifel. Doch er schaffte die Kandidatur, und er besiegte Trump.
Er sah sich selbst als jemanden, dem historische Errungenschaften gelungen waren, vergleichbar mit denen von Franklin Roosevelt und Lyndon Johnson. Amerika lag 2020 am Boden, und er rettete die Wirtschaft, wie er selbst sagte. Fünfzehn Millionen neue Jobs! Allein 800000 in der Fertigung! Rekordverdächtige zwei Jahre nacheinander eine Arbeitslosenquote unter vier Prozent! Infrastrukturprojekte, die über Jahrzehnte nachwirken würden! Die Kritiker hätten gesagt, das sei nicht zu schaffen, pflegte Biden zu erzählen. Die Presse, die Zweifler, die Eliten – niemand hatte jemals daran geglaubt, dass er auch nur irgendetwas davon würde umsetzen können.
Steh auf!
Wer daher glaubt, das Alter oder irgendwelche Gebrechen hätten Biden veranlassen können, seine Kandidatur zu überdenken, versteht Joe Biden nicht und auch nicht die wahren Gläubigen, die er um sich geschart hatte. Das Schicksal hatte einen Großteil des zurückliegenden halben Jahrhunderts damit zugebracht, ihm alle möglichen Tiefschläge zu versetzen, die schlimmsten Tragödien, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Und jedes gottverdammte Mal ist er wieder aufgestanden. Jedes. Gottverdammte. Mal.
Für Angehörige und enge Mitarbeiter wurde die Mythologie zu einem nahezu religiösen Glauben an die Fähigkeit Bidens, sich wieder aufzurappeln.
Und wie in jeder Glaubenslehre war Skepsis nicht erlaubt.
Ein Journalist, der sich seit Langem eingehend mit Biden beschäftigt, erzählte uns: »Biden sagt wortwörtlich: ›Bewahrt euch den Glauben.‹« Was so viel heißt wie: Denkt nicht einmal daran, ihn infrage zu stellen. Und so entstand ein eigenartiger Kreis von Überzeugten, in dem keiner dem anderen gestattete, irgendwelche Zweifel aufkommen zu lassen.
Ein Teil dieser Glaubenslehre beruht auf Narrativen, die manchmal fragwürdig sind. Das Bild von Joe – Pilotenbrille, Eiscreme, die 1967er Corvette – als dem netten Onkel, und dazu die warmherzige Jill. Diese Eindrücke wurden nicht uneingeschränkt geteilt, zumindest nicht von jenen, die beide gut kannten.
Der Präsident gefiel sich darin, »mein Wort als Biden« zu geben, eine Art Familienmotto, aber es gab da noch ein weiteres, eher im Privaten gebrauchtes Diktum: »Nenne einen dicken Menschen niemals dick.« Das war nicht nur eine Frage der Höflichkeit, es ging auch um das Verdrängen unschöner Fakten.
»Sprich keine hässlichen Wahrheiten aus«, formulierte es eine der Familie nahestehende Person.
»Die größte Stärke der Bidens ist es, in ihrer eigenen Wirklichkeit zu leben«, sagte uns dieselbe Person. »Und Biden selbst ist sehr gut darin, diese Wirklichkeit zu erschaffen. Beau wird nicht sterben.Hunter ist stabil drogenfrei. Joe sagt immer die Wahrheit. Joe sorgt sich mehr um seine Familie als um seine eigenen Ambitionen. Sie halten sich an das Narrativ und wiederholen es immer wieder.«
Von 2020 bis 2024 führte all dies zu einer geradezu spirituell fundierten Weigerung einzugestehen, dass es mit Bidens körperlicher und geistiger Fitness bergab ging.
Es gab einige Mitarbeiter, die den Präsidenten zwar schätzten, aber den geradezu religiösen Eifer mancher Kollegen nicht teilten. Die engsten Mitarbeiter der Bidens, so sagten sie uns, verbargen die Verschlechterung seines Zustands vor der Öffentlichkeit und vor anderen Leuten in der Regierung.
Ein hochrangiger Mitarbeiter im Weißen Haus, der seinen Job aufgab, weil er gegen Bidens erneute Kandidatur war, räumte uns gegenüber ein: »Wir versuchten, ihn vor seinem eigenen Stab abzuschirmen, deshalb war vielen Leuten das Ausmaß seines Verfalls, der 2023 einsetzte, nicht klar.«
»Ich liebe Joe Biden«, meinte dieser Mitarbeiter. »Es gibt kaum jemanden in der Politik, der sich in Sachen Anstand mit ihm messen kann. Dennoch taten seine Familie und seine Berater dem Land einen schlechten Dienst, als sie ihm gestatteten, erneut zu kandidieren.«
KAPITEL 3Das »Politbüro«
2020
Auf einer strapaziösen Wahlkampftour im Dezember 2019 – es ging acht Tage per Bus durch Iowa – ließ Biden seine Helfer stutzen. In einer Besprechung wollte ihm der Name seines langjährigen Beraters Mike Donilon nicht einfallen. »Ihr wisst schon, der …«, stockte er, worauf sich die Anwesenden verstohlene Blicke zuwarfen. Donilon arbeitete seit 1981 für Biden.
Es war nicht das erste Mal während der Vorwahlen 2020, dass Bidens Entourage ins Grübeln geriet. Mit etwas Sorge beobachteten sie, dass er gelegentlich nicht so auf der Höhe war wie zu seiner Zeit als Vizepräsident. In Debatten hatte er nie besonders souverän gewirkt, inzwischen aber verfolgten seine Berater diese Auftritte mit nervöser Anspannung. Sein Team mied konfrontative Interviews, obwohl Biden früher immer zu den pressefreundlichsten Senatoren gehört hatte. Es bereitete ihm offenbar Mühe, so zu kommunizieren wie früher.
Untereinander raunte man schon, dass Biden nicht hundertprozentig in Form sei, auf keinen Fall aber durfte das Thema ihm oder seinen engsten Beratern gegenüber angesprochen werden, das käme einem Tabubruch nahe.
Es schien, als gäbe es zwei Joe Biden: Auf kraftvolle Wahlkampfauftritte folgten verhaltene, abschweifende Reden, von denen seine eigenen Leute peinlich berührt waren.
Dennoch, der »gute Biden« zeigte sich deutlich öfter als der »alte Biden«.
Nach der Wahlkampftour durch Iowa aber wuchs bei einigen Unterstützern die Beunruhigung. Bis zu den Vorwahlen waren es nur noch ein paar Wochen. Biden strengte sich wirklich an, brachte aber nicht immer genügend Kraft auf.
Nach Großevents im Januar 2020 waren sich seine Berater insgeheim einig, dass die Wähler einen geschwächten Kandidaten präsentiert bekamen, dem die vergangenen zwei Monate sichtlich zugesetzt hatten. Man konnte sich nicht sicher sein, dass die Wähler, die Bidens Auftritte miterlebten, ihn danach noch genauso unterstützten. Es gab Wahlkreisleiter, die nach solchen Veranstaltungen grußlos verschwanden.
Bidens Team war bewusst, dass er zwar nicht der beste Redner, doch mit seiner klaren Positionierung immer noch der beste Kandidat für das Duell gegen Trump war. Und vor allem das zählte, mehr als alles andere.
Laut Bidens engerem Umfeld waren erste Anzeichen einer verschlechterten Verfassung 2015 zutage getreten, nach dem Tod von Beau. In ihm, seinem geliebten Sohn Joseph Robinette Biden III., hatte der Vater eine höherwertige Version seiner selbst gesehen. Beau war der Kronprinz, er war zu dem Biden geformt worden, der eines Tages Präsident werden sollte. Der Armeeoffizier und Veteran des Irakkriegs wohnte mit Ehefrau und Kindern keine zwei Kilometer vom Haus seiner Eltern entfernt. Zweimal, 2006 und 2010, war er zum Attorney General von Delaware gewählt worden, für 2016 strebte er das Amt des Gouverneurs an. Ab Ende 2012 hatte Beau bereits Vorbereitungen für einen möglichen Präsidentschaftswahlkampf getroffen, er hatte einen Spendenprofi angestellt und politische Erkundungsreisen kreuz und quer durch alle Staaten unternommen.
Als Beau im Mai 2015 mit 46 Jahren an einem Glioblastom verstarb, war Joe Biden am Boden zerstört.
Die Beerdigung von Beau war eine der wenigen, auf denen er keine Trauerrede hielt. Weil er es nicht konnte.
Es war, als wäre etwas in ihm zerbrochen. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte uns damals: »Teile seines Verstands, seines Denkvermögens lösten sich auf, so als hätte jemand heißes Wasser darübergegossen. Als klar war, dass Beau sterben würde, merkte das jeder, der auch nur zehn Minuten mit Joe verbrachte.«
Auch andere Personen aus Bidens Umfeld machten diese Beobachtung. »Durch Beaus Tod ist er stark gealtert«, sagte ein langjähriger Vertrauter Bidens. »Seine Schultern wirkten schmaler, sein Gesicht hager. Man sah es in seinen Augen.«
Zusätzliche Sorgen bereitete Biden, dass Beaus jüngerer Bruder Hunter immer tiefer in die Cracksucht abrutschte. Auch Joe und Jill Bidens Tochter Ashley kämpfte gegen die Drogenabhängigkeit.
Biden hielt seine Familienangelegenheiten strikt aus der Öffentlichkeit heraus, doch seine Berater bekamen mit, wie Hunter seinen Vater am Telefon beschimpfte. Wenn wieder einmal schlechte Neuigkeiten über Hunter eintrafen, reagierte Biden ungewohnt schweigsam. Es sah aus, als würde er beide Söhne zugleich verlieren.
Beaus Krebsbehandlung offenbarte aber auch, welche Abwehrmechanismen und Vermeidungsstrategien die Bidens einsetzten, damit Gesundheitsprobleme nicht transparent wurden, auch wenn sie wie in diesem Fall den Träger eines öffentlichen Amts betrafen, nämlich den Attorney General von Delaware.
Im Sommer 2013 war Beau während des Familienurlaubs zusammengebrochen. Was darauf folgte, war eine Hirn-OP zur Entfernung eines Tumors. »Beaus Tumor war zweifelsfrei ein Glioblastom, Stufe vier«, schrieb Biden später über die postoperative Diagnose. »Das war sein Todesurteil«, schrieb Hunter. Beau reduzierte seine öffentlichen Auftritte, er gab keine langen Interviews mehr. Er wirkte abgemagert, hatte eine frische OP-Narbe am Kopf und dazu einen neuen Haarschnitt.
Im September berieten Bidens und Beaus Teams, wie viel sie über Beaus Zustand preisgeben sollten – immerhin war er der Sohn des Vizepräsidenten und Oberster Staatsanwalt eines Bundesstaats. Am Ende beschlossen sie zu schweigen. Im November versicherte Beau einem Lokaljournalisten, er sei »bei bester Gesundheit«.
Dies wurde im Februar von Dr. Wai-Kwan Alfred Yung gegenüber The News Journal bestätigt: Nach entsprechenden Untersuchungen könne Beau Biden ein einwandfreies Gesundheitszeugnis ausgestellt werden.
Der Öffentlichkeit wurde von dem behandelnden Neuroonkologen mitgeteilt, man habe eine »kleine Läsion« aus Beaus Gehirn entfernt. Tatsächlich handelte es sich um einen »mehr als golfballgroßen Tumor«, wie Joe Biden später zugab.
Beau blieb das ganze Jahr 2014 hindurch Attorney General von Delaware, gleichzeitig ließ ihn seine Familie zu allen möglichen Orten in den USA fliegen, um verschiedene experimentelle Behandlungen zu durchlaufen. Im Krankenhaus nahm man ihn oftmals unter dem Namen »George Lincoln« auf. Ab April 2014 zeigten sich bei Beau Sprachstörungen.
Beaus Ehefrau Hallie äußerte ihr Unverständnis darüber, dass man seine Krankheit geheim halten wollte. Wäre man an die Öffentlichkeit gegangen, hätten die Leute sicher hinter der Familie gestanden. Beau war ja von ihnen gewählt worden. Doch er und sein Vater waren dagegen.
Joe Biden wies sein Team bisweilen an, die Medien im Unklaren über seinen Aufenthaltsort zu lassen. Offiziell hieß es, Vizepräsident Biden sei über das Wochenende nach Delaware geflogen, dabei war er oft auch in Houston, bei Beau, der sich dort in Behandlung befand.
Die öffentliche Bekanntgabe von Beaus Krankheit hätte sie zu einem unumstößlichen Fakt gemacht. Die Bidens wehrten sich gegen die Realität.
Der innere Kreis
Jeder Präsident bringt seine loyale Entourage mit ins Weiße Haus, doch im historischen Vergleich war Bidens Stab eine besonders eingeschworene Gemeinschaft. Nichts drang nach draußen. 2015 rückte das Team angesichts von Bidens tragischem Verlust noch enger zusammen.
Im Wahlkampf 2020 spielten Jobtitel keine große Rolle. Es gab einen Kampagnenleiter, einen Kommunikationschef und weitere Wahlkampfmanager, die wahren Entscheidungsträger aber waren ein paar Politikveteranen, die intern mit den verschiedensten Spitznamen belegt wurden – unter anderem nannte man die kleine Gruppe aus Mike Donilon, Steve Ricchetti und dem Oberstrategen Bruce Reed das »Politbüro«. Alle hatten sie über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, für Biden gearbeitet.
2015 waren Anita Dunn und ihr Ehemann Bob Bauer zum Team gestoßen, um Biden bei seiner Präsidentschaftskandidatur zu unterstützen, wenngleich die meisten aus der Obama-Regierung hinter Hillary Clintons Plänen stand.
Donilon prägte schon seit Jahrzehnten die politische Strategie der Demokraten, er hatte Dutzende Kampagnen organisiert, angefangen Ende der 1980er-Jahre, als er Wahlkampf für Douglas Wilder gemacht hatte, den ersten afroamerikanischen Gouverneur eines Bundesstaats. Eher ein Einzelgänger und kein Mann der vielen Worte, zeigte Donilon sich oft unnachgiebig, wenn er eine feste Meinung zu einem Thema hatte. Früher hatte er sich an die Meinungsforschung gehalten, inzwischen folgte er lieber seinem Instinkt. Für Bidens Wahlkampf 2020 hatte er den Slogan »A Fight for the Soul of the Nation« erfunden und sich dabei auf eine recht verschwommene Datenlage gestützt. Auch Donilons Brüder standen in der Öffentlichkeit: Einer war Nationaler Sicherheitsberater unter Obama gewesen, der andere arbeitete als Sprecher des Erzbistums Boston. Sie teilten Bidens aus der irisch-katholischen Arbeiterklasse hergeleitetes Selbstbild. Als Präsident vertraute Biden Donilons Urteil so sehr, dass Berater schon witzelten, wenn er es nur wollte, könnte er Biden gar dazu bringen, einen Krieg zu beginnen.
Donilon war zugleich Bewunderer und Beschützer seines Chefs. Als 2016 Zweifel an Bidens Kandidatur laut wurden, beendete er diese barsch: »Das dürft ihr ihm nicht nehmen.«
Ricchetti, ein umgänglicher ehemaliger Lobbyist, vormals für Bill Clinton im Weißen Haus tätig, war während Beaus Krankheit Bidens Stabschef. Und er war außerdem sein Freund. Ricchettis vier Kinder bekamen am Ende alle einen Posten in Bidens Regierung. Er sah sich gerne Morning Joe auf MSNBC an und kam im Laufe des Tages immer mal wieder auf Ausschnitte aus der bidenfreundlichen Sendung zu sprechen – womit er bei den anderen meist nur ein Augenrollen erntete. Der redebegabte Jurist hatte gute Beziehungen zum Kongress.
Reed stammte aus Idaho, er war der Sohn eines Politikers und hatte als Rhodes-Stipendiat englische Literatur studiert. Er hatte sich als Redenschreiber für Al Gore betätigt und war danach Berater von Bill Clinton gewesen. Meist blieb er im Hintergrund, hielt sich aus Palastintrigen heraus und vermied Ärger. Es hieß, er sehe seine Aufgabe vor allem darin, alles Störende von Biden fernzuhalten.
2019 und 2020 sah das »Politbüro« in Bidens Alter höchstens einen strategisch gefährlichen Punkt, nicht aber eine Einschränkung seiner Fähigkeiten. Ricchetti machte daher den Vorschlag, Biden solle sich verpflichten, nur eine Amtszeit zu dienen.
Im nächstgrößeren Beraterkreis außerhalb des »Politbüros« saßen die Kommunikationsexpertin Anita Dunn und der angesehene Anwalt Robert »Bob« Bauer, die beide schon für die mächtigsten Demokraten Washingtons gearbeitet hatten. Sie hatten zwar nicht die beinahe familiären Verbindungen von Donilon, Ricchetti und Reed, dafür aber größeren Rückhalt beim Demokraten-Establishment, unter anderem bei Ex-Präsident Obama.
Dieser war der Ansicht, dass unter den Verantwortlichen für Bidens 2020er-Kampagne zu viele Hofschranzen und zu wenig wirklich gute Politikberater waren. 2019 äußerte er angesichts der Wahlkampfführung seine Sorge: »Biden ist mein Freund«, sagte er. »Ich möchte nicht, dass er gedemütigt wird.«
2020 bewarb sich Biden als der älteste Präsident, der jemals zur Wahl stand, und seine Wettbewerber aus den Reihen der Demokraten scheuten nicht davor zurück, diesen Schwachpunkt auszunutzen, indem sie Journalisten Recherchen der Opposition zuspielten, die Biden als kraftlos darstellten.
Tatsächlich liefen die Vorwahlen nicht gut für Biden. In Iowa landete er an vierter, in New Hampshire an fünfter Stelle, Bernie Sanders dagegen erreichte in Iowa den zweiten und in New Hampshire und Nevada den ersten Platz. Manche aus Bidens Kampagnenteam glaubten schon, damit sei es vorbei.
»Ich habe Neuigkeiten für das Demokraten-Establishment. Sie können uns nicht aufhalten«, verkündete Sanders, bevor ihn eben dieses Establishment erfolgreich stoppte.
Viele hochrangige Demokraten, auch Obama, glaubten, dass der selbst ernannte »demokratische Sozialist« Sanders gegen Trump nichts ausrichten könnte und stattdessen den weiter unten gelisteten Bewerbern bei den Vorwahlen schaden würde.
Nachdem dann moderatere Kandidaten wie Michael Bloomberg, der ehemalige New Yorker Bürgermeister, oder Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend in Indiana, und auch Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota, ins Hintertreffen geraten waren, wurde Biden zur letzten Rettung des Partei-Establishments. Im Grunde ist die Politik doch ein Zahlenspiel: Mit Biden ließen sich viele Schwarze Wähler gewinnen, mit den anderen nicht. Demokratische Politiker wie Jim Clyburn, Kongressabgeordneter aus South Carolina, sicherten Biden noch vor der innerparteilichen Vorwahl ihre Unterstützung zu und konnten ihm so zu einem überragenden Sieg verhelfen.
Am Super Tuesday im März 2020, dem Tag entscheidender Vorwahlen, räumte Biden ab, und das selbst in Staaten, in denen er kaum Wahlkampf betrieben hatte.
Biden und der Großteil seines Teams betrachteten diesen Sieg als Bestätigung. Sie hatten die richtige Strategie verfolgt, die Zweifler hatten unrecht gehabt. Wenn irgendjemand anmerkte, dass wohl auch Glück im Spiel gewesen sei, gerieten sie in Rage. Der Erfolg sorgte für neues Selbstvertrauen und ließ die Kritiker verstummen.
Biden konnte sich die Nominierung sichern, seine Kommunikationsprobleme aber blieben. Am 2. März brachte er die Worte der Unabhängigkeitserklärung nicht heraus: »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem, ähm, also, von ihrem …«
Im April hatte er Mühe, die Strategie gegen die Corona-Pandemie zu erklären. »Also, da war doch, ähm, während des Zweiten Weltkriegs, als Roosevelt diesen Plan hatte, dass, ähm, der ganz anders war als ein, als der, und es hieß, er nannte es das, ähm, da war dieser Krieg, und er hatte dann, also, dieses, das War Production Board«, stammelte er.
Die Demokraten bewahrten Stillschweigen. Ganz gleich, wie alt Biden war, er war immer noch besser als Trump.
Im Corona-Kokon
Es war ein schreckliches Eingeständnis, aber Bidens Berater räumten ein, dass die Corona-Pandemie zweifellos eine dramatische Katastrophe für die Menschheit insgesamt war, sie zugleich aber das Beste war, was Biden und seinen Hoffnungen auf das Präsidentenamt hatte passieren können. Sie bezweifelten, dass Biden ansonsten den Wahlkampfendspurt durchgestanden hätte.
Als es im März 2020 zu weitreichenden Lockdowns kam, konnte Biden den strapaziösen Veranstaltungen und Reisen entgehen, aus dem Homeoffice Wahlkampf betreiben und sich sonst in Wilmington ausruhen. Seine engsten Berater drängten darauf, öffentliche Termine möglichst auf den Nachmittag zu legen.
Die Corona-Isolation führte zudem zu einer veränderten Machtdynamik in Bidens engstem Führungskreis. Annie Tomasini, seit Jahren in Bidens Diensten, und Jills Topberater Anthony Bernal zogen nach Wilmington. In den kommenden Monaten gehörten sie zu den wenigen Personen, die durchgehend Zugang zum Kandidaten hatten. Oftmals waren die beiden die Letzten, mit denen das Ehepaar Biden am Abend sprach.
Das Duo stand seit Mitte 2000 in mehr oder weniger engem Kontakt mit den Bidens und hatte eine Art »Großer Bruder, kleine Schwester«-Verhältnis. Die beiden äußerst loyalen Mitarbeiter waren rund um die Uhr im Einsatz. Ihr Leben, das waren die Bidens, und umgekehrt waren sie für die Bidens unersetzlich. Tomasini und Bernal konnten das manchmal schwerfällige »Politbüro« geschickt umgehen, um bestimmte Dinge ins Laufen zu bringen. Sie waren wie Familie. Fast.
Es lag ihnen vor allem daran, Biden zu beschützen. Für ein Interview während der Corona-Lockdowns luden sie ein mit Biden vorbereitetes Frage-Antwort-Dokument auf einen Teleprompter – bis die Kampagnenführung dieses Vorgehen unterband.
Das Presseteam geriet in jenem Herbst in einige unangenehme Situationen, als es wiederholt mit der Frage konfrontiert wurde, ob Biden bei Interviews einen Teleprompter nutze.
Doch der Beschützerinstinkt war verständlich, denn selbst in genauestens choreografierten Zoom-Meetings mit wohlgesinntem Publikum trat Biden zuweilen ins Fettnäpfchen. Das Team war ständig bemüht, die Einstellungen und das Design der Videokonferenzen an Bidens Situation anzupassen. Hinter vorgehaltener Hand klagten die Berater, sie könnten sich nicht darauf verlassen, dass Biden sich an die vereinbarten Botschaften hielt. Oft hatte er eine geringe Aufmerksamkeitsspanne.
Virtueller Parteitag
Im August 2020 stand die Democratic National Convention in Milwaukee an. Das dafür zuständige Team der Partei grübelte, wie sich die Versammlung inmitten einer Pandemie und noch dazu mit einem betagten Präsidentschaftskandidaten mit abnehmender Kommunikationskompetenz organisieren ließe. Bidens Vorzug, der gerade im Vergleich mit Trump herausstach, war seine Empathie, die die Bürger an ihm wahrnahmen, und die Fähigkeit, normalen Bürgern authentisch und verständnisvoll zu begegnen. Doch an solche unmittelbaren Zusammentreffen war während der Pandemie nicht zu denken. Es musste ein anderes Konzept her. Biden sollte vor mehreren Monitoren Platz nehmen, auf denen jeweils ein Bürger oder eine Bürgerin zugeschaltet war, und drängende Fragen mit ihnen diskutieren.
Als das mehrere Stunden umfassende Videomaterial dieser virtuellen Begegnung ausgewertet wurde, trauten einige ihren Augen nicht.
»Es war schrecklich«, meinte ein führender Demokrat. »Er konnte der Unterhaltung überhaupt nicht folgen.«
Auch ein weiterer Parteikollege, der Biden einige Jahre nicht gesehen hatte, konnte es kaum fassen: »Es war, als säße da eine andere Person. Unglaublich. Wie der Großvater, den man eigentlich nicht mehr ans Steuer lassen darf.«
Nun wurde ein Spezialteam engagiert, das die Aufnahmen bearbeiten und vorzeigbar machen sollte, auch wenn nur ein paar Minuten Material übrig bleiben würden. Da hieß es, kreativ zu werden.
Am ersten Abend wurde ein knapp fünfminütiger Ausschnitt der Diskussion zur Chancengerechtigkeit gesendet, am darauffolgenden Tag zeigte man knapp vier Minuten zum Gesundheitswesen.
Das bearbeitete Material kam bei den Zuschauern recht gut an. Biden machte keine schlechtere Figur als andere ältere Menschen im Videochat. Zwei an der Produktion des Videos beteiligte Demokraten jedoch waren sprachlos.
»Ich konnte mir nicht vorstellen, dass er Präsident sein könnte«, erzählte einer der beiden. Sie bekamen ernsthafte Zweifel an Bidens Eignung. »Es gab manche wichtigen Parteiführer, die mit ihrer Wut kämpfen mussten. Ich war desillusioniert von dem gesamten Apparat. Was ich da in diesem 2020 aufgenommenen Video gesehen habe, mussten seine Mitarbeiter doch jeden Tag so erleben.«
Mit einem Abstand von vier Jahren fällte sein Parteikollege ein ähnlich harsches Urteil über Bidens Team: »Das war Gaslighting.«
Zwei weitere Demokraten dagegen meinten, die beiden hätten den Vorfall aufgebauscht. Das Videomaterial sei deshalb so schlecht gewesen, weil das Format unangenehm gewesen sei.
Virale Clips
Im Dezember wurde Rob Flaherty Teil des Biden-Teams. Zuvor war er bei den Vorwahlen für den ehemaligen Kongressabgeordneten Beto O’Rourke als Leiter der Digitalkampagne tätig gewesen. Er kannte Bidens gelegentliche Aussetzer und beobachtete, wie schnell Republikaner Clips von diesen Momenten verbreiteten, mochten diese Schnipsel authentisch oder verfälscht, angemessen oder unangemessen sein.
Flaherty war sich bewusst, dass man gegen Desinformation nur schwer vorgehen konnte. Und er wusste auch, dass es für jeden unfairen und gefakten Clip einen echten gab. Das Wahlkampfteam suchte nach der besten Strategie, diesen Videos etwas entgegenzusetzen. Und so flutete man die Zielgruppe mit Bildern eines starken, überzeugenden Präsidentschaftskandidaten, um so die Zweifel an seiner Eignung zu zerstreuen und dabei wiederum Zweifel an der Echtheit der anderen Clips zu säen.
Doch gegen die gefälschten Videos ließ sich kaum etwas ausrichten, denn die ihnen zugrunde liegende Annahme – dass Biden alt war und zu Versprechern neigte – war wahr.
Trump war nicht in der Lage, der schlimmsten Gesundheitskrise des Jahrhunderts erfolgreich zu begegnen, dennoch fielen die Wahlergebnisse knapper aus als vom Biden-Team erwartet.
Biden lag am Ende mit sieben Millionen Stimmen vorn, seine Mehrheit im Electoral College aber verdankte er einem Vorsprung von nur 43000 Stimmen aus Arizona, Georgia und Wisconsin – weniger, als Trump bei seinem Sieg im Jahr 2016 erreicht hatte. Im Repräsentantenhaus verloren die Demokraten Sitze, die Mehrheit im Senat war noch nicht gesichert.
Trotz dieses geringen Vorsprungs und der durchmischten Ergebnisse nahmen Biden und das »Politbüro« die Wahlen als Bestätigung, dass die Biden’schen Glaubenslehre zum Erfolg führe. Bidens Alter hatte bei den Wählern ernste Bedenken geweckt, dennoch hatte er gewonnen.
KAPITEL 4Die Biden’sche Art
Es war gar nicht so leicht, die Geistesschärfe des alternden Joe Biden zu beurteilen, denn es hatte schon immer diese besondere »Biden’sche Art« gegeben. Seit den 1970ern war der Politiker für cholerische Ausbrüche gegenüber Mitarbeitern bekannt – oft ohne sich an deren Namen erinnern zu können. Im Kapitol eilte ihm der Ruf voraus, zu langatmigen Erzählungen, peinlichen Entgleisungen und unpassenden Kommentaren zu neigen.
»In einem 7-Eleven oder Dunkin’ Donuts kann man nur bestellen, wenn man einen leichten indischen Akzent hat«, bemerkte er während des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 gegenüber einem indischstämmigen Amerikaner.
2007 nannte er Barack Obama, seinen Hauptkonkurrenten in den Vorwahlen, »den ersten Mainstream-Afroamerikaner, der sich gut ausdrücken kann und außerdem klug und sauber und gut aussehend ist. Ein Mann wie aus dem Bilderbuch.«
»Ich habe das nicht persönlich genommen, und ich glaube nicht, dass er das als Beleidigung gemeint hat«, sagte Obama gegenüber der New York Times. »Doch die Formulierung war vielleicht ein wenig unglücklich.«
Als Obama schließlich als Präsidentschaftskandidat nominiert wurde und Biden als Vize auswählte, wusste das Kampagnenteam nur zu gut, auf was sie sich da eingelassen hatten.
2021 aber brachte Bidens Neigung zu solchen Fauxpas mit sich, dass niemand mehr richtig einschätzen konnte, ob es sich bei seinen Aussetzern nun um Senilität handelte – und das galt nicht nur für Mitarbeiter und Journalisten, sondern auch für Regierungschefs anderer Länder. Ein ehemaliger europäischer Staatschef erlebte Biden während einer Besprechung im Rahmen der UN-Vollversammlung und erinnerte sich später: »Die Besprechung dauerte unglaublich lange, sicher anderthalb Stunden. Wir mussten dann irgendwann Schluss machen, aber er hat einfach weitergeredet. Es war, als würde man sich mit seinem Großvater unterhalten, er ist ziemlich weit abgeschweift.« Doch er kannte Bidens Ruf und fügte wohlwollend hinzu: »Aber er war schon immer ein bisschen so, oder?«
Ein Jahr danach kam es erneut zu einem Treffen, und dieses Mal blieb Biden noch weniger beim Thema. »[Außenminister] Tony Blinken musste ihn ermahnen, sich doch bitte dem vorliegenden Problem zu widmen, das in dem Meeting erörtert werden sollte.«
»Ich fand, er sollte sich nicht noch einmal zur Wahl stellen. Er war offensichtlich nicht ganz auf der Höhe«, lautete letztendlich die Einschätzung des Staatschefs.
Wenn man den Präsidenten täglich sah, war es sogar noch schwieriger, das Ausmaß seiner Senilität einzuschätzen. Mitarbeiter des Weißen Hauses sprachen vom »Frosch im Kochtopf«: Wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt und es ganz langsam zum Kochen bringt, merkt er, heißt es, den Unterschied erst, wenn es zu spät ist.
Der sich verschlechternde Zustand des Präsidenten, so das Argument, war für sein unmittelbares alltägliches Umfeld schwerer ersichtlich als für gelegentliche Kontakte. Bei Journalisten, Geldgebern und Abgeordneten der Demokraten, die den Präsidenten nur in größeren zeitlichen Abständen trafen, wuchs die Sorge, während seine engen Berater versicherten: »Es geht ihm gut.«
Als sich ein Spitzenberater Bidens nach dem katastrophalen Fernsehduell mit Trump am 27. Juni 2024 zum Vergleich Aufnahmen von der Debatte im Jahr 2020 ansah, war sein Erstaunen groß.
Viele enge Mitarbeiter Bidens aber bemühten sich, Bedingungen zu schaffen, die den alternden Präsidenten in ein günstiges Licht rückten. Wie 2024 zutage trat, machten sie sich damit wissentlich oder unwissentlich zu Komplizen dieser Verschleierungsaktion.
Nebenbei sei angemerkt, dass es sich bei der »Frosch im Kochtopf«-Geschichte um eine Legende handelt. Als man das Experiment nachstellte, hüpften die Versuchsobjekte ganz einfach aus dem Wasser.
Was unglückliche Situationen betrifft, hatte Bidens Entourage mit sehr viel schwierigeren Entscheidungen zu kämpfen als die Frösche.
KAPITEL 5»Ich, Joseph Robinette Biden Jr., schwöre feierlich«
2021
Am Nachmittag des 20. Januar 2021 saß das »Politbüro« im Oval Office des Weißen Hauses und wartete darauf, dass der neue Präsident aus seinem Wohnbereich herunterkam. Er trat ein und setzte sich an den Resolute Desk, den Schreibtisch des Präsidenten, und öffnete die Schublade, um den Brief seines Vorgängers Trump zu lesen, so wie das die Tradition will. Biden behielt den Inhalt des Briefes für sich, aber er nannte ihn »schockierend freundlich«. Dann wandte er sich dem Stapel von Dekreten zu, die zur Unterschrift bereitlagen, viele davon im Zusammenhang mit der Pandemie. Das Land war in einem schlechten Zustand, und es gab eine Menge zu tun.
Ron Klain war der neueste Zugang im »Politbüro« – genauer gesagt ein Rückkehrer, denn er hatte schon in den 1980er-Jahren einmal für Biden gearbeitet. In dessen Zeit als Vizepräsident war Klain sein erster Stabschef und wurde von vielen in Bidens innerem Kreis als Wendehals betrachtet, da er sich 2016 für die Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton engagiert hatte, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Biden noch selbst darüber nachdachte zu kandidieren. Er tat alles, um Bidens Anerkennung zurückzugewinnen, und hatte den Ruf, dass er hart arbeitete, politisch zupackend war und über gute Beziehungen innerhalb des Kapitols verfügte.
Der Rest füllte auch die obersten Hierarchiestufen des Weißen Hauses mit seinen unmittelbaren Familienmitgliedern. Reeds Tochter war anfangs zuständig für Bidens Tagesplanung, Donilons Nichte arbeitete im Nationalen Sicherheitsrat, und Ricchettis Kinder sollten Aufgaben im Eventmanagement des Weißen Hauses übernehmen, im Außenministerium, Finanzministerium und Verkehrsministerium.
Biden zeigte besonderen Respekt gegenüber Klain, auch wenn sein Stabschef häufig progressiver war als er selbst. Biden schätzte Klains Intelligenz sehr. Mitarbeiter hörten ihn einmal sagen: »Nur eine Person hier ist klüger als ich, und das ist Ron«.
Klains Anliegen war es, die progressiven Versprechen des Präsidenten zu erfüllen, um die Partei nach der Vorwahl zu einen, und so lenkte er das Staatsschiff nach links, weiter nach links, als es Biden während des Großteils seiner Karriere selbst gewesen war.
Neun Monate später passierte Bidens 1,2 Billionen Dollar schweres Infrastrukturpaket den Senat und näherte sich der Abstimmung im polarisierten und brutal kämpferischen Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Aus Sicht von Sprecherin Nancy Pelosi hatte Biden am Freitag, dem 1. Oktober 2021, nur eine Aufgabe, als sie ihn einlud, auf dem Capitol Hill vor dem Caucus, der Versammlung der demokratischen Mitglieder des Hauses, zu sprechen: Er musste sie bitten, für die Gesetzesvorlage zu stimmen – nur dafür.
Die Linken in der Fraktion wehrten sich dagegen. Der Infrastrukturdeal sollte in ein größeres Paket eingebunden werden, eine progressive Wunschliste mit dem Namen »Build Back Better«. Sie wollten nicht auf ihre Ziele für eine weitreichendere Gesetzesinitiative verzichten.
Die Vorsitzende des Congressional Progressive Caucus, die Kongressabgeordnete Pramila Jayapal aus Washington, war skeptisch, ob die moderaten Mitglieder für den Build Back Better Act stimmen würden, wenn man sie nicht dazu zwang. An dem Abend, bevor Biden zum Kapitol kam, teilte sie Klain mit, dass er nicht mit den Stimmen der Progressiven rechnen könnte, wenn die beiden Gesetzesentwürfe nicht miteinander verbunden würden.
Die Kritiker dieses Vorgehens warfen den Linken Erpressung vor und befürchteten, dass sie so einen sicheren Sieg in eine Niederlage verwandeln würden. Pelosi unterstützte den Build Back Better Act, aber ihr war auch klar, dass es nicht genug Stimmen dafür im Senat geben würde, damit das Gesetz passieren könnte. Biden musste also alle Demokraten im Repräsentantenhaus auffordern, das Infrastrukturpaket geeint zu unterstützen, um sich dann, nach dessen Erfolg, Build Back Better vorzunehmen.
Biden sprach etwa dreißig Minuten lang. Es war eine lange Rede, in der er immer wieder abschweifte. Er zitierte den herausragenden Pitcher