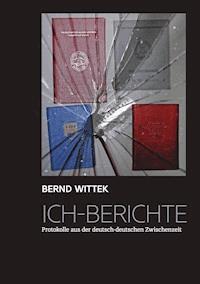
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ohne die Motive des Handelns zu kennen, sollte nicht über Menschen geurteilt werden. Dies ist aber im Verlauf der Wiedervereinigung Deutschlands geschehen und betraf Aussagen über diejenigen, die sich mit der DDR identifiziert hatten. Der Autor befragte Anfang 1990 SED-Mitglieder und Angehörige der Staatssicherheit zu ihrem Resümee des Lebens in der DDR. Die Befragten gaben Auskunft, verzichteten in dieser Situation der unsicheren Zukunft auf klischeehafte Antworten. Fünfundzwanzig Jahre lang wurden die Texte nicht veröffentlicht. Erst jetzt scheint die Zeit reif, dass eine ruhige Rezeption solcher biografischer Selbstreflektionen möglich wird. Nun – mit größerem zeitlichen Abstand – scheint das Verstehen einer historischen Epoche möglich zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich danke Herrn Heiko Schmidt, Oberkrämer, für die Gespräche und Anregungen zum Manuskript.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Vorwort 1990
Vorwort 2002
Die Fragen
Die Dolmetscherin
Der Lehrmeister
Der Arzt
Die Journalistin
Der Lehrer
Der Außenhändler
Der hauptberufliche Informant
Die Büroangestellte
Die Rentnerin
Der Wachmann
Kandidatenantrag für die SED
Parteiauftrag
Erklärungen
Leseliste
Einleitung
Der Vorhang war offen, die Maske gefallen. Die Bretter, auf denen sich die Menschen aufhielten, die in jenem Land sich ein Leben eingerichtet hatten, schwankten und brachen. Spätestens mit der nicht mehr von der DDR-Regierung gesteuerten Öffnung der befestigten Grenzanlagen nach Westberlin und der Bundesrepublik war klar, dass kaum etwas im Osten Deutschlands weiterhin so Bestand haben würde, wie es bis dahin existiert hatte. Eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten zeichnete sich Anfang des Jahres 1990 zunehmend deutlich ab.
Ich glaube, dass ein jeder sich im Laufe des Lebens ganz private Erklärungen für die eigene Vita zurechtlegt, wie alles so gekommen ist. Die eigene Wegstrecke möchte gerne ohne große Umwege erklärt werden. Es ist das Bestreben, sich selbst logisch in Zusammenhängen zu sehen, auch zu rechtfertigen. So etwas findet permanent statt: In der Selbstreflektion, in Partnerschaften, Familien, Vereinen, eben in allen Gemeinschaften. Wir Menschen sind ein soziales Wesen, emotional gesteuert in unserem Verhalten. Es ist gesund, ein positives Verhältnis zu uns selbst zu entwickeln.
Dass sich Menschen plötzlich kollektiv drastisch rechtfertigen müssen, ist ein selteneres Phänomen und findet nur statt, wenn Systeme kollabieren, Ordnungen umgestülpt werden.1 Kollektive Selbstlegitimationen gab es schon immer, stets dann, wenn neue abgrenzende Gemeinschaften zu bilden waren. In der DDR geschah dies sicherlich durch die verbreitete Annahme, dass durch die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen2 eine „menschlichere“ Zivilisationsstufe erreicht worden sei, wie sich dies auch in den hier vorliegenden Texten lesen lässt, während der Konsumentenalltag im Westen, in der Bundesrepublik, die irre Annahme verfestigte, dass die Geschichte der Menschheit ein geradliniger Weg zur individuellen juristischen und persönlichen Entscheidungsfreiheit sei. Der deutsch-deutsche Alltag trennte die Menschen in ihren Köpfen scharf und doch gab es Gemeinsamkeiten. Die Achtundsechziger Generationen und deren Nachfolger im Westen glaubten, die Welt grundlegend verändern zu können. Eine solche Vorstellung der Möglichkeit des Eingreifens des Einzelnen in die sozialen Verhältnisse wurde auch im Osten praktiziert, wie sich an den Texten hier erkennen lässt. Die marxistische Vorstellung der Gestaltbarkeit gesellschaftlicher Verhältnisse traf zusätzlich ab den siebziger Jahren auf die Übernahme eines „westlichen“ Lebensgefühls der Individualität, das sich dort in einzelnen sozialen Experimenten geäußert hatte (beispielsweise in der Lebensform „Kommune“). Im Osten begann man allmählich auch „cool“ zu sein, das eigene Ich immer höher einzuschätzen. Durch Rundfunk- und Fernsehempfang war der Osten stets an den Westen gekoppelt.
Angedeutet werden soll damit, dass die Geschichte Ost die Rezeption der Situation West mit einschloss. Und doch ist die Situation im Osten und die Vorgeschichte des Landes DDR zu betrachten, um Antworten auf das Verhalten der Menschen in jenem Land zu finden, das seinen Bürgern schnell die Grenzen aufzeigte. Dennoch, behaupte ich, war die DDR als gemeinschaftliches Projekt (zunächst) mehrheitlich angenommen worden. Man engagierte sich für das Land, rannte ins Leere, wurde dann womöglich oppositionell oder angepasst (als Besitzer einer „Datsche“ genannten Gartenlaube). Wie auch immer das einzelne Verhalten gewesen sein mag. In jedem Fall hat der Einzelne sich seine Vorstellung von der Welt, vom DDR-Kosmos, zurechtgelegt. Erst die drastischen und vor allen Dingen so unglaublich schnell ablaufenden Veränderungen 1989, die daher durchaus Revolution genannt werden können, führten dazu, die Dinge im Kopf „auf den Kopf“ zu stellen. Wenn solche drastischen Zusammenbrüche erfolgen, betrifft das jeden Einzelnen in der Gesellschaft, der auf einmal das Ende seiner vorgeprägten, man könnte auch sagen, seiner klischeehaften Weltsicht erlebt. Die Menschen in der DDR schufen sich selbst keine neue Gesellschaft als Staatsstruktur. Sie kam „unerwartet“ aus dem Westen mit dessen juristischen und moralischen Maßstäben über sie.3 Das Abtreten der alten Garde des Politbüros war ersehnt und für möglich sowie für wünschenswert gehalten worden. Dass die sowjetische Besatzungsmacht ihre westlichste Kolonie innerhalb des militärischen Ostblocks so plötzlich aufgeben würde, war jedoch außerhalb des Vorstellungshorizonts gewesen und erst eine Folge der Kettenreaktionen von schnellen Zusammenbrüchen weiterer sozialistischer Staaten nach den Ereignissen in der DDR.
Wir alle werden in konkrete Zeiten und Zusammenhänge hineingeboren, in die Wertvorstellungen der anderen, der Erwachsenen: Unserer Eltern und dann die der Lehrer, in die Mentalität der jeweiligen Region, wachsen dort auf und übernehmen die Beurteilungskriterien mehr oder weniger kritisch prüfend. Die Annahme, davon autonome und erfolgreiche Selbstfindungsprozesse durchführen zu können, ist eine (spätere, westdeutsche) Illusion, die bezogen auf diejenigen, die das verfechten, lediglich zeigt, dass sie etwas Grundlegendes nicht verstanden haben: Der Mensch ist nur als soziales Produkt vorstellbar.4
Jede private oder gemeinschaftliche Vorstellung von der Welt hat eine Vorgeschichte, die besonders einprägsam ist, solange persönlich noch die vorhergehenden Generationen gekannt werden, neben den Eltern die der Großeltern. Damit ist es notwendig, an die Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu erinnern. Dieses versprach bei seinem Anbruch zunächst sehr viel. Es schien der Beginn eines neuen Zeitalters zu werden, der Anfang einer Epoche, die den Menschen über sein Schicksal endlich triumphieren lassen würde. Tatsächlich wurde es ein katastrophales Jahrhundert, mit dem die Zeitgenossen nicht fertig werden würden und sie dazu führte, den Kindern eindeutige Lebensmaximen mit auf den Weg zu geben und wenn es bloß die Empfehlung war, sich politisch auf jeden Fall zurückhaltend zu verhalten.
Die Dampfmaschinen hatten ab etwa 1840, beginnend mit dem Bau von Eisenbahnen, die Hebel auf technischen Fortschritt umgestellt. Dadurch und erst recht, als sich um 1900 auch noch die Elektrizität durchsetzte, ließ sich technisch Großartiges künftig als wahrscheinlich annehmen. Und der Mensch? Ihm war Gleiches zuzutrauen, denn er würde in der Lage sein, die Prinzipien des Lebens umzuwerten, sich die Natur (auch die des Menschen) problemlos untertan zu machen. Die Zeit der „Ismen“ brach los: Sozialismus, Kapitalismus, Monopolismus. Die Welt schien systemisch zu funktionieren: So wie eine Fabrik, und sich mit Hilfe der noch so jungen „Wissenschaft“ des Geistes5, auf Begriffe bringen zu lassen, um die Abläufe in der „Fabrik Staat“ zu verstehen. Handlungswissen wurde zu einem Bedürfnis, um in den „Kämpfen der Zeit“6 die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Dafür benötigte man Bewusstsein: Eine Formulierung, die jenen Bildungswillen beschrieb, die Welt begreifen zu wollen, denn das Leben erschien in dieser Zeit des Übergangs vielen Menschen als Konstrukt durchschaubar. Die Naturwissenschaften bestärkten die Hoffnung, dass alles endlich erkennbar sei und jeder Mensch alles lernen könne.7 Noch in den siebziger und achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts dominierten mechanische Auffassungen von der Welt und vom Leben (teilweise auch im Westen), dem proletarischen Kampfmotto entsprechend: „Alle Räder stehen still, wenn Dein starker Arm es will!“.
Doch an der Schwelle zum zwanzigsten Jahrhundert waren aus Dorf- und Kleinstadtbewohnern in langen Schichten arbeitende Großstadtmenschen geworden, die nun oft maschinengleiche Tätigkeiten ausübten und sich zunehmend nur noch als „Masse Mensch“8 empfanden, entfremdet auch gegenüber dem Ergebnis ihrer eigenen Arbeit, dessen Sinn und Nutzen zu verstehen (zum Beispiel als Einzelteil einer komplizierten Maschine) mitunter sogar unnötig geworden war. Die Werktätigen wurden bloßer Bestandteil eines längeren Herstellungsprozesses, die Gefolgsgesellen der Rotationsgeschwindigkeiten von Maschinen und Fließbändern. Aus der neuen Gefangenschaft in den Verhältnissen glaubte man jedoch sich auch befreien zu können, wenn es gelänge, die Ketten sozialer Ungleichheit zu sprengen, denn einerseits gab es da die Neureichen in ihren Villen, andererseits die Arbeiterwohnkasernen mit beengten Hinterhöfen. Es ging um soziale Gerechtigkeit, die als zu erreichende allgemeine Gleichheit angesehen wurde.
Es war die Zeit der Etablierung der Arbeiterbewegung. Parteien hatten einen enormen Zulauf. Das Leben hatte seine Aura verloren. Der Mensch im Kapitalismus war überraschenderweise austauschbar geworden, so wichtig oder unwichtig wie die Produkte, die er besaß (später würde man das Konsumgüter nennen). Die „kleinen Leute“, die Besitzlosen wurden DIN-gerecht normiert, wie eine Notwendigkeit in der Industrieproduktion, ersetzbar und doch als einzelne Persönlichkeit irrelevant in der Transmissionsriemenfabrik, die den Takt vorgab für die Arbeit. (Es darf nicht vergessen werden, dass die Gesellschaft seinerzeit durchgreifend arbeitssozialisiert war.) Im bäuerlichen Leben hatte das Traditionelle und Hierarchische dominiert. Nun stellte sich das Geldliche davor. Das zwanzigste Jahrhundert erzeugte in Bezug auf die Vorstellung vom Menschen ein Paradoxon: Die Erwartung des gottgleichen Beherrschens aller Verhältnisse durch den Einzelnen und zugleich die individuelle und doch so allgemeine Erfahrung der Reduzierung des Menschen in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Der demokratische Anfang, eine nicht mehr so sehr moralisierende und hierarchische Regelung der Gesellschaft zu errichten wie zuvor, musste daher notwendigerweise als zu sachlich erscheinen, was sich in dem von der Nazipropaganda diffamierend eingeführten Begriff „Systemzeit“ wiederfand. Die Regelung der deutschen Verhältnisse nach so distanziert erscheinenden Gesetzesbuchstaben trat dem Einzelnen nüchtern gegenüber. Den Vorteil dieses abstrakten Verhältnisses des Staates zum einzelnen Bürger zu erkennen, gelang den meisten Menschen noch nicht. Sie meinten im Gegenteil noch einmal eine eigene Bedeutsamkeit des Lebens erreichen zu können, zum Beispiel als Klassenkämpfer, als Teil einer Avantgarde der „Masse Mensch“.
Es ereignete sich zudem die Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Der Einzelne empfand sich als hilfloses Kanonenfutter, denn es war im Kampf eben nicht mehr zu der noch erhofften Selbstbestätigung des kämpfenden Individuums gekommen, welches sich mit Schlauheit und Stärke durchsetzte. Die Soldaten fielen im Gefecht durch Technologie, angewendet häufig aus anonymer Distanz. Dies bestärkte erneut und gegen den eigentlichen Inhalt der Moderne die Vorstellung der Schicksalshaftigkeit des Lebens: „Man wurde gelebt“ und lebte nicht selbst. Es verlangte in der Not, die kriegsbedingt auch Hunger bedeutete, allgemein nach einer Umkehrung der Verhältnisse, auch nach einer Revolution, die zur Veränderung des Landes führen sollte: Emanzipation durch Gleichheit und Einheit. Diese Revolution ließ sich jedoch nicht in einem deutschen Reich verwirklichen, das trotz Abdankung des Monarchen immer noch um eine kaisertreue Identität rang. Ein zweites Paradoxon jener Jahre. Nationalstaatlichkeit definierte sich zu jener Zeit in Europa durchaus noch nach gefühlten Völkerpsychologien9, als noch versucht wurde, Menschliches nach naturwissenschaftlichen Vorbildern streng und dabei doch sehr simplifizierend - wie wir heute wissen - zu kategorisieren. Daraus folgte schließlich auch die Vorstellung, Menschen qualitativ, das heißt rassisch, unterscheiden zu können. Dies führte zu den verbrecherischen, schrecklichen Folgen.
Als Reaktion auf die noch wenig begriffene, so grundsätzliche Veränderung sämtlicher Verhältnisse, auf die undurchschaute Modernisierung in ihren Konsequenzen, ist auch die Hoffnung zu sehen, ein neues, besseres Leben erzwingen zu können, nicht den Menschen umzuzüchten, sondern dem Determinismus der marxistischen Theorie folgend, die Lebensumstände zu ändern: Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein.10 Eine durch eine letzte (vielleicht auch internationale) „Klassenschlacht“ zu errichtende Gesellschaft könnte endlich die Profitinteressen Einzelner durch den sozialistischen Staatsbesitz von Unternehmen verhindern, das tatsächliche, endgültige Glück des Menschen ermöglichen und die Befreiung des Einzelnen mit Hilfe von Technologie aus der Sinnkrise seiner Existenz: „Brüder zur Sonne zur Freiheit, Brüder zum Lichte empor…“11.
Die Konservativen und Rechten in der Gesellschaft hingegen verfolgten intensiv den Gedanken, in traditioneller Fortführung die Nation stärken zu müssen, sie gegen die europäischen Nachbarn zu einer Monopolstellung in der Welt zu führen, um so Lebensgrundlagen zu sichern.12 Die Nazis entwickelten ihre Ideologie im Unverständnis der unausweichlichen Globalisierungstendenz der Marktwirtschaft! Die Kommunisten verdrängten in ihrem Weltbild, die innovative, dem Menschen das Alltagsleben erleichternde Potenz der Marktwirtschaft, da ihr Blick auf gleiche (diktatorisch zu erreichende) Menschenrechte gerichtet war, denen sich die wirtschaftliche Grundlage des Lebens unterzuordnen hatte.
Es waren die wirren zwanziger Jahre politischer Instabilität in der Inflationszeit13, die eigentlich beides nahelegten: Eine sachliche und nüchterne Betrachtung der menschlichen Existenz (verbunden mit der Suche nach reformierenden, demokratischen Lösungen für eine bessere soziale Zukunft) und zugleich einen Drang, nun entschieden und mit nie zuvor da gewesener Radikalität vorzugehen, da die Umstände dafür günstig erschienen. In Deutschland setzten sich fast zufällig die radikalen rechten Kräfte durch.
Von heute aus betrachtet wird nur zu verständlich, inwiefern dies den Ausgangspunkt für die weiteren Ereignisse des zwanzigsten Jahrhunderts bildete. Es ist die Zeit um die Machtergreifung der Nationalsozialisten herum, die noch die Lebensentscheidungen der weitaus später Geborenen, hier zu Wort Kommenden, lenkte. In einem Fall dieser Ich-Berichte ist es aufgrund des Alters die eigene Jugendprägung, in weiteren Texten die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit, die einen bestimmten Weg einschlagen lässt, in einem Bericht sogar die Jugend nach dem Ersten Weltkrieg.
Die Themen der zweiten Jahrhunderthälfte waren durch die erste gesetzt worden: Selbst für die hier zu Wort kommenden Zeitzeugen, die erst Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, dominierten die Themen „Frieden“ und „soziale Gerechtigkeit“, verbunden mit der Selbstverpflichtung, als Staatsbürger engagiert zu sein. Wer lebensbejahend eingestellt war, die Welt, die ihn umgab, erst einmal annahm, diese sogenannte „realsozialistische“ Welt, hatte eigentlich keine Mühe sich zu dem Land zu bekennen, welches sich die oben genannten Ziele als wichtigste Themen täglich in die Zeitung schrieb. Vergessen werden darf auch nicht, dass sich die DDR auf protestantischem Gebiet befand. Die Menschen waren es über Generation gewohnt zu missionieren bzw. missioniert zu werden, „Gutes“ zu tun, andere zu etwas zu zwingen. Das schloss auch mit ein, sich selbst zu disziplinieren, zu zensieren, zu überwinden. Die Menschen der verloren gegangenen Ostgebiete hatten den Krieg besonders grausam erfahren. Und dennoch prägten Schuldgefühle und der Wille, neu anzufangen, wohl die meisten Deutschen in allen vier Besatzungszonen. „Das System“ (das politische und/ oder wirtschaftliche) für das eigene brutale Verhalten verantwortlich zu machen, half sich selbst zu entlasten. Zudem hatten viele die Ereignisse so erfahren, dass sie „über sie gekommen waren“, wollten so etwas nie wieder geschehen wissen, nirgendwo auf der Welt. „Lieber jeden Tag trocken Brot essen.“14
Nach 1945 setzte Hochkonjunktur ein: Für Gesellschaftsexperimente. Man war bereit, grundlegende Reformen anzugehen. Im Westen dämmten die Alliierten diese Versuche ein. Im Osten erfolgten unter sowjetischer Anleitung die Verstaatlichung von Betrieben und die Bodenreform.15 Die von letzterer profitierten, stützten die DDR häufig bis zu deren Ende. Auch die Wurzeln der Europäischen Union liegen nicht zuletzt in dem durchaus sozialistischen Gedanken, durch die gemeinsame Kontrolle der deutschen und französischen Montanindustrie zu verhindern, dass sich nationale Interessen noch einmal blutig durchsetzen.
Im Osten Deutschlands war der Alltag nun einmal sozialistisch nach sowjetischem Muster geworden, so ähnlich wie überall im Ostblock.
Ich habe mich entschieden, diese Texte „Ich-Berichte“ zu nennen. Sie gehen individuellen Entscheidungsfindungen nach. Nach der Wiedervereinigung war viel die Rede von IM-Berichten, Berichten Informeller Mitarbeiter16 der Staatssicherheit, von denen es viel zu viele gab und die nicht selten auch den Nachbarn beobachteten. Aber es muss auch gesagt werden, dass das Berichten an sich zu den Erscheinungen des DDR-Alltags gehörte. Man berichtete über sich und andere, Produktionserfolge oder kulturelle Erlebnisse. Der Titel „Ich-Berichte“ erscheint mir passend.
Am sicher absehbaren Ende des Landes stand nur noch die Reflexion über das eigene Verhalten im Vordergrund. Das bildete die Grundlage für dieses Buch. In der Summe vermag dies vielleicht als eine Art Geschichtsrevue gelesen werden, womöglich sogar als ein Panorama exemplarischer Lebensläufe von DDR-Unterstützern und ihrer Motive, nicht nur durch die inzwischen notwendig gewordenen Anmerkungen, sondern auch weil die Ich-Berichterstatter oft weit ausholten.
Eigentlich müssten die Befragten ausführlich definiert haben, was sie tatsächlich unter dem Gesellschaftsexperiment DDR verstanden hatten. Beim heutigen Lesen der einzelnen Interviews fällt jedoch auf, wie wenig und wenn, dann wie unterschiedlich Sozialismus von den Befragten definiert wurde. Einerseits war es Metapher für soziale Sicherheit, andererseits wurde es definiert als Gleichheits- und Gerechtigkeitsanspruch und Erwartung an die Gesellschaft. Es wurde mitunter auch nur gleichgesetzt mit dem marxistischen Theorieentwurf, dass die Eigentumsverhältnisse bestimmte Gesellschaftsformationen festlegten und der staatliche Besitz von Produktionsmitteln erst das Gesellschaftsexperiment des „neuen Menschen“ ermöglichen würde. Dieses Projekt des neuen Menschen aus den zwanziger Jahren wurde in der DDR nicht formuliert: Ja, der Mensch sollte geändert werden. Aber die Radikalität des ursprünglichen Vorhabens wurde in der DDR-Agitation dahingehend gemildert, dass angenommen wurde, dass der „bessere, moralischere Mensch“ durch die Verhältnisse entstehen würde. Die Begrifflichkeit des „neuen Menschen“ wurde aufgegeben. Gesprochen wurde daher immer vom Sozialismus als der „menschlicheren Gesellschaft“. Inhaltlich blieb das Konzept identisch.
Die Deutschen in Ost und West lebten also in sehr verschiedenen und dennoch miteinander verbundenen Welten. Und dann, nach 1989, die Wiedervereinigung: Ein geglückter Prozess? Als im Jahr 2013 ein Radiointerview aus Anlass der Maueröffnung mit einem Wissenschaftler gesendet wurde, kommentierte dies mein damals fünfzehnjähriger Sohn mit den Worten: „Dort müssten eigentlich zwei sitzen, ein „Ossi“ und ein „Wessi“.“ Das ist die entscheidende Frage: Warum findet dieser Dialog unter den Deutschen immer noch so selten statt und wenn, dann häufig nur im Privaten? Durch den Lebensalltag sind sich die Ost- und Westdeutschen zweifellos längst näher gekommen, in der akademischen Diskussion weniger. Die Ursache hierfür wird die Entfernung fast aller DDR-Geisteswissenschaftler in den Jahren unmittelbar nach der Wiedervereinigung sein.17 An Hochschulen und Universitäten gibt es daher seit Jahrzehnten kaum Personen, die die Atmosphäre im Land persönlich kennen und sie nicht nur intellektuell „rekonstruieren“ müssen. Ein entspanntes deutsch-deutsches Verhältnis in den Köpfen wird es erst geben können, wenn allgemein das zwanzigste Jahrhundert verstanden worden ist. Ostdeutsche Geisteswissenschaftler hätten sich dabei als hilfreich erweisen können.
Was bleibt von der DDR, fragte in der Wendezeit die in Ost- und Westdeutschland damals populäre DDR-Autorin Christa Wolf.18 Die Antwort hätte sein können: Die ostdeutsche Lebenserfahrung, dass die eigene Existenz wesentlich geprägt ist von der Geschichte und den Zwängen, in denen man lebt. Die Erfahrungen der DDR-Bürger hätten eine Entgegnung sein können, etwas, das bleibend gegen die aus der Bequemlichkeit des Lebens heraus (nun auch im Osten) so leicht erwachsende Tendenz des schnellen Diktums argumentieren würde.
Lange glaubte ich, dass die Bundesrepublik durch das Wirken der Achtundsechziger zu einem demokratischen Land geworden ist, das sich kritisch dem Umgang mit der Nazizeit stellt. Das mag auch immer noch nicht ganz falsch sein, besonders, wenn dabei an die Öffentlichkeit, die Literatur und die Medien gedacht wird. Andererseits wurden aber die Grundlagen der heutigen, bundesdeutschen Gesellschaft in den fünfziger Jahren geschaffen, maßgeblich auch von Leuten, die in der NS-Zeit als Täter verstrickt waren. Haben sie gerade, weil sie aus eigener Erfahrung wussten, wie sehr der Mensch ideologisch gefährdet ist, einen so pathoslosen, bloß juristisch begründeten Staat geschaffen?19 Wäre es in Ostdeutschland anders verlaufen, wäre den Ostdeutschen nicht der Sozialismus als Programm verordnet worden? Ist es aber andererseits nicht auch so, dass das bloße Wissen um die Karrieren ehemaliger Nazis im Westen bei Leuten im Osten zu solchen Abwehrhaltungen gegen die Bundesrepublik führte, dass es für das eigene Handeln motivierte, für das sozialistische Programm des „neuen besseren Menschen“, für den Schutz eines Gesellschaftssystems beflügelte, das so im Osten zu einem persönlichen moralischen Anliegen geriet, „Bau auf“, „Glück auf“?
Letztlich definierte sich die DDR stets nur als Gegenprogramm zum Westen, das moralisch überlegene Teildeutschland Ost, das seine Lehren aus der Geschichte gezogen hatte - ohne zu begreifen, was sich im Westen vollzog, dass die alten Eliten nämlich durchaus nicht selten doch auch ihre „Lehren“ gezogen hatten. Aber die besonders kriegsgebeutelten Ostdeutschen fanden es besonders unangenehm, ja unerträglich, dass die alten Funktionsträger sich dort reaktivierten, während in der sowjetischen Zone, dann in der DDR, Beamte mit Nazivergangenheit in den meisten Gesellschaftsbereichen konsequent ausgetauscht wurden und sich neuen Leuten eine für Ihre Verhältnisse unerhörte Chance bot, häufig solchen, denen bisher ein gesellschaftlicher Aufstieg verwehrt worden war, welchen aus niederen Gesellschaftsschichten. Auch dieser nicht zu vergessende historische Fakt erklärt die langanhaltende Stabilität des Landes DDR.20
1989 wurde der gesamte Maßstab, über den der Einzelne verfügt, im Osten in Frage gestellt. Nach der Öffnung der Grenzen und nach dem Kollaps der SED-Diktatur mussten sich „Täter“ wie „Opfer“ nur wenig zeitverzögert fragen, ob ihre Lebensleistung denn etwas wert gewesen sei, wenn sich die Institutionen auflösten und die Betriebe, Bauwerke und Denkmäler des Sozialismus weggebulldozert wurden und dafür die Regeln und moralische Maßstäbe eines Nachbarlandes über Nacht als Gesetz galten. Opposition in der DDR zielte auf Verbesserung des Projekts Sozialismus, nicht auf dessen Beendigung.21 Allein dadurch überlagerten sich nicht selten Staatsnähe und Staatsferne, wie es zum Teil in diesen Ich-Berichten zu lesen ist. Der simple Anschluss an die Verfassung des Bundesrepublikstaates stand in der Realität der stabilen wie krisengeschüttelten DDR einfach nicht zur Debatte. Dass dies ein Tabu des Kalten Krieges war und wenn, dann unter den Besatzungsmächten auszuhandeln wäre und nicht unter Ostdeutschen, machte allein die Präsenz sowjetischen Militärs auf ostdeutschen Straßen deutlich. Die plötzliche Implosion der DDR erzeugte - um einen DDR-Begriff zu benutzen - letztmalig im „Kollektiv“ ihrer Bewohner das Gefühl missbraucht und betrogen worden zu sein. Durch die Hast beim Vollzug der Wiedervereinigung sahen die ehemaligen DDR-Bürger sich vom Westen übervorteilt. Das geschah allein dadurch, dass Ostdeutsche sich juristisch nicht schnell genug im neuen Leben zu orientieren vermochten und so objektive Nachteile erlitten (beispielsweise durch Übervorteilung durch westdeutsche Makler in Grundstücks- oder Versicherungsfragen). Das Beklagen dieses Zustandes führte dazu, dass der Westen – wenig hilfreich in dieser Situation - „Jammerossis“ entdeckte. Wurde (und wird?) sich jenseits der abgerissenen Mauer viel Mühe gegeben, die Vorgänge zu verstehen?22
Übervorteilt und missbraucht gefühlt haben sich die vielen SED-Mitglieder und Angehörigen der Polizeiapparate aber schon zuvor, dann zunehmend immer mehr in der Wendezeit, als sie etwas bekämpfen sollten, was ihnen als Aufgabe immer weniger sinnvoll erschien und nur der alten Politgarde noch nutzte. Ende 1989 wurden die zuvor nur teilweise erahnten Konsumentenvorrechte des Politbüros publik – mit schockartiger Wirkung.
Wer diese Texte liest, sollte bedenken: Entscheidende Informationen, um den Charakter des Staates, in dem sie lebten, deutlicher erkennen zu können, fehlten den Menschen. Sie kannten zum Beispiel das Ausmaß bestimmter Makel des Landes nicht, etwa die genannten Privilegien des Politbüros. Es gab in dieser Hinsicht eine viel beschränktere Öffentlichkeit, als man sich das heute im digitalen Zeitalter vorzustellen vermag.
Ich war Anfang 1990 fünfundzwanzig Jahre alt. Auch meine eigene Verunsicherung war hoch. Ich sah eine einmalige Chance, diejenigen zu befragen, die in dieser Situation wohl am meisten verunsichert waren und die sich noch kein neues stabiles Weltbild zurechtgelegt hatten. Leute zu interviewen, wie sie die Welt sahen, wenn man selbst noch keine Antworten hatte, war auch eine Möglichkeit, die Ereignisse für sich selbst zu verarbeiten.
2002 fielen mir die Texte wieder in die Hand, ich verfasste ein Vorwort und legte danach alles wieder in die Schublade. Ostler und Westler konnten nach meiner damaligen Einschätzung immer noch nicht einander so zuhören, dass auch ein Ostlebenslauf einen Wert hatte.
Heute – fast fünfundzwanzig Jahre nach der Wiedervereinigung - überrascht mich, wie viel mir die Leute anvertraut haben, wie detailliert sie über ihr Privatleben sprachen. Doch wir waren alle sehr politisiert im Osten. Da kam man (und kommt noch immer) schneller zum Thema, auch das Persönliche betreffend. Freilich hatte ich ihnen Anonymität zugesichert und selbst die Vornamen stimmen nicht. Den „Wachmann“ hatte ich, wenn ich mich richtig erinnere, einfach vor dem immer noch existierenden Objekt angesprochen und wir unterhielten uns dann in dem Gebäude. Ich sah ihn nur noch ein zweites Mal. Bei ihm wie bei der Mehrzahl der Interviewten weiß ich nichts über den weiteren Lebensweg. Da ich mir seinerzeit bewusst nicht die Namen aufgeschrieben hatte, vermag ich nicht den weiteren Lebensweg zu recherchieren. Mir ist bekannt, dass die Rentnerin, der Informant und der Außenhändler nicht mehr am Leben sind. Nur einige Namen sind mir noch in Erinnerung.
Dass die Texte „echt“ sind, belegt die Sprache, die noch der DDR verhafteten Formulierungen, die verwendet wurde. Nicht selten lässt sich ein Wechsel der Weltanschauungen auch an Worten beobachten wie zum Beispiel bei dem Ich-Bericht mit dem Titel „Der Lehrmeister“. Redet der Lehrmeister über die DDR, benutzt er Passivformulierungen, benutzt er das „wir“ oder das unpersönliche „man“ als Pronomen; je näher er jedoch mit seinen Überlegungen in dem Text in der Neuzeit des Westens ankommt, geht er zum „ich“ über. Vermutlich bemerkte der Interviewpartner das seinerzeit gar nicht selbst.
Ich möchte an dieser Stelle ein weiteres Motiv zur Sprache bringen, das ich als meinen Antrieb vermute, Anfang 1990 dieses Projekt zu starten. Es zeichnete sich bereits die Tendenz ab, die DDR als simples Produkt von Repression zu erklären und verantwortlich dafür allein die Mitarbeiter der Staatssicherheit zu erklären. Ich hielt das schon damals nicht für gerechtfertigt und ärgerte mich über die Pauschalisierungen. Die Staatssicherheit war Schild und Schwert der Partei,23 der SED untergeordnet, keine autonom arbeitende Geheimdienstkrake, der keiner entging, wie es die nun aus dem Westen stammenden oder vom Westen übernommenen Medien darstellten und die suggerierten, dass für staatstragende Institutionen der DDR nur Leute mit „miesem Charakter“ hätten arbeiten können. Die Interviews hier zeigen, dass sich die Staatssicherheitsleute als Handelnde im Sinne der SED sahen. Die Weltsicht betreffend, in der DDR nannte man das „ideologisch“, gab es für mich nie einen Unterschied zwischen Mitgliedern der SED und Mitarbeitern der Staatssicherheit. Die Parteimitgliedschaft war vielmehr Voraussetzung der intensiven Mitarbeit in jenem Polizeiorgan. Verantwortlich für Fehlentwicklungen, Personenkult, diktatorisches Vorgehen waren dann sehr viele: Sozusagen alle SED-Mitglieder. Von dem Gesichtspunkt der Verantwortlichkeit aus betrachtet, gab es keinen Unterschied zwischen SED-Mitgliedern und Staatssicherheitsmitarbeitern. Und dennoch muss es einen gravierenden Unterschied in der Herangehensweise an die Gesellschaft gegeben haben, der mich schon zu DDR-Zeiten beschäftigte: Trotz einheitlicher politisch-ideologischer Grundlage müssen in der SED und in der Staatssicherheit unterschiedliche Menschenbilder vorgeherrscht haben.
Das Menschenbild war positiv in der SED und schloss durchaus an die christliche Tradition des Glaubens an eine „erlösende“ Zukunft an, die Möglichkeit der Erziehung zu einem selbstlosen Leben für andere. Dagegen stand das äußerst negative Bild des manipulierten/ manipulierbaren DDR-Bürgers bei der Staatssicherheit, das diese DDR-Behörde intern verfolgt haben muss, um eine Begründung für ihre Kontrollfunktion der Gesellschaft zu beschreiben. Ich habe mich immer gefragt, wie das eigentlich zusammenpassen konnte. Die offizielle DDR-Ideologie glaubte an den einzelnen Menschen, formte ihn durch Schulungen, was im historischen und bereits zuvor beschriebenen Kontext eben nicht nur als Mittel zur Durchsetzung der Diktatur verstanden werden kann. Der Grundinhalt aller politischen Schulung bestand aus Marxismus, Exegesen des innenpolitischen Grundkanons, schon um Fehlerdiskussionen des dramatischen Wirtschaftsverfalls im Land zu umgehen. Es gibt keinen Zweifel, dass der Marxismus die Vernunftfähigkeit des Menschen bei weitem überschätzte. Die Staatssicherheit dagegen hatte das Gefährdetsein des Einzelnen anzunehmen. Wie konnte man Sozialist/ Kommunist und gleichzeitig Tschekist24 sein (Mitarbeiter des Ministeriums der Staatssicherheit)? Die Antwort deutet sich in einigen dieser Texte an, die ich als „Ich-Berichte“ bezeichne. Es ist die Prägung in der Nazizeit, der Nachkriegszeit oder der Verlängerung in das kriegsnahe Alltagsleben des Kalten Krieges bis in die Mitte der achtziger Jahre hinein, die bei einigen kein positives Menschenbild mehr ermöglichte. Vielleicht lässt es sich so erklären, dass der einzelne Befragte gerne an das Gute im Menschen glauben wollte, es letztlich aber nicht vermochte aufgrund eigener oder angelesener Erfahrungen. Das eine ehrlich zu wollen, es aber nicht umsetzen zu können, ist menschlich. Oft spüren wir nicht, wie das soziale Umfeld uns allmählich verändert. Das ist auch heute noch so. Dass ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit, nicht nur da sie von der Wendezeit an geächtet und bestraft wurden (durch die Rentenregelung, Ausschluss aus dem Öffentlichen Dienst), anschließend zur Schwermut neigten, erscheint nicht ganz unlogisch. Sie mussten sich erneut in ihrer Grundannahme bestätigt sehen, dass der Mensch „noch nicht“ dazu fähig sei, den Sozialismus zu errichten. Dass die Staatssicherheit als Behörde sich ungeheuer ausdehnte und, obwohl institutionell der SED untergeordnet, zu einem Staat im Staat wurde25





























