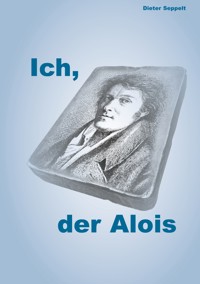
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Alois Senefelder, geboren am 6. November 1771 in Prag; gestorben am 26. Februar 1834 in München, war der Erfinder der Lithografie. So lesen wir z.B. bei Wikipedia. Und nicht nur dort. Gibt es doch reichlich Literatur, in der wir viel über diesen berühmten Erfinder erfahren können. Was aber ist authentischer, als wenn wir in seiner Autobiografie von ihm selber erfahren, sozusagen aus erster Hand, wie das damals war mit seiner Erfindung? Beim Inhalt dieses Buches handelt es sich um den Originaltext von Alois Senefelder, den er 1818 im Lehrbuch der Lithographie und des Steindruckes veröffentlicht hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Einleitung
„Alois Senefelder, geboren am 6. November 1771 in Prag; gestorben am 26. Februar 1834 in München, war der Erfinder der Lithografie.“
So lesen wir z.B. bei Wikipedia. Und nicht nur dort. Gibt es doch reichlich Literatur, in der wir viel über diesen be rühmten Er fin der erfahren können. Was aber ist authentischer, als wenn wir in seiner Autobiografie von ihm selber erfahren, sozusagen aus erster Hand, wie das damals war mit seiner Erfindung.
Oft hatte sich Alois Senefelder vorgenommen, niederzuschreiben, wie er zu dieser Kunst des Lithodruckes gekommen ist. Aber immer, wenn er vom Stand seiner Arbeit berichten wollte, kam schon wieder etwas Neues, eine neue Idee, eine neue Verfahrensweise hinzu, sodass er immer wieder von seinem Vorsatz abkam.
Beim Inhalt dieses Buches handelt es sich um den Ori gi naltext von Alois Senefelder, den er selbst verfasst und 1818 im „Lehr buch der Lithographie und des Steindruckes“ veröffentlicht hat. Sein Text ist für dieses Buch redigiert, ein wenig für unsere heutige Lesart abgeändert, mit einigen Erklärungen ergänzt und für die aktuelle Grammatik korrigiert worden.
Sollte uns dennoch Senefelders Schreibstil oder auch seine Wortwahl manch mal ein wenig sonderbar erscheinen und uns schmunzeln lassen, so sollten wir dabei bedenken, dass er seine Memo iren vor über 200 Jahren aufgeschrieben hat.
Inhalt
Erster Abschnitt, von 1796-1800
Veranlassung zu dem Wunsche A. Senefelders, eine eigene Druckerei zu besitzen. Mannigfaltige Versuche desselben. Erfindung des Steindrucks. Verbindung mit Gleißner. Glücklicher Anfang. Mangel einer guten Presse und daraus entstehender Nachteil. Druckerei bei Herrn Falter. Versuche des Herrn Schmidt. Bekanntschaft mit Herrn Schulrat Steiner und dadurch veranlasste Vervollkommnung des Steindrucks durch Erfindung der chemischen Druckart. Erhaltung des ausschlüssigen Privilegiums. Verbindung mit Herrn André aus Offenbach. Reise nach Offenbach und London. Reise der Frau Gleißner nach Wien, um daselbst ebenfalls das ausschlüssige Privilegium nachzusuchen.
Zweiter Abschnitt, von 1800-1806
Reise Senefelders nach Wien. Trennung von André und Verbindung mit Herrn v. Hartl. Er erhält das Privilegium exklusivum in den österreichischen Staaten, errichtet daselbst eine große lithographische Anstalt, die nachgehend dem Herrn Steiner überlassen wird. Seine Versuche in Hinsicht einer Kattundruckerei. Misslungene Unternehmungen. Abreise von Wien.
Dritter Abschnitt, von 1806-1817
Rückkunft nach München und Errichtung einer Druckerei. Verbindung mit Freiherr v. Aretin. Anwendung des Steindrucks auf das Kunstfach. Albrecht Dürers Gebetbuch. Handzeichnungen. Musterbuch. Errichtung vieler Druckereien. Auflösung der Aretinschen Anstalt. Anstellung bei der königl.Steuerkataster kommission. Wichtige Verbesserungen der Kunst. Reise nach Offenbach und später nach Wien.
Alois Senefelder, gezeichnet von Lorenzo Quaglio dem Jüngeren (1818)
Erster Abschnitt
Da mein Vater, Peter Senefelder aus Königshofen in Franken, Hofschauspieler in München war, so hatte ich seit meiner frühesten Jugend die Gelegenheit, viele Theaterstücke zu sehen und zu lesen, wodurch ich eine besondere Vorliebe für diesen Zweig der Dichtkunst und für das Theater überhaupt erhielt, sodass, wenn ich hätte meiner Neigung folgen dürfen, ich mich ebenfalls der Schauspielkunst gewidmet hätte.
Ich musste aber nach dem Willen meines Vaters, welcher durchaus keines seiner Kinder für das Theater erziehen wollte, die Rechte studieren, und konnte meine Lieblingsneigung höchstens nur dadurch befriedigen, dass ich ein paar Mal auf einigen Privattheatern mitspielte und in meinen Nebenstunden einige dramatische Dichtungen wagte.
In meinem 18. Jahre (1789) traf es sich einmal, dass bei einer Versammlung von mehreren jungen Freunden die Frage entstand, wie wir uns in der bevorstehenden Faschingszeit unterhalten wollten, und da kam es unter anderem auch zu dem Entschluss, eine kleine theatralische Vorstellung unter uns zu veranstalten. Obwohl wir indes gleich sehr viele Theaterstücke dazu in Vorschlag brachten, so fand sich doch darunter kein einziges, welches dem Wunsche aller entsprochen hätte, weil jeder eine gute und angemessene Rolle spielen wollte, und wir überdies die meisten Stücke aus Mangel an Frauenzimmern nicht besetzen konnten. Als wir beinahe schon die Hoffnung zu dieser Unterhaltung aufgeben mussten, tat der jetzige Hofschauspieler, Herr Kitzinger, mir den Vorschlag, ich möchte für uns ein eigenes Schauspiel schreiben. Und weil ich gerade vor kurzer Zeit eines angefangen hatte, in welchem zufälliger Weise für jeden meiner Freunde eine passende Rolle war, die ich nun nach eines jeden Wunsch noch mehr herausheben konnte, so wurde dieser Vorschlag auch wirklich ausgeführt.
Ich vollendete das kleine Stück „Die Mädchenkenner“ in kurzer Zeit. Es wurde einstudiert und konnte jeden Augenblick aufgeführt werden. Aber durch einen besonderen Zufall, wodurch wir das dazu bestimmte private Theater nicht erhielten, wurden wir veranlasst, um die Erlaubnis anzusuchen, es auf dem kurfürstlichen Hoftheater aufführen zu dürfen, welche wir auch durch den Beistand meines Vaters erhielten. Der übergroße Beifall, mit welchem sowohl der Verfasser als die Schauspieler überhäuft wurden, ermunterte mich, das kleine Stück drucken zu lassen. Und obwohl ich die Exemplare ziemlich freigiebig unter alle meine Bekannten ausgeteilt hatte, so erhielt ich doch für den Überrest von dem Buchhändler Lentner in München noch so viel, dass mir nach Abzug aller Unkosten 50 Gulden reiner Gewinn übrig blieb.
Ich hatte keine acht Tage an der Kleinigkeit gearbeitet, und, das Vergnügen ungerechnet, ein so großer Vorteil! Was Wunder, dass ich nun für meine Zukunft nicht bange war! Meine Liebe zum Theater nahm immer mehr überhand, und da mein Vater kurz darauf starb (1791), ich auch zur Vollendung meiner akademischen Studien in Ingolstadt keine weitere Unterstützung fand, so fasste ich umso leichter den Entschluss, mich der dramatischen Kunst als Dichter und Schauspieler zu widmen.
Ich konnte indes bei dem Hoftheater keine Aufnahme finden, dessen Mitarbeiter meiner Familie abgeneigt waren, weil meine Mutter mit ihrer zahlreichen Familie durch die Gnade des Kurfürsten eine größere Pension erhielt, als sie der Ordnung nach hätte erwarten können. Bei einigen herumziehenden Thea tern, z. B. in Regensburg, Nürnberg, Erlangen und Augsburg, wo ich hinlänglich Not und Ungemach erlitt, wurde mein Enthusiasmus in zwei Jahren völlig abgekühlt, und ich beschloss nun, da ich trotz aller meiner nicht unbedeutenden Kenntnisse für den Augenblick keine andere Aussicht fand, mich künftig als Schriftsteller zu nähren.
Ich hatte bereits mehrere dramatische Stücke verfertigt, von denen die meisten mit großem Beifall aufgeführt wurden. Ich wollte also vorderhand einige derselben drucken lassen, um durch den daraus zu ziehenden Gewinn meinen nötigen Unterhalt zu decken. Ich gab eines derselben bei dem Herrn Hübschmann in München in die Druckerei, und als der erste Bogen fertig war, so machte ich wieder dem Buchhändler Herrn Lentner den Antrag, mir einen Teil der Exemplare oder das Ganze abzunehmen. Dieser erklärte mir zwar, dass ich besser getan hätte, ihm das Manuskript zu überlassen. Da es aber schon angefangen sei, so sollte ich nur trachten, es vor Anfang der Leipziger Ostermesse zu vollenden, in welchem Falle er mir ein Honorar, welches mir nach Abzug aller Unkosten einen Betrag von 100 Gulden verschafft hätte, versprach. Ich bat also Herrn Hübschmann den Druck bis dahin vollenden zu lassen, und auf dessen Versicherung der Unmöglichkeit, ließ ich die letzten Bögen in einer anderen Druckerei verfertigen. Dem ungeachtet wurde das Schauspiel erst vierzehn Tage nach der Messe fertig, und mit knapper Not erhielt ich von Herrn Lentner gerade so viel, dass ich die Druckkosten bestreiten konnte.
Meine Hoffnung des Gewinns war also verloren. Ich hatte indes die ganze Manipulationsart des Druckes genau gesehen, weil ich manchen Tag in der Buchdruckerei zubrachte. Ich fand, dass die Buchdruckerkunst für mich gar nicht schwer zu erlernen sein würde, und ich konnte dem Wunsch nicht widerstehen, selbst eine kleine Druckerei zu besitzen. Da wirst du, dachte ich, deine eigenen Geistesprodukte selbst drucken und so mit Geistes- und körperlichen Arbeiten gehörig abwechseln können. Auch konnte ich mir einen anständigen Unterhalt verschaffen und dadurch ein freier, ganz unabhängiger Mensch werden.
Diese Idee nahm mich so sehr ein, dass ich allerlei Wege einschlug, sie zu realisieren. Hätte ich das dazu nötige Geld gehabt, so würde ich mir damals Lettern, eine Presse und Papier gekauft haben und die Steindruckerei wäre wahrscheinlich sobald noch nicht erfunden worden. Der Mangel an diesem aber brachte mich auf andere Projekte. Ich wollte mir anfänglich Lettern vertieft in Stahl stechen. Diese Matrizen wollte ich dann in Leisten von Birnbaumholz einschlagen, aber nicht nach der Länge des Holzes, sondern in die sogenannte Hirnseite. Da würden die Buchstaben sich erhoben, ungefähr so, wie die gegossenen Lettern eines Buchdruckersatzes, ausgenommen haben und wie ein Holzschnitt abzudrucken gewesen sein. Eine von Buchsbaumholz schön gepresste Tabakdose brachte mich auf diesen Gedanken und einige Versuche zeigten mir nicht nur die Möglichkeit der Ausführung, sondern sogar, dass ich leicht eine Maschine erdenken könnte, wodurch das Einschlagen noch geschwinder geschehe, als ein Buchdrucker seine Lettern setzen kann. Ich behalte mir vor, diese vielleicht fruchtbare Idee künftighin mit den inzwischen ausgedachten Verbesserungen, dem Publikum anderswo vorzulegen. Ich musste aber das ganze Unternehmen aus Mangel an Werkzeug und hinlänglicher Geschicklichkeit im Schriftstechen wieder aufgeben.
Nun kam ich auf den Einfall, ob ich nicht, wenn ich nur so viel Lettern hätte als nötig wären, eine einzige Kolumne oder Seite zu setzen, diesen Satz in eine weiche Erde eindrücken und diesen vertieften Eindruck auf ein mit fließendem Siegelwachs bedecktes Brettchen als erhoben, und wie eine in Holz geschnittene Zeile oder Tafel stereotypisch wiedergeben könnte. Der Versuch gelang in kurzem ganz vollkommen. Ich setzte nämlich aus Ton, feinem Sand, Mehl und Kohlenstaub eine Art Teig zusammen, welcher mit wenig Wasser vermischt, so fest als möglich zusammengeknetet, den Eindruck der Lettern sehr gut annahm und in Zeit einer Viertelstunde so trocken wurde, dass ich langsam gewärmtes Petschierwachs vermittels einer kleinen Presse vollkommen darin abdrucken konnte. Wenn ich nun diese in Siegelwachs erhoben hergestellten Zeilen mit Buchdruckerschwärze durch einen ledernen mit Rosshaar ausgestopften so genannten Buchdruckerballen einschwärzte, so wurde der Abdruck so rein, als er immer bei einem Satz aus gewöhnlichen Lettern werden konnte. Durch eine Beimischung von fein geriebenem Gips unter dem Siegelwachs wurde dieses letztere härter als die gewöhnliche aus Blei und Spießglanz bestehende Letternmasse, und der Ausführbarkeit meiner Erfindung, auf diese leichte Weise stereotypische Tafeln zu bilden, deren Namen ich übrigens damals noch nicht kannte, stand nichts im Wege als einige kleine Vorrichtungen und ein geringer Letternvorrat. Gleichwohl überstieg es doch meine damaligen Geldkräfte, auch nur diesen kleinen Hindernissen abzuhelfen, sodass ich auch diesen Gedanken als für mich zu kostspielig vorderhand wieder aufgab, umso mehr, da ich während dieser letzteren Proben auf einen neuen Plan verfiel, welcher mir am allerleichtesten ausführbar schien.
Ich wollte nämlich gewöhnliche Buchdruckerschrift ganz genau und zwar verkehrt nachschreiben lernen. Wenn ich einmal hierin die gehörige Geschicklichkeit hätte, dachte ich dieselbe auf eine nach gewöhnlicher Art mit Ätzgrund überzogene Kupferplatte mit einer elastischen Stahlfeder zu schreiben, sodann mit Scheidewasser einzuätzen und beim Kupferdrucker abdrucken zu lassen. Ich hatte auch bereits in einigen Tagen schon eine ziemliche Fertigkeit im Verkehrtschreiben, sodass ich mich getrost über das Radieren in Kupfer hermachte. Hier fand ich freilich schon größere Schwierigkeiten. Das Schreiben auf Kupfer in den Ätzgrund war bei weitem nicht so leicht als auf Papier. Dann forderte auch das Zubereiten der Kupferplatte, das Ätzen und so weiter einige Übung. Doch alles dieses hoffte ich in kurzer Zeit zu überwinden. Das Einzige, was mir jetzt noch den hauptsächlichsten Anstand verursachte, war, dass ich die zufälligerweise beim Schreiben gemachten Fehler nicht gut zu verbessern wusste. Die Vorteile der Kupferstecher, besonders der sogenannte Deckfirnis, waren mir ganz unbekannt. Es blieb mir also kein anderes Mittel, als die fehlerhaften Stellen mit einem in geschmolzenes Wachs getauchten Pinsel zu überstreichen, wodurch sie eine Wachsdecke bekamen, die aber gewöhnlich so dick wurde, dass ich nicht mehr gehörig hindurcharbeiten konnte, und die Verbesserung der Fehler auf eine nochmalige Wiederholung der ganzen Arbeit oder für den Grabstichel, welchen ich aber noch nicht führen konnte, aufsparen musste. Da jedoch meine bisher gemachten Proben zu meiner vollkommenen Befriedigung ausfielen, so suchte ich desto standhafter auch dieses Hindernis aus dem Wege zu räumen. Ich hatte von meinen Studentenjahren her mehrere chemische Kenntnisse erlangt, und wusste, dass sich die meisten Harzgattungen, welche dem Scheidewasser widerstehen, so wie die Fettigkeiten, Wachs Unschlitt und dergleichen teils in ätherischem Öle oder Weingeist, teils auch in Alkalien auflösen und verdünnen lassen. Es kam hier darauf an, eine dünne Masse zu erhalten, welche sich im kalten Zustande auf die vorher mit Ätzgrund überzogene Kupferplatte sehr fein aufstreichen ließ, schnell trocknete, nach dem Trocknen die gehörige Festigkeit erhielt ohne spröde zu sein und vor allem beim Überstreichen der Fehler den Ätzgrund nicht angriff. Einige Versuche mit Weingeist und verschiedenen Harzgattungen gaben mir keine Befriedigung. Der einzige Versuch, den ich mit Terpentinöl und Wachs machte, misslang auch, weil ich vermutlich die Mischung mehr als nötig verdünnte, wodurch sie auf der Platte zu sehr auseinanderfloss und den darauf befindlichen Ätzgrund mit auflöste, welches zugleich mehrere gut geratene Stellen verdarb. Auch trocknete diese Mischung sehr langsam bis auf den Grad, welcher nötig war, um wieder recht rein hindurch arbeiten zu können. Zum Glück machte ich mit dieser Materie keine weiteren Versuche, sonst würde ich wahrscheinlich die Steindruckerei nicht erfunden haben, indem ich gegenwärtig gar wohl aus Terpentinöl, Wachs und Mastix (getrocknetes Harz) einen zu meinem damaligen Zwecke vollkommen brauchbaren Deckfirnis zuzubereiten wusste.
Ich ging also zu einem Versuch mit Wachs und Seife über, welcher mir auch über alle Erwartungen gelang. Eine Mischung aus drei Teilen Wachs mit einem Teil gewöhnlicher Unschlittseife auf dem Feuer geschmolzen und etwas feinem Kienruß versetzt und dann in Regenwasser aufgelöst, gab mir eine Art schwarze Tinte, womit ich die gemachten Fehler am allerleichtesten verbessern konnte.
Nun war zu meinem Projekt, meine Schriften künftig hin in Kupfer zu ätzen, nur noch das Einzige erforderlich, dass ich eine bessere Fertigkeit im Schreiben erlangte, um meine Handschrift den Druckklettern so viel als möglich ähnlich zu machen. Hierzu war aber fleißige Übung notwendig. Da fand sich nun ein neuer Stein des Anstoßes. Wenn ich mein einziges Kupferblättchen beschrieben, geätzt und bei einem guten Freunde, welcher eine Kupferdruckerpresse besaß, abgedruckt hatte, so musste ich wieder einige Stunden mühsam mit Abschleifen und Polieren der Platte zubringen, wodurch die Platte selbst sehr an Dicke abnahm. Dieses brachte mich auf die Idee, zu meinem Exerzitium, einstweilen eine Zinnplatte zu gebrauchen, welche sich viel leichter abschaben und polieren ließ. Ein alter Zinnteller meiner Mutter wurde sogleich in Requisition gesetzt. Doch die Versuche fielen beim Ätzen sehr unvollkommen aus, weil das Zinn wahrscheinlich mit Blei vermischt war, und ich überdies bloßes Scheidewasser anstatt Königswasser angewendet hatte.
Ich setzte die Versuche mit Zinn nicht weiter fort, weil ich eben ein schönes Stückchen sogenannter Kellheimer Platten zum Zwecke des Farbreibens erhandelt hatte und mir einfiel, dass ich diese Steinplatte, wenn ich sie mit meiner Wachstinte bestreiche, wohl zu Übungen ebenso gut, als Kupfer oder Zinnplatten gebrauchen könnte, wozu mich die wenige Mühe, welche das Abschleifen der Steinplatten kosten würde, noch besonders ermunterte. Alle deshalb gemach ten Proben gelangen vollkommen und ungeachtet ich bei meinen anfänglichen Versuchen an nichts weniger dachte, als dass man den Stein zum Abdrucken selbst benutzen könnte, (weil ich bis dahin nur sehr dünne Steinplatten von diesem Kellheimer Kalkstein gesehen hatte, welche mir die zum Abdrucken nötige Gewalt, ohne zu zerbrechen, nicht auszuhalten schienen) so glaubte ich doch bald auch hierzu die Möglichkeit gefunden zu haben. Auf dem Stein ließen sich durch ein etwas stärkeres Andrücken der elastischen Stahlfeder die breiten Striche der Buchstaben mit einem Zug viel reiner darstellen, als auf dem Kupfer, wo bei den mindestens Schiefhalten der Feder auf einer oder der anderen Seite des Strichs immer ein wenig von dem Ätzgrunde, oft für das Auge nicht sichtbar, stehen blieb, wodurch das Scheidewasser nicht gehörig durch dringen konnte und die Striche also ihre Schärfe verloren, welche sie hingegen auf der Steinplatte weit vollkommener erhielten. Ich beobachtete zugleich, dass ich weit weniger und sehr mit Wasser geschwächtes Scheidewasser nötig hatte. Einen Steinmetz, welchen ich der Preise wegen fragte, versicherte mich, dass er mir diese Art Kalkschiefer-Steinplatten von einem bis acht Zoll Dicke verschaffen könnte. Ich war also der Besorgnis des Zerspringens überhoben und das Einzige, was ich noch erfinden musste, um den Stein ganz wie Kupfer zu gebrauchen, war entweder das Mittel, dem Stein eine größere Politur zu geben, oder eine Farbe, welche sich reiner von dem Stein wegwischen ließ, als die gewöhnliche Kupferdruckerfarbe. Denn der Stein nimmt durchaus nicht diejenige Politur an, welche die Anwendung der gewöhnlichen Buchdruckerschwärze erfordert. (Und dies mag auch die Ursache sein, warum nicht längst vor mir von Kupferstechern der Stein zum Ätzen als Surrogat des Kupfers angewendet wurde, da ich mit Wahrscheinlichkeit vermute, dass längst schon ähnliche Versuche gemacht, aber alsbald wieder verlassen worden sind.)
Beides kostete mich eine Menge Versuche. Alle möglichen Schleif- und Poliermittel wurden angewandt, ohne meinen Zweck vollkommen zu erreichen. In Absicht auf das Polieren des Steines leistete noch die besten Dienste, wenn ich den rein geschliffenen Stein mit einer Mischung aus einem Teil konzentriertem Vitriolöl und vier oder fünf Teilen Wasser übergoss. Diese Mischung, welche sehr scharf ist, hat die Eigenschaft, auf dem Kalkstein schnell aufzubrausen, aber gleich wieder nachzulassen, sodass man versucht sein sollte, zu glauben, das Vitriolöl habe sich bereits gesättigt und seine Kraft verloren, welches aber nicht ist, weil das nämliche Ätzwasser auf eine unberührte Stelle des Steins gebracht, sogleich wieder aufbraust. Die Ursache davon ist, dass sich sogleich auf der Oberfläche des Steins eine feste Haut von Gips bildet, welche diesem Ätzwasser ferner undurchdringlich ist. Gießt man nun das Ätzwasser weg und trocknet den Stein, so erhält er durch leichtes Abwischen mit einem Lappen eine glänzende Politur. Leider ist sie aber so dünn und so wenig haltbar, dass man kaum 50 reine Abdrucke machen kann, ohne das vorige Verfahren, jedoch mit einigem Nachteil der Zeichnung, wieder zu erneuern. Wenn man indes auf die jetzige chemische Art, das heißt, nass abdrucken will, und die Steinplatte schon vor dem Zeichnen und nachherigen Ätzen mit Scheidewasser durch Vitriolöl poliert hat, so kann man ohne weiteres mehrere 1000 Abdrucke machen, welches in der Folge am rechten Orte noch ausführlicher beschrieben wird.
Was die zweite Schwierigkeit, die Auffindung einer von dem Stein leicht weg zu wischenden Farbe betrifft, so zeigten mir alle deshalb gemachten Versuche, dass auf einem nicht mit Vitriolöl präpariertem Steine keine besser war, als leichter Ölfirnis mit seiner Frankfurter-Schwärze und etwas Weinstein fein gerieben, und mit einer schwachen Auflösung von Pottasche und Kochsalz, in Brunnenwasser von dem Stein abgewischt. Nur geschah es oft, dass die gezeichneten Stellen bei einer etwas unvorsichtigen Behandlung zugleich mit herausgewischt wurden und nachher oft nur nach langer Bemühung wieder Farbe annah men. Die Erinnerung an diese Erscheinung, die ich mir damals nicht ganz vollkommen erklären konnte, leitete mich einige Jahre nachher auf die Erfindung der jetzigen chemischen Steindruckerei.
Ich habe mich bei der Erzählung dieser verschiedenen Proben deswegen so lange aufgehalten, um es dem Leser deutlich zu machen, dass ich nicht durch Zufall, sondern nur auf diesem durch emsiges Nachdenken vorgezeichneten Weg die Steindruckerei erfand. Die Tinte kannte ich also schon, ehe ich an ihre Anwendung auf Stein dachte. Den Stein nahm ich zuerst bloß, um mich im akkuraten Schreiben zu üben. Die Leichtigkeit des Schreibens auf den Stein, die viel größer ist, als auf Metall und Ätzgrund, lockte mich dann an, den Stein selbst zum Abdruck brauchbar zu machen. Dazu musste ich die Möglichkeit erfinden, von dem im Vergleich mit Kupferplatten nur schwach polierten Stein die Schwärze vollkommen rein an allen nicht vertieften Stellen abwischen zu können, so wie es der Kupferdrucker mit seiner Kupferplatte vermag.
Damals wurden meine ferneren Versuche in dieser vertieften Art des Stein drucks durch eine neue zufällige Entdeckung gänzlich unterbrochen. Da ich bis dahin eigentlich noch wenig Neues erfunden, sondern bloß die Theorie des Kupferdrucks auf Steinplatten angewandt hatte, so wurde im Gegenteil durch die gleich zu beschreibende neue Entdeckung auch eine ganz neue Art des Drucks begründet, welcher im Grunde alle folgenden Manieren ihr Entstehen zu danken hatten. Wäre der Stein bloß als Surrogat des Kupfers zu benutzen gewesen, so würde ich trotz einiger vorher bemerkten Vorteile dennoch bei irgendeinem Anwuchs meiner Geldkräfte zu den Kupferplatten wieder zurück gekehrt sein und zwar aus folgenden Gründen:
Erstens, wegen der nötigen Dicke und Schwere der Steinplatten. Zweitens, weil das Drucken langsamer vonstatten ging, als beim Kupfer. Drittens, weil ich es bei dem nötigen starken Abwischen wahrscheinlich mit der Feinheit nie besonders weit gebracht hätte. Letztens und hauptsächlich aber, weil mir der nachherige Sporn, nämlich die Neuheit der Erfindung, gefehlt haben würde, da ich mich sogar noch erinnerte, als Kind von fünf oder sechs Jahren in Frankfurt oder Mainz eine Notendruckerei gesehen zu haben, wo die Noten in schwarze Schiefersteine gestochen waren. Ich hatte oft mit den zerbrochenen Steinen, wovon vor unserer Haustür ein großer Haufen lag, gespielt und ungeachtet ich in der Folge, als ich erwachsen war, nie mehr von dieser Druckerei etwas erfahren konnte, so war ich doch nur zu gut überzeugt, dass die Erinnerung daran kein bloßer Traum war. Es musste, da der Notenstich auf Zinn damals erst erfunden und als Geheimnis behandelt wurde, jemand auch solche Versuche auf Tonschiefer gemacht haben, welcher aber wahrscheinlich wegen der großen Zerbrechlichkeit dieser Platten und wegen der Mühsamkeit des Gravie rens, (da der Tonschiefer eine Art Schleifstein ist und alle Instrumente schnell abnutzt) durch den leichteren Zinnstich ersetzt hatte. Genug, ich war nicht der erste Erfinder weder des Steinstichs noch des Abdruckens von Steinen. Selbst geätzt wurde auf Steinplatten schon Jahrhunderte vor mir, und nur erst als ich die besagte neue Erfindung machte, von welcher ich gleich ausführlich sprechen werde, wobei ich von der versuchten vertieften Manier zu der erhobenen überging und dazu meine neue Tinte anwandte, konnte ich mich für den Erfinder einer neuen Kunst halten. Welches mich sogleich bestimmte, alle übrige Versuche aufzugeben, und bloß auf diesem Wege vorzuarbeiten.
Indem ich nun von dieser Entdeckung berichte, welche darin bestand, auf erhabene Art zu ätzen und nach Weise der Holzschnitte Abdrucke zu machen, welches der eigentliche Anfang meiner lithografischen Laufbahn wurde, so hoffe ich, dass es dem Leser nicht ganz uninteressant sein würde, selbst den geringfügigsten Umstand zu erfahren, welchem die jetzige Lithografie ihr Dasein zu verdanken hat.
Ich hatte eben eine Steinplatte sauber abgeschliffen, um sie nachher wieder mit Ätzgrund zu überziehen und darauf meine Übungen im Verkehrtschreiben fortzusetzen, als meine Mutter von mir einen Wäschezettel geschrieben haben wollte. Die Wäscherin wartete schon auf die Wäsche. Es fand sich aber nicht gleich ein Stückchen Papier bei der Hand. Mein eigener Vorrat war durch Probedrucke zufällig eben zu Ende gegangen. Auch die gewöhnliche Schreib tinte war eingetrocknet, und da niemand, um frische Schreibmaterialien herbeizuschaffen, zu Hause war, so besann ich mich nicht lange, und schrieb den Waschzettel einstweilen mit meiner vorrätigen aus Wachs, Seife, und Kienruß bestehenden Steintinte auf die abgeschliffene Steinplatte hin, um ihn, wenn frisches Papier geholt sein würde, wieder abzuschreiben.
Als ich nachher diese Schrift vom Stein wieder abwischen wollte, kam mir auf einmal der Gedanke, was denn aus so einer mit dieser Wachstinte auf Stein geschrieben Schrift werden würde, wenn ich die Platte mit Scheidewasser ätzte, und ob sie sich nicht vielleicht nach Art der Buchdrucklettern oder Holzschnitte einschwärzen und abdrucken ließe. Meine bisherige Erfahrung im Ätzen, nach welcher ich wusste, dass das Scheidewasser ebenso gut nach der Breite als in die Tiefe wirkte, ließ mich zwar gleich vermuten, dass ich die Buchstaben durch das Ätzen nicht sehr beträchtlich würde erhöhen können. Weil aber die Schrift ziemlich grob geschrieben war, also vom Scheidewasser nicht so geschwind unterfressen werden konnte, so machte ich mich frisch an einen Versuch. Eine Mischung von einem Teil Scheidewasser und zehn Teilen Wasser ließ ich fünf Minuten lang zwei Zoll hoch auf der beschriebenen Steinplatte stehen. Die Platte war nach Art der Kupferstecher mit einer Einfassung von Wachs versehen, damit das Wasser nicht ablaufen konnte. Nun untersuchte ich die Wirkung des Scheidewassers, und fand die Schrift bis auf ein Zehntel einer Linie oder ungefähr auf die Dicke eines Kartenblattes erhöht.
Einige feine und wahrscheinlich nicht saftig genug geschriebene Striche hatten teilweise Schaden gelitten, die übrigen Striche aber hatten an ihrer Breite nur unmerklich verloren, ja ganz und gar nicht im Verhältnis der Tiefe, sodass ich gegründete Hoffnung bekam, eine gut geschriebene Schrift, besonders Druckbuchstaben, an welchen ohnehin wenig feine Striche sind, noch beträchtlich mehr in die Höhe ätzen zu können.





























