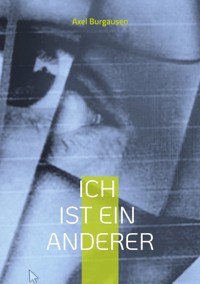
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fremdem zu begegnen, kann Neugier und Angst erzeugen, und im Blick des Anderen begegnet man oft dem Fremden in sich selber. Axel Burghausen betrachtet die Thematik von unterschiedlichen Seiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Immer schon fremd
Den Fremden auf der Spur
1.1 Fremd nur in der Fremde
1.2 Fremde sind wir uns selbst
1.3 Eigen und fremd
Kulturpolitik und -enteignung
2.1 Der Blick nach außen
2.2 Im Neuen Altes suchen – Christoph Kolumbus
2.3 Fortschritt gegen ewige Wiederkehr
2.4 Menschen unterschiedlicher Würde?
2.5 Verlorenes Paradies – ein Exkurs
2.6 Modelle der Begegnung mit dem Fremden
Blick zurück in (Zorn und) Sehnsucht
3.1 Wandernde Wurzeln
3.2 Nächtlicher Blick zurück
3.3 Letztlich unbehaust
3.4 Flucht ins Wort
Sich selber fremd – der Welt fremd
4.1 Kalte Wüste Welt
4.2 Missglückte Heimkehr
4.3 Im Feuerkreis gefangen
Alte Traditionen in neuer Umgebung
5.1 Deutsche Einwanderer in Amerika
5.2 Die „Ruhrpolen“
5.3 „Gäste“ werden Bürger
5.4 Wer integriert wen?
5.5 Angekommen – und doch
Migration - Vorurteile, Perspektiven, Erfahrungen
6.1 „Deutscher Blick“
6.2 Doch ein Einwanderungsland
6.3 Geteilte Identität
6.4 Dennoch oder gerade deswegen (Toleranz)
Fremdheitsethische Skizzen
7.1 Heimat und Grenzen
7.2 Selber fremd in Ägypten
7.3 Heiliges Gastrecht
7.4 Vor dem Antlitz des Anderen
7.5 Eine Migrationsethik?
Text- und Bildbelege
Immer schon fremd
Fremdheit ist eine Grunderfahrung des Menschen. Eigentlich ist uns zunächst alles fremd, vielleicht abgesehen von unserer Mutter, die wir bereits vor unserer Geburt spüren konnten. Die Aufgabe, uns für Fremdes zu öffnen und die Welt für uns zu erobern, beschäftigt uns ein Leben lang und prägt unsere Persönlichkeit. Die Entscheidung, Fremdes in unser Leben zu integrieren, aber uns auch von Fremdem zu distanzieren, treibt unsere Entwicklung an, hilft uns, unser Leben zu verstehen, birgt aber auch Gefahren in sich. Manches, was fremd ist, fasziniert und zieht uns an, anderes erzeugt Angst, Vorsicht, möglicherweise Aggression. Es gilt, diese Gefühle ernst zu nehmen, aber auch bereit zu sein, Fremdes in seiner Existenz zu akzeptieren, auch wenn man sich selber davon distanzieren möchte. Der Mensch als freies Lebewesen wird immer auch von außen beeinflusst, darf sich davon aber nicht ungeprüft bestimmen lassen. Je mehr er daher in der Lage ist, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten, umso eher wird er bereit sein, dies auch anderen Menschen zuzuerkennen.
Da sich das innere Bild vom eigenen Leben mit jeder Erfahrung wandeln kann und Menschen immer auf dem Wege sind, wird auch die Erfahrung, sich selber fremd zu sein, möglich. Je vielfältiger sich die moderne Welt präsentiert, umso häufiger wird diese Fremdheit erfahren. Mir selber fremd zu sein, macht mich zum Fremden neben anderen Fremden, wie Julia Kristeva in Weiterzeichnung psychoanalytischer Theorien schreibt. Das Fremde in mir in andere Menschen zu projizieren, birgt zugleich die Gefahr, den „Fremden“ als Feind zu sehen und mit Gewalt zu reagieren.
Gerade das Gefühl, in mir Fremdes vorzufinden und nicht zu wissen, wie ich damit umgehen soll, hat mich schon zu meiner Studentenzeit auf das Thema gestoßen. Es hat zugleich äußere Fremdheitserfahrungen beleuchtet: Ob ich bei mir trotz allen guten Willens Partikel rassistischer Einstellung feststelle, ob ich in der Begegnung mit Behinderten und Kranken innere Grenzen überwinden muss, ob ich in interkulturelle Fettnäpfchen trete und feststellen muss, dass meine Gewohnheiten und Empfindungen nicht überall verstanden werden, ich lerne, mich selber in Frage zu stellen und Grenzen zu verschieben.
Das Thema Fremdheit spielte immer wieder in meinem Unterricht auf der Gymnasialen Oberstufe (Deutsch, Geschichte, Religion) eine wichtige Rolle. Die dort verwendeten Texte und Bilder bilden den Grundbestand des vorliegenden Buches, werden aber noch weiter ergänzt, auch durch Aspekte weiterer Fächer.
Das vorliegende Buch folgt dabei keinem durchgehenden Faden, der in einer zusammenfassenden Aussage endet, sondern beleuchtet wie in einem Mosaik verschiedene Aspekte des Themas, referiert auch unterschiedliche Ansatzpunkte. Es möchte so zum Nachdenken über die Thematik bzw. zu ihrer Diskussion anregen. Dennoch wird sich am Ende ein Gesamtbild zusammenfügen lassen.
Wie in meinen Erläuterungen zum Religionsunterricht kommentiere ich jeweils einzelne Texte oder Bilder. Zwar versteht sich das Buch nicht als Textsammlung, doch werde ich – der Verständlichkeit halber – kürzere literarische Texte und besprochene Kunstwerke abdrucken. Ansonsten verweise ich auf meine Kommentierung, die den Inhalt von Texten zusammenfasst. Von mir beschriebene Karikaturen drucke ich nicht mit ab und verweise hier auf das Internet.
1 Den Fremden auf der Spur
1.1 Fremd nur in der Fremde
Grundlage: Karl Valentin: Die Fremden
Pinchas Lapide: „Der Fremde in deinen Toren“
Hans Magnus Enzensberger: Die große Wanderung
Gabriel Laub: Fremde
Elie Wiesel: Die Angst vor dem Fremden
Der Münchener Komiker Karl Valentin (1882-1948) ist berühmt für seine Sketche, in denen er durch Wortwitz im Blödsinn eine tiefere Ebene aufdeckt. So führt im Dialog „Die Fremden“ (1940) ein Lehrer seinen Schüler von den Filzpantoffeln über das Hemd zum Reimwort „fremd“. Dieses Wort wird gleichsam in einem kurzschrittigen Unterrichtsgespräch durchgekaut. Valentins „Unsinn“ vermittelt gleichwohl einige grundlegende Erkenntnisse:
Es gibt keine Fremden von Natur aus. „Fremd“ ist ein Beziehungsbegriff. Der Fremde wird immer im Hinblick auf einen anderen oder angesichts einer ungewohnten Umgebung als fremd empfunden. („Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“) Zu ihm gehört also untrennbar das nicht Fremde, das er aber wiederum als fremd empfinden kann.
Daher kann jeder zum Fremden werden, wenn er aus seiner gewohnten Umgebung heraustritt. Das könne durchaus, so betont Valentin, auch innerhalb der eigenen Heimatstadt geschehen.
Aber auch in der „Fremde“ ist die Fremdheit kein unveränderbares Schicksal. Wer sich seine neue Umgebung lange genug vertraut gemacht hat, fühlt sich irgendwann nicht mehr fremd bzw. wird auch nicht mehr so wahrgenommen. Das gilt auch für die Beziehung von Menschen: Der Fremde kann zum Bekannten und Vertrauten werden.
Hier setzt der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide (1922-1997) an. Für ihn gibt es nur Menschen, „die sich noch nicht richtig begegnet sind“. Jeder Fremde sei also ein potentieller Freund. Lapide verbindet diesen Gedanken mit dem moralischen Appell, sich dem Mitmenschen zu öffnen und ihm so seine Fremdheit zu nehmen. Man solle das gottgewollte Anderssein seiner Mitmenschen akzeptieren und als bereichernd erleben. Lapide sieht hier eine Verpflichtung gerade auch gegenüber Migranten.
Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger (geb. 1929) vergleicht in seinem Buch „Die große Wanderung“ aus dem Jahre 1992 die Situation von Einheimischen und Migranten mit den Passagieren eines Zugabteils. Diejenigen, die schon eine Weile unterwegs sind und sich im Abteil „breit“ gemacht haben, solidarisieren sich emotional gegenüber den neu Zugestiegenen, den „Eindringlingen“. Dass dies nicht zu aggressiven Hand-lungen führe, hänge mit den ungeschriebenen Verhaltensnormen der Reisenden und den Regeln der Bahn zusammen. Sobald aber erneut Passagiere zustiegen, verwandelten sich die ursprünglich Fremden in „Einheimische“, die sich jetzt wieder innerlich gegen die Neuen wehren. Sie verhalten sich jetzt so, wie man sich zuvor ihnen gegenüber verhalten hat. Das erinnert mich an die Kritik mancher türkischer Mitbürger an dem Verhalten rumänischer und bulgarischer Migranten.
Ein Extremfall der von Enzensberger dargestellten Situation stellt ein gefülltes Rettungsboot dar. Die Insassen fürchten sich, weitere Schiffbrüchige aufzunehmen, weil das Boot kentern könnte. Hier geht es um Leben und Tod. Diejenigen, die innen sind, verteidigen ihr Privileg gegenüber den Äußeren und geben sie dem Untergang preis. Die häufig leichtfertig gebrauchte Formel „Das Boot ist voll“ verdeutlicht die instinktive Angst, selber abgehängt zu werden, wenn man sich als zu großzügig erwiesen hat.
Wer eine unbekannte Umgebung als Gast oder Tourist besucht, ist zwar fremd, wird von den Einheimischen aber keineswegs als Problem angesehen. „Die Fremden“ sind diejenigen, die kommen und bleiben. Gerade die neu entstandene Nähe macht die Fremdheit deutlich und evtl. zum Problem.
Fremde
Fremde sind Leute,
die später gekommen sind als wir:
in unser Haus, in unseren Betrieb,
in unsere Straße, unser Land.
Die Fremden sind frech:
Die einen wollen so leben wie wir,
die anderen wollen nicht so leben wie wir.
Beides ist natürlich widerlich.
Alle erheben dabei Ansprüche
auf Arbeit,
auf Wohnungen und so weiter,
als wären sie normale Einheimische.
Manche wollen sogar unsere Töchter heiraten,
und manche wollen sie sogar
nicht heiraten,
was noch schlimmer ist.
Fremdsein ist ein Verbrechen,
das man nicht wieder gutmachen kann.
Gabriel Laub (1928-1998), mehrsprachig schreibender Schriftsteller mit polnisch-jüdischen Wurzeln, ist gerade für seine geistreich pointierten Aphorismen bekannt. Sein Gedicht „Fremde“ zeigt ebenfalls diese Fähigkeit. Fremde seien – ähnlich wie in Enzensbergers Zug-Beispiel – Menschen, die später eingetroffen sind (V. 1f.). Ihr Anspruch, den Einheimischen nahe zu bleiben und so behandelt zu werden (Arbeit, Wohnung etc.) wie sie (V. 9-12), wird ihnen als „Verbrechen“ (V. 17) bewertet. Egal, wie sie sich verhalten, werde es zu ihrem Schaden ausgelegt. Wenn sie sich anpassen wollen, sieht man dieses Verhalten als Anbiederung, vielleicht auch als bloße Maskierung. Wenn sie sich separieren und ihren eigenen Traditionen folgen, erkennt man erst recht ihren bösen Willen (so in V. 5-8 und 1316). Die ersten vier Strophen des Gedichts mit ihren vier Versen kulminieren schließlich in der zweizeiligen fünften Strophe: „Fremd sein ist ein Verbrechen,/ das man nicht wieder gutmachen kann.“ (V. 17f.) Wer also später kommt als die Einheimischen, hat keine Chance und ist selber schuld daran. Er hätte ja wegbleiben können. Die ironische Aussagespitze des Gedichts entsteht dadurch, dass hier radikal die Sichtweise derjenigen eingenommen wird, die immer schon „im Zug“ waren. Wer dazukommt, bleibt im Grunde draußen, sein Verhalten wird als „widerlich“ (V. 8) angesehen, er passt nicht hinein.
Der ursprünglich rumänische, später US-amerikanische Schriftsteller und Universitätslehrer Elie Wiesel (1928-2016) überlebte als Jude Auschwitz und Buchenwald. Er setzte sich engagiert für Toleranz und Gerechtigkeit ein und erhielt 1986 den Friedensnobelpreis. In seinem gleichnamigen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1991 analysiert er „Die Angst vor dem Fremden“.
Der Fremde verkörpere das Unheimliche, Ausgegrenzte. Er sei sozusagen die Negation meiner eigenen Existenz, stelle mich und meine bisher selbstverständliche Rolle in der Gesellschaft in Frage. Zudem erwecke sein Verhalten Misstrauen. Man wisse schließlich nie, was er in Wahrheit bezwecke.
Vor allem mache mir der Fremde meine eigene Fremdheit bewusst. Jeder trage in sich Emotionen und Antriebe, die er selbst nicht enträtseln könne. Zudem könne jede soziale Position ins Wanken geraten. Jeder könnte entwurzelt werden, seine Heimat verlieren, wie Wiesel es ja selbst erlebt habe. In Wahrheit gleiche mir der Fremde, und diese Ähnlichkeit erschrecke mich. Im Fremden spiegele sich meine eigene Verwundbarkeit.
Fremd werde daher der, der als Fremder behandelt wird. Es seien immer Menschen, die einen anderen als nicht zugehörig ansehen und daher aus ihrer Gemeinschaft ausstoßen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass jeder „für das Fremdsein oder Nichtfremdsein des anderen“ verantwortlich sei. Wer den „Fremden“ seiner Rechte beraube, handele so gegen seine eigene Menschlichkeit. Kein Leben sei nämlich bedeutender als ein anderes.
Neben der Abwehr des Fremden steht auch seine Faszination. Das Unbekannte, Exotische wird häufig als unverfälscht und rein angesehen. Seine Anziehung dient der Kritik an der eigenen (verdorbenen oder überzüchteten) Zivilisation. Diese Bewertung des Fremden ist ebenso wie ihre negative Kehrseite eine Projektion des Eigenen. Im Grunde geht es immer um eine Auseinandersetzung mit einem selbst.
1.2 Fremde sind wir uns selbst
Grundlage: Julia Kristeva: Fremde sind wir uns selbst
Vanessa Schwarkow: „Ich“
Martin Korte: Das Fremde – Angst und Faszination
Wolfgang Müller-Funk: Theorien des Fremden
Die bulgarisch-französische Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva (geb. 1941) stellt in ihrem Buch „Fremde sind wir uns selbst“ (1988) die Problematik des Fremden zunächst in einen historischen Zusammenhang. Für den frühen Menschen sei das Fremde, Unbekannte immer zugleich eine Bedrohung gewesen. In der Fremde zu leben, bedeutete Elend. Die nahe Stehenden, also z.B. die eigene Sippe, galten als Freunde. Es war lebenswichtig, mit ihnen kooperieren zu können. Wer von außen kam, war zunächst der Feind. Sich von ihm abzugrenzen, ihn evtl. zu bekämpfen, konnte genauso lebenswichtig sein. Im Nationalismus lebt dieses Freund-Feind-Denken bis in die Gegenwart weiter.
Die europäische Aufklärung, die die Emanzipation des Individuums gefördert hat, habe die Gruppe der evtl. Feinde sogar noch vergrößert. Nun konnten auch Eltern oder Geschwister zu „Feinden“ werden, wenn sie für die Selbstverwirklichung des Einzelnen als störend empfunden wurden. Was für Nahestehende gilt, gelte aber erst recht für Ausländer.
Die Psychoanalytikerin Kristeva verweist auf die seelischen Abgründe des einzelnen Menschen. Jeder habe sein „dunkles Kellergeschoss“, das Persönlichkeitsanteile enthalte, die dem Menschen unerklärlich, ja unheimlich sind. Sich diese Anteile einzugestehen, nehmen viele als Bedrohung wahr. Deshalb übertragen sie sie auf andere Menschen, die Fremden. Dabei seien wir es selber, die uns fremd seien. Wenn der Fremde in mir sei, dann seien wir alle fremd. Weil aber alle fremd seien, seien wir darin alle gleich, also gebe es keine Fremdheit. Kristeva plädiert also dafür, die Distanz zu überwinden, die den Einzelnen den „Fremden“ gegenüberstellt, und die Fähigkeit zu entwickeln, „sich als anderer zu sich selbst zu denken und zu verhalten“.
„Ich“
Eigentlich bin ich zwei. Ich und Ich.
Existenz. Realität.
Eigentlich bin ich anders und doch genauso.
Ihr seht die eine und ich fühle die andere.
Ihr wisst, was ihr seht. Ich weiß alles.
Existenz. Realität.
Ein Äußeres und ein Inneres. Zwei Welten und doch eine. Leben und nicht leben.
Existenz. Realität.
Gefühle, Gedanken, Wünsche und Pläne – Seelenleben, Chaos, Krieg.
Existenz. Realität.
Mehr Schein als Sein. Maschine. Traumwelt. Welt.
Existenz. Realität.
Ich.
Die Schülerin Vanessa Schwarkow (geb. 1997) erkennt in ihrem Gedicht „Ich“ aus dem Jahre 2014 zwei „Ichs“, die sich in ihr gegenüberstehen, sich einerseits ergänzen, andererseits auch in Frage stellen. Das Ich, das sie selber wahrnimmt, entspricht nicht dem Bild, das sich andere von ihr machen. „Eigentlich bin ich anders und doch genauso.“ (V. 3) Das Gedicht ringt mit der Frage, ob die eigene Existenz eine einheitliche Realität darstellen kann. Es endet mit dem erwünschten Zielpunkt („Ich“, V. 13), der aber eher als Lebensaufgabe offen bleibt.





























