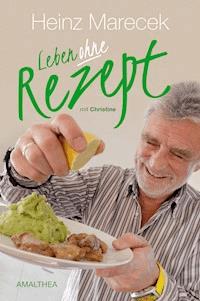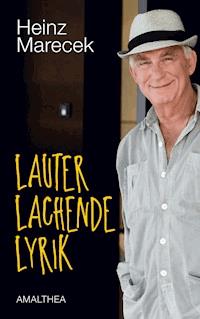Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Heinz Marecek wundert sich immer noch. Und zwar am meisten über sich selbst. In seiner Autobiografie erzählt der Publikumsliebling von den Anfängen seiner Karriere - das Reinhardt-Seminar hätte sich seiner ja beinah wieder entledigt, wäre da nicht Otto Schenk gewesen -, von seinem Part als jugendlicher Komiker, von den Pannen auf und hinter der Bühne und vom Affen, einer Rolle, die bis heute ausständig ist. Geistreich und mit Humor schildert er Kollegen, Familie und Freunde und erinnert sich an einzigartige Momente und Begegnungen. Gespickt mit köstlichen Anekdoten rund um Theater und Film, von Waldbronn bis Torberg, von Peter Ustinov bis Josef Meinrad, von Liz Taylor bis Oskar Werner, von Haeussermann bis Peymann gewährt der "Serien-Haubenkoch" einen Blick auf die Bretter, die seine Welt bedeuten. Und worum es eigentlich geht, ist gleich ersichtlich: um die perfekte Pointe. Timing ist alles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz Marecek
Ich komme aus demLachen nicht heraus
Heinz Marecek
Ich komme aus demLachen nicht heraus
Erinnerungen
Mit 63 Abbildungen und einem Verzeichnisder Theater-, Film- und Fernsehrollensowie der Regiearbeiten
1. Auflage November 20112. Auflage Dezember 2011
© 2011 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Kurt Hamtil, WienUmschlagfoto: Lukas BeckUmschlagrückseite: Christoph SebastianSatz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12/16 Punkt Adobe GaramondE-Book ISBN 978-3-902862-07-5
Für meine Kinder, Sarah und Ben, als kleinen Dank,für das große Maß an Geduld, Nachsicht und Humor,das sie für meine Erziehung aufgebracht haben.
»Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. –Wanderer, es gibt keinen Weg.Ein Weg entsteht, indem man geht.«ANTONIO MACHADO
»Wenn etwas witzig ist, untersuche ich essorgfältig auf die verborgene Wahrheit.«GEORGE BERNARD SHAW
Inhalt
VorwortÜber das Lachen
Kindheit und Jugend in Wien
Theater – der rettende Ausweg
Die Türen öffnen sich
Regie
Ein Freund wird Direktor – und ich werde auf der Straße erkannt
Verspielte Sommer
Auf freier Wildbahn
Theaterpolitik – Politiktheater
Wien
Meine Kinder
Es ist ein Kreuz mit dem Kreuz!
Homo ludens
Bridge
Schach
Golf
Ibiza
Aus Kindern werden Leute
Sarah: Mein Vater
Benni
Datensynopsis
DVDs und Bücher
Namenregister
Bildnachweis
VorwortÜber das Lachen
Lachen zieht sich durch mein Leben wie ein silberner Faden.
Es gibt Ereignisse, bei denen gelacht wurde, die vor Jahrzehnten stattgefunden haben, die mir aber so lebhaft in Erinnerung geblieben sind, als wären sie gestern passiert. Es gibt Witze, die ich als Kind gehört und nie vergessen habe. Alle meine Freunde verbindet – bei all ihrer Verschiedenheit – die Eigenschaft, dass ich mit ihnen lachen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mit jemandem wirklich befreundet zu sein, mit dem ich nicht lachen kann. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem meine Frau und ich nicht miteinander lachen. Ich würde meine Kinder natürlich immer lieben, weil sie eben meine Kinder sind, aber die Tatsache, dass ich mit ihnen so oft und so herzlich lachen kann wie mit kaum jemand anderem, erfüllt mich mit einem ungeheuren Glücksgefühl. Die Fähigkeit – oder besser die Gabe, denn letztlich ist es ja ein Geschenk – lachen zu können, ist wie ein fliegender Teppich oder wie Aladins Wunderlampe, aus der, wenn immer man daran reibt, ein Geist herauskommt – der Geist des Lachens!
Dabei finde ich viel, was um mich herum vorgeht, überhaupt nicht lustig, aber sehr viel ungeheuer komisch.
Wenn die Amerikaner einem Land, das Öl oder andere interessante Rohstoffe hat, den Krieg erklären und die jeweilige Außenministerin der Welt treuherzig beteuert, man wolle jenem Land den Segen der Demokratie bringen, die Amerikaner aber bekanntlich eine ungetrübt herzliche, ölgetränkte Freundschaft mit Saudi-Arabien verbindet, der wahrscheinlich rigidesten absolutistischen Theokratie der Welt, in der oppositionelle Parteien strafrechtlich verfolgt werden und Frauen keinen Führerschein machen dürfen, dann ist das natürlich nicht lustig – aber wirklich komisch. »You think you might consider some democracy for the Saudi people, King Abdullah?« – »No, but I might consider selling my oil to the Chinese. After all, they pay cash!« – »Oh, sorry, King Abdullah, stupid question!« – »No problem, just don’t let it happen again, Hillary!«
Wenn gegen einen österreichischen Ex-Politiker jahrelang ermittelt wird, weil während und nach seiner Amtszeit in seinem Freundeskreis ein erstaunlicher Kapitalzuwachs registriert wurde und man nach diesen Ermittlungen »völlig überraschend« eine Hausdurchsuchung durchführt, also zu einem Zeitpunkt, wo auch der größte Trottel schon alle Beweise beiseitegeschafft hätte, dann ist das auch nicht lustig – aber sehr komisch. Und wenn man dann sogar noch was findet – ist es sogar lustig!
Und wenn ein anderer Ex-Politiker, dessen Partei bei den Wahlen nur den dritten Platz erreicht hatte, dem es aber mit machiavellischer Parterreakrobatik und houdinischen Verrenkungen gelungen war, sich in den Kanzlersessel zu katapultieren, Jahre später als »einfacher Abgeordneter« zurücktritt, um »die Untersuchungen dubioser Vorfälle unter seiner Kanzlerschaft nicht zu behindern«, dann ist das ziemlich komisch!
Aber alle Parteien, auch die meiner sozialdemokratischen Freunde, entbehren ja nicht einer gewissen Komik. Wenn man sich an jedem 1. Mai überlegt, ob die Statik der Tribüne vor dem Rathaus noch dem Umstand Rechnung trägt, dass das Lebendgewicht der dort stehenden Funktionäre mit Lichtgeschwindigkeit zunimmt (nur Josef Cap zieht hartnäckig den Schnitt nach unten, und seit Neuestem auch Laura Rudas) und dann meine Freunde Häupl, Gusenbauer und Co. mit feierlich-ernstem Gesicht die »Internationale« intonieren: »Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt«, dann fällt es mir, bei aller Sympathie und bei aller Gänsehaut, die die Klänge dieses Liedes immer noch bei mir erzeugen, sehr schwer, ernst zu bleiben. Tut mir leid, aber es ist einfach komisch.
Wenn Greise in Soutanen, die schon vor Jahrzehnten der geschlechtlichen Liebe entsagt haben – sollten sie Gottes verschlungene Wege nicht zufällig über das Lehramt geführt haben –, gültige Spielregeln für dieselbe aufstellen wollen, und es auch noch Menschen gibt, die diese ernst nehmen, ist das sowohl lustig als auch komisch.
Wenn ich mit dem Auto nach Ibiza fahre, also nach Barcelona, um dort die Fähre zu nehmen, und zwischen Wien und dem Walserberg mehr Autobahn-Baustellen sind als in der Schweiz, in Italien, in Frankreich und in Spanien zusammen, ist das wahrlich nicht lustig – aber komisch. Es gibt dort auch immer tiefe Spurrinnen, die sich bei Regen übergangslos in Sprungschanzen verwandeln. Heißa, juchei! Auf geht’s! Es wäre durchaus gerechtfertigt, auf den Preis der Autobahn-Vignette zehn Prozent Vergnügungssteuer aufzuschlagen!
Wenn ich auf der Südautobahn in Richtung meines geliebten Friaul fahre und diese Südautobahn – die sich streckenweise zu einer wirklichen Autobahn verhält wie eine Kuhflade zu einer Sachertorte – sich in Tarvis von einer besseren Forststraße in einen Samtteppich verwandelt, ist das auch nicht lustig – aber immer noch komisch. Es könnte doch der zuständige österreichische Minister seinen Kollegen in Italien anrufen und in seinem tadellosen Italienisch – die österreichischen Minister sind ja geradezu verschrien als Polyglotten! Oder heißt es Falotten? – fragen: »Was habt ihr für euren Autobahnbelag, was wir nicht haben?« – »Ah, ihr verwendet wirklichen Asphalt! Verstehe. Aha, Plastilin hält einfach nicht. Danke, Giovanni!« Es wurde eben hier Asphalt verrechnet, aber Plastilin verwendet!
Wenn in Österreich das ganze Geld, das für die Autobahn vorgesehen war, in den letzten fünfzig Jahren tatsächlich für diese verwendet worden und nicht viel davon in irgendwelchen dunklen Kanälen versickert wäre, hätten wir heute nicht nur so schöne Autobahnen wie unsere italienischen Freunde, nein, wir könnten unsere Leitschienen bis zum Brenner und zum Walserberg vergolden!
All das hat nicht erst 2000 mit »Blau-Schwarz« begonnen. Die schwarzen blauen Schafe haben es ja auch nicht erfunden, sondern nur rasend schnell gelernt und sich in weiser Voraussicht gedacht: Sehr lange kann das ja mit uns nicht dauern. Eigentlich verstehen wir gar nicht, dass es überhaupt angefangen hat. Also nehmen wir uns, so schnell wir können, so viel wir können!
Wenn ich mit meinen beiden Schachfreunden Dr. Werner Schneyder und Dr. Hans Pusch eine Partie spiele – Schach ist ja zunächst nicht wirklich ein lustiges Spiel –, wird sehr oft gelacht. Erstens, weil wir keineswegs stumm konzentriert spielen (wohl konzentriert, aber nie stumm), sondern viele Züge von Kommentaren begleitet werden: »Das soll ein Zug sein? Der wurde schon widerlegt, da warst du noch gar nicht auf der Welt!« – »Das Lettische Gambit ist und bleibt ein läppisches Gambit, Herr Doktor!« – »Mach schon an Zug, du Patzer!« – »Spiel nie eine Eröffnung, die du nicht kannst – aber da dürftest du ja überhaupt keine spielen!« So also, in diesem Sinne halt.
Aber es wird auch gelacht, wenn einer von uns einen Zug gefunden hat, von dem er glaubt, dass der andere nicht damit gerechnet hat, oder wenn er eine Falle sieht, die ihm der andere hinterhältig gestellt hat – das Lachen der Erkenntnis!
Ich habe immer dort am liebsten und am leichtesten neue Erkenntnisse gewonnen, wo ich gleichzeitig auch lachen konnte.
Als ich ungefähr sechzehn Jahre alt war, fiel mir zufällig ein kleines Büchlein in die Hände: The Conquest of Happiness von Bertrand Russell. Das war der Beginn einer lebenslänglichen Liebe. Ich kann gar nicht sagen, was dieser Mann – wahrscheinlich einer der luzidesten Köpfe des 20. Jahrhunderts – für meinen Kopf getan hat. Innerhalb kürzester Zeit besaß ich eine kleine Russell-Bibliothek, ich konnte mich nicht sattlesen an ihm.
Und machte eine aufregende Entdeckung. Erstens, dass Denken eine geradezu erotische Faszination ausüben kann, und zweitens, dass man auch über die ernstesten und wichtigsten Dinge nachdenken kann, ohne dabei den Humor zu verlieren.
Aber ich wurde dadurch frühzeitig verdorben, weil ich diese Forderung naiv auch an alle die Denker stellte, denen ich später begegnete – eine Enttäuschung folgte der nächsten. Ich konnte mit der schwülstigen, unklaren, esoterischen, humorlosen Priester-Geheimsprache der deutschen Denker und Sozialkritiker einfach nichts anfangen. Adorno, Horkheimer, Habermas oder der seltsame Wirrkopf Heidegger, dessen Diktion nicht einmal die »Frankfurter« ausgehalten haben, blieben für mich ein Buch mit sieben Siegeln. »Das Nichts nichtet!« Was du nicht sagst, Martin! Und »Der Wicht wichst!«, nehme ich an. Oder wenn er in seinem Aufsatz »Das Ding« mit der erhellenden Erkenntnis beginnt: »Ausgießen aus dem Krug heißt schenken. Das Krughafte im Krug west im Geschenk.« Und in der Tour geht es weiter. Wie hat Popper über ihn gesagt: »Und man versteht kein Wort. Seitenweise.« Tucholsky hat es auf die unschlagbare Kurzformel gebracht: »Heidegger, der Philosoph, der nur aus Pflaumenmus besteht.« Und sein Erzfeind Adorno hat gegen ihn seine Polemik Der Jargon der Eigentlichkeit geschrieben. Schreibt aber selber so Sachen wie: »Kunst will das, was noch nicht war, aber alles, was sie ist, war schon.« Durchaus möglich, dass er recht hat – nur ich habe nicht die geringste Ahnung, was er meint.
Aber ich war, wie gesagt, von Russell verdorben. Und was mich am meisten enttäuschte, war diese Humorlosigkeit. (Man ist versucht, »deutsche« dazuzusagen, darf man aber nicht, weil auch Erich Kästner, Loriot, Hanns Dieter Hüsch und viele andere große Humoristen von dort kommen.) Das wunderbare Lachen der Erkenntnis hat sich jedenfalls bei mir nie eingestellt. Oder vielleicht gab es da einen Humor, den ich nicht verstanden habe.
»Bei vielen Menschen ist es schon eine Unverschämtheit, wenn sie ›ich‹ sagen.« Vielleicht fand Adorno seinen Satz lustig, ich hielt ihn einfach nur für arrogant und überheblich. Wo bleibt das Mitleid? Er hat meiner Meinung nach vergessen, dass er in vieler Hinsicht ein sehr privilegierter Mann war und viele Menschen, bei denen es für ihn schon eine Unverschämtheit ist, wenn sie »ich« sagen – und ich weiß schon, was er meint, so blöd bin auch ich wieder nicht –, nicht seine Möglichkeiten hatten.
Das ist das Problem, das es zu lösen gilt. Die Diagnose allein hilft nicht. Natürlich ist sie, wie in der Medizin, die Voraussetzung. Man hat der berühmten »Wiener Medizinischen Schule« oft vorgeworfen, dass ihr die Diagnose wichtiger war als das Heilen. Diesen Vorwurf kann man der »Frankfurter Schule« auch machen.
Aber die Frankfurter haben viele Anhänger gefunden (sowohl als Würste wie auch als Denker), die wahrscheinlich der Meinung waren, wenn man etwas überhaupt nicht versteht, muss ja was dran sein. Oder – und das muss man dann neidlos anerkennen – sie haben sie wirklich verstanden. Als Menschen waren – und sind mir bis heute – sowohl Adorno als auch Heidegger (die anderen kenne ich noch weniger) ziemlich suspekt. Heidegger kam von der Theologie, wurde dann Philosoph, dann wirklich begeisterter Nazi (seine Reden und Aktionen als Rektor der Universität Freiburg waren einfach schändlich), dann wieder Philosoph, um an seinem Lebensende wieder resigniert sein Heil in der Religion zu suchen. Na ja, wie gesagt: »Das Nichts nichtet.« Dem ist nichts hinzuzufügen.
Und Adorno (der im Jahr 1934 als Musikkritiker eine Hymne auf die vertonten Männerchöre von Baldur von Schirach geschrieben und noch 1937 um Aufnahme in die Reichsschrifttumskammer angesucht hatte), den die 68er angehimmelt haben, dessen Zitate sie ständig auf den Lippen hatten, ließ den Hörsaal von der Polizei räumen, als seine Studenten, deren Bibel seine Kritische Theorie war und die im Grunde nur eine konsequentere Fortsetzung seiner eigenen Ideen forderten, sein Institut besetzten. Er konnte sich nicht anders wehren. Nicht komisch – traurig! 1961 wurde der 89-jährige Russell bei einem Anti-Atomwaffen-Protestmarsch in London wegen »Widerstands gegen die Staatsgewalt« verhaftet und zu einer Woche Gefängnis verurteilt. Das ist der Unterschied: Der protestierende Russell ließ sich selbst verhaften – Adorno seine protestierenden Studenten.
Welch ein Labsal war es dann, endlich, nach Russell, jemandem wie Popper zu begegnen! Ein Mann, der sich schon allein von den Frankfurtern dadurch unterschied, dass der Titel eines wichtigen Buches von ihm lautete Alles Leben ist Problemlösen (schon viel mehr nach meinem Geschmack), und der es geradezu als vornehmste Aufgabe des Denkers ansah, sich klar auszudrücken: »Das Schlimmste aber – eine Sünde gegen den Heiligen Geist – ist es, wenn Intellektuelle sich ihrer Umwelt gegenüber als große Propheten aufspielen und versuchen, sie durch Orakelsprüche zu beeindrucken. Wer’s nicht klar sagen kann, der soll schweigen und weiterarbeiten, bis er’s klar sagen kann.« Wittgenstein hat zwar auch gesagt: »Alles, was man sagen kann, kann man auch klar sagen«, befolgt hat diesen Satz aber, weit mehr als er, Sir Karl Raimund Popper. Behutsam (gelegentlich auch gar nicht so behutsam, was ihm in England den Spitznamen »The totalitarian liberal« eingebracht hat), glasklar, mit intellektueller Redlichkeit – und mit einem ständig aufblitzenden Humor.
Endlich wieder so einer! Wozu die Jahre im englischsprachigen Raum sicher viel beigetragen haben! Während Wittgenstein ein Leben lang den Unterschied zwischen sinnvollen und sinnlosen Sätzen untersucht hat, um am Ende draufzukommen, dass das einzig Sinnvolle dieser Beschäftigung war, herauszufinden, dass sie sinnlos ist. Außerdem hat Wittgenstein (er war vielleicht zu kurz in England und zu lange in Norwegen) in Cambridge Popper – wenn auch vielleicht nicht ganz ernst gemeint – mit dem Schürhaken bedroht und dann wütend das Zimmer verlassen. Auch kein eines wirklichen Philosophen würdiger Abgang. Aber Wittgenstein war jähzornig. Das haben seine Schüler während seiner kurzen Karriere als Dorfschullehrer am eigenen Leib zu spüren bekommen.
Russell und Popper waren auch Lehrer. Leidenschaftliche, engagierte. Popper begann bei Alfred Adler als ehrenamtlicher, sprich unbezahlter Lehrer für Schwererziehbare und brachte es bis zum einflussreichen Professor der »London School of Economics«, und Russell gründete sogar eine eigene Schule, weil ihm die bestehenden nicht gut genug erschienen. Aber meines Wissens haben beide ihre Schüler weder bei den Ohren gezogen noch ihnen Kopfnüsse versetzt, wie dies der unbeherrschte Ludwig ständig tat.
Natürlich hatte ich auch am Theater immer die größten Schwierigkeiten mit jenen Regisseuren oder »Theatermachern«, die sich der Diktion der Frankfurter Schule bedienten – und eine Zeit lang taten dies viele. Praktisch alle, die etwas auf sich hielten. Sie trugen unter einem Arm den »Spiegel«, gegen den ich wirklich nichts hatte, im Gegenteil, aber er war für viele nur ein Requisit, mit dem sie ihre Intellektualität demonstrieren wollten. (Es gab den berühmten Witz: »Was ist der Unterschied zwischen den deutschen und den österreichischen Intellektuellen?« – »Die deutschen Intellektuellen sind »Spiegel«-Leser, die österreichischen Intellektuellen sind Spiegeltrinker.«)
Unter dem anderen Arm trugen sie »Theater heute«, gegen das ich schon mehr hatte, denn darin wurde auf eine Art und Weise über Theater gesäuselt, die mir schon mit zwanzig auf die Nerven ging. Sie sonderten dann Sätze ab wie: »Wir wollen versuchen, mit diesem Stück die Produktivitätsgrenzen des dekonstruktiven Ästhetizismus auszuloten!« (Das ist ein wörtliches Zitat!) Wie kann man als Schauspieler bei einer solchen Ankündigung ernst bleiben? Ich konnte es nicht. Meine Antwort war: »Sag mir einfach, wo ich auftrete, und lote inzwischen.«
Lachen ist den Mächtigen immer unheimlich. Jeder schlechte Lehrer wird sofort nervös, wenn »unten« gelacht wird. Weil er – meist zu Recht – annimmt, dass über ihn gelacht wird. Jede Diktatur zeichnet sich dadurch aus, dass Witze, die in irgendeiner Form das System infrage stellen, bei (Todes)Strafe verboten sind. Unter Hitler, Stalin, Honecker, Franco oder Pinochet wurde wenig gelacht. Offiziell. Auch lachende Generäle sind selten.
Militär an sich lacht nicht. Wie kann ein Mensch ernsthaft im Stechschritt gehen, Gewehrgriffe pracken oder auch nur salutieren und dabei ernst bleiben? Nur wenn ihm das Lachen bei Strafe verboten wird! (Wie singt mein Freund, der wunderbare, seit Jahrzehnten von mir verehrte Georg Kreisler in seinem Lied vom General: »Na ja, er ist ein General, da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne. Und wenn die andern salutier’n – das hat er gerne! Na, sag’n Sie selbst – ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt ein General!«)
Jede Einrichtung, die merkt, wie schnell sie der Lächerlichkeit preisgegeben werden kann, tut alles, um dieses entlarvende Lachen zu verhindern. Plato hat sich vehement gegen die Lektüre von Homer gewandt (gegen die der dramatischen Dichter sowieso), weil bei ihm Helden weinen und Götter lachen. Militär, Krieg und Götterverehrung werden in einem Aufwasch relativiert! Damit konnte er, Plato, von dem das gefährliche Diktum »Kein Mensch soll ohne Führer sein« stammt und der ebenso vehement, wie er gegen Homer war, für eine militärische Aufzucht der Kinder und einen straff geführten totalitären Staat eingetreten ist, natürlich nichts anfangen. Und doch gibt es wahrscheinlich kaum eine andere Staatsform, die den Witz und das Lachen so animiert wie die Diktatur. Lachen als Ventil für tiefe Verzweiflung, als letzte Möglichkeit, das Unerträgliche zu ertragen! (Das ist ja eine der Wurzeln des jüdischen Witzes, die ständige Auseinandersetzung mit Verfolgung, Bedrohung, Not und Verzweiflung. Darum macht auch jeder gute jüdische Witz das Wesen der Dialektik weit einleuchtender und klarer verständlich als Hegel, Marx oder die gesamte Frankfurter Schule.)
»Always look on the bright side of life!«: »Tausend Clowns«, Kammerspiele 1993
Und das Unerträglichste für uns Menschen ist der Tod. Wir verdrängen unsere Angst davor, indem wir Witze über ihn machen. Begräbnisse sind besonders gefährdet! Ein falsches Wort vom Pfarrer, ein komischer Hut – schon hat die Trauer eine rettende Entschuldigung gefunden –, man lacht. Oder, wie es meine Freunde aus dem Weinviertel, wo ich viele Jahre gelebt habe, so treffend formuliert haben: »G’locht muass werd’n bei der Leich’ – sonst geht kaner mit!«
Es gibt also viele Formen des Lachens. Die gar nicht so verschieden sind voneinander. Sie gehen ineinander über. Das Lachen der reinen Freude, der Schadenfreude, der Erkenntnis, der Verzweiflung, der Peinlichkeit, der Erleichterung.
Und sollte ich je der gütigen Fee begegnen, die uns Sterblichen drei Wünsche gewährt, müsste ich nicht lange nachdenken: »Erstens möchte ich nie die Fähigkeit verlieren, mich zu wundern; zweitens möchte ich, so lange es irgendwie geht, neugierig bleiben; und drittens, bitte, lass mich nie die Fähigkeit verlieren zu lachen!«
Denn die Zeilen aus Goethes Faust, die mich immer mehr erschüttert haben als die ganze Gretchentragödie, sind jene aus dem »Prolog im Himmel«, wenn Mephistopheles zum Herrn sagt:
»Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen,Und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt;Mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen,Hättst du dir nicht das Lachen abgewöhnt.«
Schrecklicher Gedanke! Wobei man allerdings zugeben muss: Jeder halbwegs anständige Gott hätte sich als Verantwortlicher für den Zustand dieser Welt wahrscheinlich schon längst das Lachen abgewöhnt.
Als Menschen dürfen wir, können wir, müssen wir weiterhin lachen!
Kindheit und Jugend in Wien
Das Wien der Nachkriegszeit. Oper, Burgtheater, Stephansdom, die Bahnhöfe schwarz und ausgebombt. Eine allgegenwärtige Armut. Die wenigen Autobesitzer können ihr Fahrzeug jeden Tag an genau derselben Stelle parken, weil es pro Haus sowieso nicht mehr als zwei oder drei davon gibt. Es gibt keine Einbahnen, keine Kurzparkzonen. Wozu auch? Wegen der paar Autos?
Wir lebten auf Zimmer-Küche-Kabinett. Klassisch. Wir hungerten nicht, wir froren nicht, aber man musste sehr behutsam mit dem Geld umgehen. Wenn ein Laib Brot gekauft wurde, aßen wir so lange davon, bis er weg war. Das hat manchmal auch drei Tage gedauert. Oder vier. Völlig undenkbar, Brot wegzuwerfen, weil es vielleicht schon etwas hart war. (Und es hat auch am dritten Tag noch geschmeckt. Versuchen Sie das heute mit einem Brot! Wenn man es am Morgen kauft, ist es am Abend bereits steinhart. Nicht, weil wir verwöhnter sind, sondern weil einfach das Brot schlechter geworden ist. Es ist fast unmöglich geworden, irgendwo regelmäßig wirklich gutes Brot zu kriegen. Es gibt die unwahrscheinlichsten, ausgefallensten, exotischsten Delikatessen, man kann auf jedem Markt unter vierzehn verschiedenen Sushi-Blättern wählen, Früchte kaufen, deren Namen man noch nie gehört hat – aber kein gutes Brot. Bizarr!)
Mein Vater ging jahrelang vom siebten Bezirk, wo wir wohnten, in sein Büro im ersten zu Fuß, ohne die paar Groschen in der Tasche, um sich eventuell am Heimweg ein Bier zu kaufen. Was wir auf dem Leib trugen, war größtenteils von meiner Mutter in nächtlicher Heimarbeit angefertigt worden: Hemden (meist aus Baumwollflanell, dem billigen Barchent), selbst gestrickte Pullover, Mützen und Schals. Als Schuljause gab es Schwarzbrot mit selbst gemachtem Liptauer oder – natürlich – selbst gemachter Marmelade. Bis zur großen Pause hatte sich der Liptauer oder die Marmelade tief in das ungebutterte Brot eingesogen, und man aß zwei feuchte, aneinanderklebende Brotscheiben. Lecker! Im Winter war es besser, da gab es Schmalz oder – mein absoluter Liebling – das »Brat’lfett« vom sonntäglichen Schweinsbraten. Runtergespült wurde Marmelade, Liptauer oder Schmalz mit dem Schulkakao. Eine delikate Mischung!
Eines meiner ersten großen oralen Erlebnisse (»Honni soit qui mal y pense!«) hatte ich, als ich bei einem Schulfreund zum Spielen eingeladen war und zur Jause Buttersemmeln mit Schinken und Gurkerl serviert wurden. Das erste Weißgebäck meines Lebens! Ich habe den Geschmack immer noch im Mund. Und bis heute hat für mich eine Buttersemmel mit Schinken nach wie vor den Hauch von Luxus.
Irgendwie klingt das alles ziemlich trist, war es aber keineswegs. Erstens betraf es fast alle. Ich besitze noch Fotos aus meiner Volksschulzeit, wir waren alle gleich schrecklich angezogen, inklusive der Lehrerin. Und zweitens hatte Armut offenbar auch gewisse Vorteile. Wenn meine Eltern gelegentlich abends ausgingen – selten genug, aber ab und zu gab es doch ein »Kränzchen«, eine Geburtstagseinladung oder einen Heurigen –, verabschiedete sich meine Mutter jedes Mal mit dem Satz: »Also, schlaft gut. Ihr wisst, ihr braucht keine Angst zu haben. Gespenster gibt’s nicht, und Einbrecher kommen nur zu reichen Leuten. Was sollen sie bei uns stehlen? Uns könnten sie bestenfalls was bringen.«
Fernsehen war noch nicht erfunden, Plattenspieler und Schallplatten waren jenseits der finanziellen Möglichkeiten, wir hatten wohl einen alten kleinen Volksempfänger, der stand aber im Schlafzimmer meiner Eltern. (Dort hörten wir, auf dem Bett sitzend, 1954 das Spiel um den dritten Platz der Fußball-WM in Bern: Österreich gegen Uruguay. Österreich gewann, wurde Dritter, hinter Deutschland und Ungarn. Waren das Zeiten! Unsere Fußballer damals waren so gut wie das Brot. Während heute weder …, nein, das wäre jetzt unpatriotisch!) Also blieb einem gar nichts anderes übrig, als zu lesen, zu lesen und wieder zu lesen. Merkwürdigerweise war immer wieder Geld für Bücher da.
Mein Vater glaubte geradezu inbrünstig an Bücher. An die Sprache und ihre korrekte Anwendung. Er glaubte sogar an den Genitiv! Und korrigierte uns oder unsere Mutter, wenn wir statt dessen den viel vertrauteren Dativ benützten.
Er sprach natürlich Wiener Dialekt, wir alle taten das. Aber er war allergisch gegen das Bassena- oder Rinnsal-Wienerisch. Jene seltsamen Laute, wo ein »Guten Morgen« wie eine Morddrohung klingt. Ziemlich beachtlich für einen Eisenbahner-Buben aus Meidling, dessen Eltern wahrscheinlich zeit ihres Lebens nicht ein einziges Buch gelesen haben und der nach der Hauptschule gerade einmal zwei Jahre Hutmacher-Lehrling war, bevor er mit sechzehn zum Arbeitsdienst und wenig später von dort direkt an eine russische Front verlagert wurde, von wo er mit abgefrorenem und amputiertem Fuß als Achtzehnjähriger zum Schreibstubendienst in die Heimat transferiert wurde. (Der Vorteil war, dass er dadurch schon im Dezember 1944 meine Mutter heiraten konnte und ich, fast am Tag genau, neun Monate später auf die Welt kam. Ein herrliches Gefühl, so ein Kind der ersten Liebe zu sein!)
Wir waren Mitglieder bei sämtlichen Buchgemeinschaften, ich hatte selbstverständlich eine Mitgliedskarte der Leihbücherei, ging, sobald ich durfte, wahnsinnig gerne in die Nationalbibliothek, weil ich die grünen Leselampen im großen Lesesaal so liebte (ich habe bis heute, über allen Tischen, an denen ich lese, grüne Lampen), und mir stand auch die umfangreiche Bibliothek meines Großvaters mütterlicherseits zur Verfügung.
Das waren die wunderbarsten Nachmittage meiner Kindheit: Nach der Schule mit der Straßenbahn zu meiner Großmutter zum Mittagessen – sie war eine Zauberköchin – und anschließend ein paar Stunden lesen auf dem riesigen, gemütlichen Diwan in ihrem altdeutschen Wohnzimmer. Schiller- und Goethe-Balladen, Hauffs Märchen, Chamisso, Uhland, Eichendorff, Lenau, Heine und Lessing. Alle standen sie dort, die Romantiker, die Klassiker, aber auch Otto Weiningers Geschlecht und Charakter und hochinteressante Aufklärungsliteratur, zum Teil sogar illustriert! Zwar ziemlich weit hinten im Bücherschrank, aber ich habe sie alle gefunden und besitze sie fast alle heute noch.
Der zweite große Glücksfall meiner Kindheit war, dass sich in unserem Haus im Keller ein Turnverein befand. Ab meinem dritten Lebensjahr durfte ich mich da unten herumtreiben, und mit sechs konnte ich mühelos auf den Händen vom zweiten Stock hinunter in den Turnverein gehen, und meist ging ich nach dem Turnen wieder auf den Händen hinauf. Später kamen noch Basketball und Wasserspringen dazu.
Und ein-, zweimal pro Woche ging ich zur katholischen Jungschar zum Tischtennisspielen. Das habe ich im Arbeiter-Turnverein natürlich nicht erzählt. Einmal bin ich zum Turnen gekommen und habe irrtümlich »Grüß Gott« gesagt. Mehr habe ich nicht gebraucht! Der alte Turnlehrer »Huscherl« (eigentlich hieß er Dluhosch, wurde aber von allen nur Huscherl genannt) sagte: »So, jetzt gehst du wieder hinaus, und wenn du wieder hereinkommst, sagst du entweder ›Freundschaft‹ oder ›Sport frei‹« (der traditionelle Gruß der Arbeiter-Turner). »›Grüß Gott‹ sagt man in der Kirche.« Aber ein Tischtennistisch ist halt ein Tischtennistisch, da muss man schon gewisse weltanschauliche Barrieren einfach überspringen.
Und dann begannen sich auf geheimnisvolle Weise die ersten Sehnsüchte bemerkbar zu machen, die nur dieser seltsam-wunderliche Beruf des Schauspielers stillen kann: die Lust nach einem anderen Leben, oder gleich nach mehreren, verschiedenen. Irgendwo, weit weg.
Ich ging zum Beispiel in den Nachbarbezirk überm Gürtel (im eigenen Bezirk hatte ich Angst, erkannt zu werden) in irgendein Geschäft und spielte ein ausländisches Kind, das sich nach diesem oder jenem Artikel erkundigte oder nach einer Adresse. Ich sprach mit einem Fantasieakzent, behauptete, aus irgendeinem Land zu kommen, das mir gerade einfiel, erfand alle möglichen Berufe für meinen Vater oder meine Mutter, führte mit der Verkäuferin ein Gespräch, bedankte mich höflich – und ging wieder. Durch irgendein unglaubliches Glück geschah es nie, dass, wenn ich zum Beispiel behauptete, meine Muttersprache wäre Französisch, die Verkäuferin gesagt hat: »Wunderbar, da können wir ja französisch reden!« Aber dieser Gefahr wurde ich mir irgendwann bewusst und begann, meine Herkunft in Gegenden zu verlegen, in denen ich ziemlich sicher sein konnte, dass die Verkäuferin der dort gesprochenen Sprache nicht mächtig war: Georgien, Finnland oder Wales. Viele Nachmittage habe ich mir auf diese Weise kostenlos die Zeit vertrieben. Eigentlich waren das meine ersten Theatervorstellungen.
Samstag war Kino-Nachmittag. Das bevorzugte Kino, das jeden Samstag eine Nachmittagsvorstellung hatte, natürlich eine jugendfreie, war das »Erika« in der Kaiserstraße. Fast alle Kinos meiner Kindheit, das »Admiral«, das »Schottenfeld«, das »Maria Theresia«, das »Hermann« und eben das »Erika« sind im Laufe der Zeit verschwunden. Durch ein Wunder ist das »Bellaria« bis zum heutigen Tag vorhanden. Und sieht auch aus wie ein Fossil, das aus irgendeinem Grund überlebt hat. Eine absolut bewunderungswürdige Leistung, dieses Kino zu erhalten! Dem unbekannten Besitzer sei hiermit herzlichster Dank ausgesprochen.
Wie viele glückliche, atemlose, spannende Nachmittage habe ich als Kind in diesen Kinos verbracht. Wo der Mann mit der Perolin-Duftspritze vor der Vorstellung durch die Reihen ging, um einen angenehmen Geruch im Zuschauerraum zu erzeugen, und man sich gelegentlich zusätzlich zur Kinokarte noch ein Päckchen Seidenzuckerln kaufen konnte.
Die größte Strafe, die man über mich verhängen konnte, war, nachdem ich irgendwas angestellt hatte, und ich stellte oft was an, wenn von meinem Vater oder meiner Mutter der Satz kam, der einem Todesurteil glich: »So, und das Kino am Samstag ist gestrichen.«
Ich muss dann am Samstag ein so todtrauriges Gesicht gemacht haben, dass das Todesurteil doch immer wieder in »Lebenslänglich« umgewandelt wurde: »Also gut, da hast du das Geld fürs Kino, aber wehe, wenn mir in der nächsten Woche irgendwas zu Ohren kommt!« – »Bussi, danke«, und schon war ich draußen und rannte ins »Erika«. Unnötig zu erwähnen, dass ich nach dem Kino regelmäßig Freunde traf, mit denen ich noch in den Park oder sonstwo hinging, und natürlich um zwei Stunden später heimkam als vereinbart. »Aber nächste Woche brauchst du gar nicht zu fragen, ob du ins Kino …« Und so ging das Woche für Woche.
Ich war ein schlimmes Kind. Nicht wirklich schlimm, ich habe nie etwas gestohlen (oder zumindest nur, wenn ich es unbedingt brauchte), habe auch nicht wirklich gerauft – da ist man als Brillenträger, der ich schon früh war, sowieso immer im Nachteil –, aber ich bin prinzipiell zu spät gekommen, zum Essen, in die Schule, egal wo, und bin auch prinzipiell mit zerrissener oder zumindest verdreckter Kleidung nach Hause gekommen. Und ich konnte auch nie den Mund halten, was mir bis heute unheimlich schwerfällt. Es hat jedenfalls in meiner langen Schulzeit immer für eine 3 in »Betragen« gereicht.
Mein Kinderfreibad befand sich auf Höhe des Westbahnhofs zwischen Innen- und Außengürtel. Das bedeutete einen ungefähr zehn Minuten langen Fußmarsch, den man, nur mit der Badehose bekleidet, barfuß zurücklegte. Geld hatte man keines mit, brauchte man auch nicht, aber am Heimweg – nachdem man sich nach dem Schwimmen von der Sonne hatte trocknen lassen – Durst. Auch kein Problem, da sich zwischen Gürtel und unserem Wohnhaus Ecke Ziegler- und Seidengasse mindestens fünf Hydranten befanden, die man mittels eines Pumphebels selbst in Betrieb nehmen konnte, und man seinen Durst mit dem berühmten Wiener Hochquellenwasser löschte. Und jedes Mal, wenn ich zu einem dieser Hydranten kam und pumpte, erfand ich für mich selbst eine Geschichte, durch welch widrige Umstände ich in irgendeiner Wüste fast verdurstet wäre und jetzt in letzter Minute durch diesen sprudelnden Quell gerettet würde. Das kalte Wasser schmeckte besser als jeder Champagner, den ich in meinem Leben getrunken habe. Wobei ich mir auch später aus Champagner nie allzu viel gemacht habe.
Eine Tabaktrafik bekamen in jener Zeit nur Schwerkriegsversehrte. Den meisten Trafikanten fehlte ein Arm oder ein Bein. Unserer in der Seidengasse, der Herr Ludwig, war blind. Ein ausgesprochen fescher Mann, groß, dunkelhaarig, aber eben blind. Mit Blindenhund und weißem Stock. Jedes Mal, wenn ich an seiner Trafik vorbeiging, erfand ich irgendeinen Grund, um hineinzugehen. Gar nicht einfach, zum Rauchen war ich zu jung, und die Arbeiter-Zeitung (die einzige Zeitung, die bei uns zuhause gelesen wurde) lag jeden Morgen vor unserer Wohnungstür. Aber es faszinierte mich unendlich, dass er nach meinem »Guten Tag, Herr Ludwig« sofort »Servus, Heinzi« sagte. Wie viele Stimmen muss dieser Mann im Ohr gehabt haben, um mich nach einem einzigen Satz sofort zu identifizieren, und er konnte das natürlich mit allen seinen Kunden. Ich konnte ihm ewig lange zusehen, wenn er die Zigaretten, die viele Leute damals einzeln kauften, unglaublich geschickt in kleine Päckchen zu drei oder fünf Stück wickelte, oder wenn ein Kunde irgendetwas verlangte, der Herr Ludwig mit nachtwandlerischer Sicherheit den gewünschten Artikel auf den Ladentisch legte, mit derselben Sicherheit das Kleingeld durch seine Finger gleiten ließ und es dabei genau zählte.
Als ich viele Jahre später in dem Stück Schmetterlinge sind frei einen Blinden spielte, erinnerte ich mich sehr genau an viele Handgriffe und die Kopfhaltung des Herrn Ludwig, wenn er beim Sprechen wohl in meine Richtung sah, mich aber nie wirklich fokussierte, sondern rechts oder links an mir vorbeisah und beim Suchen nach Gegenständen der Tastsinn die Funktion des Gesichtssinns übernahm, seine Finger sozusagen Augen bekamen.