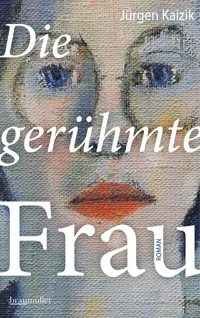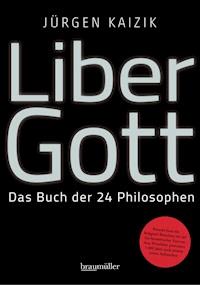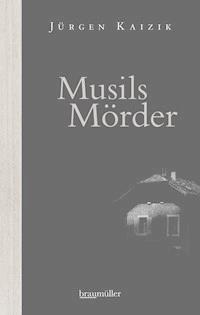18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für den Weltstar Jim Morrison scheint alles zu Ende, bevor es richtig losgegangen ist. Zwar hat der gescheiterte Filmstudent zusammen mit Gleichgesinnten seine eigene Band, The Doors, gegründet, aber ihre Karriere droht in schäbigen Vorstadtspelunken von Los Angeles zu versanden. Drogen, Alkohol und Sex sind eben leichter zu haben als die neue, authentische Musik, von der sie gemeinsam träumen. Eines Abends sitzt ein Typ im Publikum, der dort nicht hinpasst. Seine bloße Anwesenheit stört – und Jim verliert die Nerven. Von da an wird alles anders. Hinterher nennt Jim den Fremden Hölderlin, weil er ihn an eine Zeichnung dieses vor langer Zeit im Wahnsinn verstorbenen Dichters erinnert. Jim Morrison soll im Sommer 1971 in Paris gestorben sein. Angeblich in einer Badewanne ertrunken. Doch niemand, der ihn kannte, hat seine Leiche gesehen. Vielleicht liegt ein leerer Sarg in jenem Grab auf dem Friedhof Père Lachaise, auf das viele Menschen bis heute frische Blumen legen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jürgen Kaizik
Ich und der
Andere
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage 2021
© 2021 by Braumüller GmbH
Servitengasse 5, A-1090 Wien
www.braumueller.at
Lektorat: Johann Auer
Cover basierend auf: © Pablo D. Flores, Public domain, via Wikimedia
Commons
ISBN 978-3-99200-293-1
eISBN 978-3-99200-294-8
Irgendeine heimliche Bombe trägt jeder bei sich. Die Glücklicheren nehmen sie unbeschädigt mit ins Grab. Andere sterben spektakuläre Tode. Und wieder andere warten immerzu, ohne je zu erfahren, worauf. Rundum liegen die Funkenfänger bereit, und wenn eines der Zündschnürchen zu brennen beginnt, gibt es keine Rettung mehr. Plötzlich glaubst du an Gott oder verliebst dich oder hast sonst eine großartige Idee. Das Flämmchen kriecht weiter. Ein glühender Punkt, der nur manchmal leise zischt. Wenn die Glut ihr Ziel erreicht hat, singt und strahlt alles um dich. Den anderen aber fliegt deine Existenz um die Ohren, und innerhalb deines Lebenskreises bleibt kein Stein auf dem anderen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Bonustrack
1
Als ich an jenem schwülen Abend, kurz bevor der Sommer der Revolte die Westküste der USA erreichte, das London Fog betrat, hatte ich keine Ahnung, dass mich dort bereits mein Schicksal erwartete. Aber: Hätte ich mich warnen lassen? Ich wartete doch auf nichts anderes, seit ich von zu Hause davongelaufen war, und das war mehr als drei Jahre her. Augenblicklich legte sich der Dampf schwitzender Menschen auf mich wie eine zweite Haut. Unter meinen Füßen spürte ich den Aufruhr der Unterwelt – und wusste zugleich, es war bloß das banale Bassbrummen einfallsloser Musik. Mühsam drang das Licht weniger Scheinwerfer durch die Rauchschwaden, um die kleine Bühne im Hintergrund aus der Dämmerung herauszuheben. Dennoch galt das Fog als Geheimtipp, war es doch einer der wenigen Musikschuppen in L.A., wo unbekannte Bands sich ausprobieren durften, in der Hoffnung auf den großen Coup. Selbstredend ohne Gage, aber immerhin brauchte man hinterher die Getränke nicht zu bezahlen. Trotz seiner Lage am Sunset Strip war es nicht mehr als ein schäbiges englisches Pub. Eng und hoch wie das Verlies einer Burg. Hinter der Bühne roch es meist nach verschüttetem Bier, schlechtem Shit, manchmal nach Pisse, wenn sich ein paar Tage lang niemand die Mühe gemacht hatte, die Toiletten zu reinigen. Auf der Bühne produzierten sich im Moment ein paar Dilettanten mit Songs, an denen nur die Lautstärke bemerkenswert war. Unsere eigene Show sollte erst in wenigen Minuten beginnen. Eine von Sprüngen durchzogene Schultafel kündigte uns an: The Doors, nine p.m.
An der Bar waren noch Stehplätze frei, die Stimmungskurve tendierte gegen null. Während ich ein Bier trank, taxierten meine Blicke die Ausgangslage. Das Publikum war das übliche. Mädchen tanzten miteinander, zeigten Körper und Beine, während die Männer ihnen zusahen. Im Hintergrund brachten meine Kumpels inzwischen ihre Instrumente in Stellung und zogen die Kabel der anderen aus den Verstärkern, was mit höhnischem Beifall belohnt wurde. Unser Selbstbewusstsein war robust, wenn auch ohne befestigte Grundlage. Seit einigen Wochen nannten wir uns „The Doors“.
Privat waren wir mehr oder weniger normale Ex-Studenten, hatten die Filmhochschule absolviert und waren entschlossen, die Welt der Erwachsenen auf den Kopf zu stellen. Über das Wie stritten wir heftig und nächtelang. Zur ersten Vorbereitung stopften wir allerlei Zeug in uns hinein. Drogen, je nach Angebot, oder Alkohol, beides nur, um unseren Horizont zu erweitern. Dazu passend neue und ältere Literatur. Von Nietzsche über Camus bis zu Kerouac, Celine und vielen anderen. Immer gierten wir nach Erfahrungen, die wir selbst noch nicht gemacht hatten. Die alte, morsche Welt sollte ausradiert werden. Als Publikum wünschten wir uns Rebellen gegen jede Art von Zwang, Tabubrecher, coole Extremisten, Ekstatiker, Liebende. Zum Glück stammten zumindest wir vier aus Familien, die genug Geld im Big Business oder im Krieg verdient hatten. Selbst im Notfall würde keiner von uns in der Gosse landen. Das machte uns mutiger als jene, die arm auf die Welt gekommen waren, um sie später ebenso arm wieder zu verlassen. Zugleich schämten wir uns und schwiegen darüber. Mich nannten alle Jim, obwohl ich eigentlich James hieß und einen ziemlich berühmten Namen trug, den meines Vaters nämlich, von dessen Großtaten sogar die Zeitungen berichteten. Bald hatte ich mein zweites Bier in der Hand und schlenderte betont locker dem Auftritt entgegen. Ein paar Fans klatschten. Das war fast peinlich, weil es noch so wenige waren, und linderte doch meine Aufregung, die ich verbergen wollte.
Genau in diesem Augenblick, bevor die Show losgehen hätte können, entdeckte ich diesen Typen. Das heißt, ich entdeckte ihn nicht, sondern etwas an ihm fuhr mir in die Augen und von da unmittelbar in den Magen, wo es feststeckte, während er mich keines Blickes würdigte. Vielleicht ein Lehrer, schoss es mir durch den Kopf. Lehrer waren mir schon als Kind auf den Geist gegangen. Ausnahmen mag es geben, aber in meinem persönlichen Bestiarium bewohnen sie die untersten Plätze. Altmodisch gekleidet wie die meisten von ihnen, hockte er da, eine abgenutzte Ledertasche neben sich, eine Wolke von Schwermut um sich, kaum älter als ich. Ein Lehrer, der keine gute Zeit hinter sich hatte? Vielleicht. Mir sollte es egal sein, aber warum konnte ich meinen Blick nicht von ihm abwenden? So etwa musste es einem Voyeur gehen, wenn seine Augen, wie von Gott dazu verdammt, an einem Frauenkörper kleben blieben. Andererseits: Für einen Lehrer hatte er viel zu lange Haare. Also doch bloß irgendein Landstreicher? Einer, der sich hereinverirrt hatte, aus Sehnsucht nach anderen Menschen? Oder aus Scheu vor der Welt dort draußen? Wie von einem anderen Stern gefallen, saß er da. Dann griff er nach seiner Tasche und zog ein Heft heraus. Schlug es auf und schrieb etwas hinein. Also doch ein Lehrer! War er etwa hierhergekommen, um Schulhefte zu korrigieren? Eine Provokation! Kann man so einen nicht einfach hinausschmeißen? In diesem Moment wurde mir bewusst, dass ich viel zu lange schon auf einem Platz stehengeblieben war. Mein Magen rebellierte immer noch. Die anderen auf der Bühne hatten inzwischen ihre Gitarren gestimmt und einige Riffs hingelegt, John wirbelte herausfordernd mit seinen Drumsticks. Höchste Zeit, meinen Platz einzunehmen. Ich war der Sänger. Auf mich würde es ankommen. Unter dem Druck der ersten Akkorde gab der Kloß in meinem Magen nach, die Bahn für meine Stimme wurde frei. Sie klang nicht so sexy wie die von Elvis Presley zehn Jahre zuvor, aber sie klang, und auch von meinem Körper ging Kraft aus, das spürte ich an den Blicken und daran, wie sie an mir herumfingerten.
Unsere Musik war eine Mischung aus Mystik und softer Pornografie, eine von Robbies Gitarrenexzessen vorangetriebene Reise an die Ränder der Nacht, bereit für Liebe und Tod, begleitet von meinen Ausbrüchen und den Zauberklängen aus Rays elektrischer Orgel. „Psychedelisch“, nannten wir das, und hielten es für unsere Erfindung. Der Rock ’n’ Roll der Sechzigerjahre plus etwas Neuem, das wir selbst nicht in Worten ausdrücken konnten. Die Texte an diesem Abend waren eher harmlose Reimereien, die mir in der vergangenen Nacht eingefallen waren und in denen sich Schwanz auf Tanz reimte und so weiter. So etwas hatte ich schon als Kind gern gedichtet, um die Erwachsenen zu verblüffen, was meistens gelang, auch wenn ich oft genug statt Applaus Ohrfeigen geerntet hatte. So war ich schon früh zum Märtyrer meiner Aufrichtigkeit geworden. Die Obszönitäten machten mir trotzdem Spaß, ohne dass ich mir viel dabei dachte. Für Gedichte, wie ich sie früher geschrieben hatte, fühlte ich mich zu alt, und meinen Sehnsüchten war ich mit ihnen nicht näher gekommen. Irgendwo auf halber Strecke ging mir regelmäßig der Witz aus, dann wurde es dunkel – und die Dunkelheit machte mich unsicher. Am liebsten und ausdauerndsten sang ich Bluesballaden. Lange Trips durch dämmrige Seelenlandschaften, die keinen Anfang hatten und auch kein Ende. Alles mündete in einen Groove, auf den Verlass war, wir hatten es oft ausprobiert. Anfangen und spielend abwarten, wohin die Töne dich führen. Das geht wie beim Sex, ganz von allein. Man muss bloß das Ende hinauszögern, bis es keiner mehr aushält.
An diesem Abend war ich es, der es nicht aushielt. Der Typ in seinem Winkel nervte, umso heftiger, je mehr ich ihn zu ignorieren versuchte. Arrogant wie die meisten dieser gottverdammten Lehrer hockte er da, in seine Arbeit versunken. Keine zehn Meter vor mir kritzelte er in ein Heft und beachtete mich nicht, egal, was wir auf der Bühne trieben. Er schrieb, kritzelte, strich durch, biss in seinen Stift, schrieb weiter. Als wäre er allein auf der Welt. Schlimmstenfalls korrigierte er tatsächlich die Aufsätze seiner Schüler. Schräg hinter ihm lümmelte ein Mädchen, das meine genervten Blicke auf sich bezog. Sie antwortete darauf mit einem Lächeln, das tief aus ihr zu kommen schien. Unter ihrem zu weiten Hemd war sie nackt, das war nicht zu übersehen. Man konnte ihre Brüste erkennen, wie sie sich gegen den Stoff drückten, zu mir her. Um mich von dem Lehrer abzulenken, schenkte ich ihr einen Blick und fuhr mit einem Finger über meine Lippen. Sie griff sich zwischen die Beine und bewegte ihre Hand dort unten auf und ab. Er aber, der Lehrer, schrieb weiter in sein Heft und merkte nichts von alledem. Spürte nichts von den Wellen der Erregung zwischen hier und dort. Schrieb. Ohne Ankündigung ließ ich einen ekstatischen, langgezogenen Schrei los. Das war ein erprobtes Mittel, das Publikum aus seiner Lethargie zu reißen, diesmal mehr noch ein Notschrei, um mir Luft zu verschaffen. Ray, an den Keyboards, schien zu ahnen, was mit mir los war. Mit einem imposanten Orgelsolo, das wie ein Präludium von Bach begann und sich Takt um Takt in eine rockige Tokkata verwandelte, verschaffte er mir ein wenig Luft. Tatsächlich hob nun auch dieser Kerl seinen Kopf und warf einen Blick auf die Bühne. Einen müden Blick, der ebenso der puren Störung gelten mochte wie unserer Musik. Gleichmütig glitt dieser Blick über mich hin und wieder zurück in sein Heft, ohne anzuhalten. Aber der Ausdruck seiner Augen enthüllte mir sein Urteil. Kein Zweifel, für ihn war ich gleich null. Seine Verachtung traf mich wie ein Faustschlag, und gleich darauf fühlte ich mich wanken. So musste sich ein Boxer fühlen, wenn der Ringrichter zu zählen beginnt.
… fünf, sechs, sieben …
Mit seinem Bottleneck zog Richie zärtlich über die Saiten der Gitarre, während seine Linke das Griffbrett quälend langsam rauf und runter fuhr. Das klang wie die Klagen Verstorbener oder wie die Schreie des Totenvogels. Dann legte er plötzlich los, ließ die Anfangsakkorde meiner Lieblingsnummer explodieren. Mit ihnen begann, was, wie gewohnt, zum Hit des Abends werden sollte.
… acht, neun …
Ich wusste nicht weiter. Wankte. Der Text, den ich selbst geschrieben hatte, mein bester Text überhaupt, war wie weggeblasen, kein Wort fiel mir ein. Die Panik wuchs weiter, der Text blieb, wo er war, im Nirwana. Nach einer gefühlten Ewigkeit rettete ich mich durch einen Sprung von der Bühne. Von außen sollte es aussehen, als hätte ich einfach die Lust verloren weiterzumachen. Eine Starallüre von einem, der leider längst noch kein Star war. Während in meinem Schädel noch die Blitze zuckten, beruhigte ich mich ein wenig und meine Instinkte führten mich auf dem kürzesten Weg zur Bar zurück. Ich hatte die Nase voll von diesem Abend. Auf der Bühne war es Ray, der mich rettete. Dank seines freundschaftlichen Mitgefühls hatte er bereits den Grund meines Blackouts im Auge. Zwar wäre ihm nicht eingefallen, an meiner Stelle zu singen, aber immerhin spielte er die fehlende Gesangsstimme mit der linken Hand, während die rechte in Variationen schwelgte, als müsste das alles genau so sein. Die anderen sprangen ihm bei und warfen besorgte Blicke in meine Richtung. Dann war die Show vorbei, ohne dass sie richtig stattgefunden hatte. Der übliche Applaus, bloß ein wenig schwächer als sonst, ebbte rasch ab und verwandelte sich in das übliche Gerede, wenn das Publikum zu müde oder zu betrunken war, um noch einen klaren Gedanken fassen zu können. Ganz anders ich. Drogen aller Art dienten mir nie zur Betäubung. Im Gegenteil. Sie eröffneten Wettkämpfe zwischen meinem kritischen Kopf und den Visionen meiner Fantasie. Wenn die Funken stoben, jubelte ich. Ein Gefühl, als könnte man fliegen. Diesmal aber ging es um etwas anderes. Mir war eine peinliche Niederlage zugefügt worden, und ich wollte verhindern, dass sie das letzte Wort an diesem Abend bleiben sollte. Kampfbereit drängte ich mich durch die Menge, um ihn, den Störer, den Lehrer, den Herausforderer, herauszufordern. In Griffweite baute ich mich vor dem Typen auf und fixierte ihn, wie er in seine Arbeit versunken war. Zu meiner Verblüffung blickte er aber im nächsten Augenblick auf und lächelte mich gar nicht unfreundlich an, als wären wir schon länger miteinander bekannt. Ich schnitt ihm eine Grimasse. Er lächelte versöhnlich.
„Du trinkst zu viel! Das macht dich unsicher“, flüsterte er dann, und seine Stimme klang so sanft und freundlich, dass ich die Worte nicht gleich verstand, auch versteckte er seinen Mund beim Reden ein wenig hinter seiner vorgehaltenen Hand, als ob der dichte Rauch hier ihn zum Husten reizte.
„Gleichzeitig aber … kann auch sein, du trinkst zu wenig …“
„Was?“
„Das macht dich unsicher. Wenn schon, denn schon. Man muss aufs Ganze gehen, wenn man das Ganze will.“
Stotterte er etwa? Oder kam es mir nur so vor? In meinen Ohren redete er so umständlich wie ein Lehrer, der alles besser wissen wollte.
„Lehrer sind hier am falschen Ort zur falschen Zeit! Verstehst du das? Es genügt, wenn ihr den Kindern in der Schule das Leben vermiest.“
Jetzt schien es an ihm, überrascht zu sein. Er schwieg, ich hatte sogar den Eindruck, er schwieg betroffen. Wie um das Gespräch zu beenden, fügte er dann hinzu, dass er unseren Auftritt nicht hatte stören wollen. Mit diesen Worten wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Heft zu.
Jetzt stand ich da wie abgeblitzt. Das Mädchen im halboffenen Hemd hatte meine Annäherung bemerkt, meine Zurückweisung aber missverstanden. Aufmunternd hielt sie mir den Joint entgegen, an dem sie gerade noch hingebungsvoll gesogen hatte. In ihren Augen glänzte es feucht, und ihre Wangen färbten sich. Als hätte ich Beistand nötig, stellte sie sich an meine Seite. Die Einladung nahm ich dankend an. Der Stoff war gut, und tief sog ich den Rauch in meine Lungen. Fast augenblicklich hellte sich meine Stimmung auf, und ich beschloss, den Lehrer nicht so einfach davonkommen zu lassen.
„Wie viel ich trinke, geht dich nichts an! Außerdem trinke oder rauche ich bloß, weil ich dann die Geheimnisse der Götter besser verstehe … Aber so etwas passt sicher nicht in deinen Lehrerkopf! Stimmts?“
Das Mädchen lachte, ich war zufrieden, der Lehrer aber erhob sich und blickte mir in die Augen, als suchte er einen Grund für meine Attacke. Seine Antwort kam leise und abgehackt.
„Gar nichts verstehst du, gar nichts. Schlimmer noch, alles verstehst du – falsch.“
Eigentlich brauchte ich nur noch in das Lachen des Mädchens einzustimmen, um als Sieger davonzugehen. Einen Trumpf hatte ich noch, den spielte ich aus, um das letzte Wort zu haben.
„Die Götter versteht eben nur, wer selbst zu einem Gott werden kann!“
Da ließ er Heft und Tasche liegen, wo sie waren, und drängte sich um den Tisch und zwischen mich und das Mädchen.
„Die Götter sind stumm, stumm wie die Bäume.“
Er stotterte jetzt stärker, weil er versuchte, deutlicher zu sprechen, und wie nach einem Halt suchend, legte er mir sogar eine Hand auf die Schulter.
„Es ist die Aufgabe des Menschen, statt ihnen zu sprechen … oder zu singen …“
„Bist du von der Heilsarmee?“
„Sie sind nicht dort, wo du glaubst, deshalb wusstest du nicht weiter … dir fehlen die rechten Worte. Lass dir helfen …“
„Von dir etwa?“
Sein Gesicht war kindlich, weich und offen. Beinahe wie mein eigenes, wenn ich es manchmal unvermutet im Spiegel ertappte. Nur seine Augen wirkten hart und wie unbeteiligt, als brannte dort ein kaltes Feuer nur für ihn. So wirkte er jung und zugleich doch um vieles älter.
Das Mädchen war langsam wieder näher gekommen. Da stand sie nun, zum Greifen nah, schaute mich an und streckte mir die Arme entgegen, mit einem weichen, verheißungsvollen Lächeln.
„… von den Göttern darfst du nicht viel erwarten … und … sie sind gefährlich! Wenn du ihnen zu nahe kommst, verbrennst du! Aber gefährlich ist auch der Rausch ohne sie, in ihm ertrinkt man … Ertrinken ist noch schlimmer als verbrennen …“
Das Mädchen war in eine süße Wolke gehüllt und strahlte mich an. Der Abstand zwischen ihm und mir wuchs. Wir mussten rufen, um noch verstanden zu werden.
„Und du quatscht wie ein Lehrer, der alles weiß und dabei selbst von nichts eine Ahnung hat.“
„Aber du wusstest nicht weiter … stimmts? Dir fehlt der Text. Vielleicht kannst du dir helfen lassen …“
Das Mädchen lächelte daraufhin ein wenig nachsichtig in seine Richtung. Sie stand vor mir. Ich brauchte nur noch zuzugreifen, um die Frucht zu pflücken. Die Sache mit dem Typen war für mich zu Ende. Es reichte. In L.A. gab es zu viele Verrückte, viel mehr noch als sonst wo in diesem ohnehin durch und durch verrückten Land. Was er noch zu sagen hatte, war mir egal, es war ohnehin nicht mehr zu verstehen.
„Solche Sachen kannst du deinen Schülern erzählen, um ihnen Angst zu machen. Dafür werdet ihr doch bezahlt!“ Sekunden nach diesem Abschied wurden wir getrennt. Die Szene hatte Aufmerksamkeit erregt. Dankbar für die Abwechslung mischten sich einige ein, ergriffen meine Partei, verhöhnten den Stotternden, er riss sich los, wurde wütend, ich konnte nicht mehr hören, was er mir nachrief. Es interessierte mich auch nicht mehr. Das Mädchen mit den verlockenden Blicken und dem langen braunen Haar stand nun allein vor mir. Ihre Anwesenheit war eine unwiderstehliche Einladung. Überdies trug sie jetzt einen Blütenkranz im Haar. Ein wahrer, ein leibgewordener Traum von einem Blumenmädchen. Ihr Hemd klaffte weit auf und ihre Brüste sahen warm und fest zu mir her. Ihr Gesicht war mit feinen, blassen Sommersprossen getupft, die mich wie eine frische Wiese einluden, auf ihr zu liegen. Zart wie ein Schmetterlingsflügel berührte sie meine Hand und führte mich vorbei an den anderen. Wie von selbst schien sich eine Gasse für uns zu öffnen. Durch diese schritten wir aus dem London Fog. Später, bei ihr Zuhause, stürzten wir in einen Wirbel, wie ihn nur die Körper zweier junger Menschen erschaffen konnten, denen die Lust alle Fesseln gelöst hat.
Währenddessen war es Ray, der sich auf seine Art um den Fremden kümmerte. Wieder einmal erwies er sich als echter Freund – und überdies als der Einzige, der mich, wenn es nötig war, auch vor mir selbst beschützte. Von fern hatte er die Szene beobachtet, und die Erscheinung des Lehrers hatte ihn eher neugierig gemacht als irritiert. Er entschloss sich, diesen ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Zunächst blätterte er flüchtig in dem auf dem Tisch zurückgelassenen Heft. Was er dort in der Schnelle entziffern konnte, war zwar kaum zu verstehen, blieb aber doch auch merkwürdig genug, seine Neugier weiter zu steigern. Mit seinem coolen Charme animierte er den Menschen, der zuletzt verstört und von der Menge verlassen alleingeblieben war, zum Erzählen. Ray besorgte die richtigen Getränke, drehte verführerische Joints. Dankbar trank und rauchte der Fremde, was man ihm anbot, und sprang dabei von einem zum anderen. Immer ein wenig stotternd entwarf er Visionen einer besseren Welt, die verlässlich käme, wenn die Menschen es gemeinsam wirklich wollten. Dazu bedürfte es einer neuen Sprache, welche die Dinge beim Namen nannte. Auch von Göttern sprach er dies und das. Ihnen seine Stimme zu leihen, darum ging es, in allem, was er tat. Oft hatte Ray Mühe, seinen Gedanken zu folgen, obwohl er selber anfällig war für solche Ausflüge ins Unerklärliche und Fragwürdige. Das Geheimnisvolle und Unerklärliche des Lebens war einer der wichtigsten Gründe, aus denen er so unendlich in die Musik verliebt war. In ihr war zu hören, was unausgesprochen in uns allen lebte. Die Musik konnte sagen, was sie wollte – wenn sie gute Musik war, gab Ray ihr stets recht. Ray schwärmte von der Musik, der Fremde von der Sprache. So waren die beiden sich einig. Wenn ein Außenstehender ihr Gespräch verfolgt hätte, würde er sie für Kampfgenossen gehalten haben.
Auf der Bühne versuchte bereits eine andere Band mit hingehämmerten Songs ohne jede Melodie die Reste der Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es klang wie in einer Maschinenhalle. Alleingebliebene Mädchen wiegten sich dennoch in ihren Träumereien, und das London Fog versank Glas um Glas und Zug um Zug in der dumpfen Bewusstlosigkeit später Stunden, in die sich viele so gern fallen lassen, um nicht mehr selbst denken zu müssen. Aber da hatte Ray den von der eigenen Begeisterung Erschöpften schon in ein kleines Hotel gebracht, ihm ein Zimmer für die Nacht bezahlt und ihm überdies ein wenig Geld in die Hosentasche gesteckt. Jenes Heft und einige lose Blätter, die achtlos auf dem Tisch liegen geblieben waren, nahm Ray dafür ohne schlechtes Gewissen an sich. Der Lehrer würde am nächsten Tag ohnehin alles vergessen haben, dachte er, um sich darüber zu beruhigen. Tatsächlich war jener aber schon vor Anbruch dieses nächsten Tages spurlos aus dem Hotel verschwunden. Wir bekamen ihn lange nicht mehr zu sehen.
So war der Anfang von allem, was geschehen sollte. Wenn mir in dieser Nacht jemand gesagt hätte, dass wir ein Jahr später eine Kultband sein würden, der weltweit die Massen zujubelten, wäre ich der Länge nach hingefallen vor Lachen. Und doch wäre es zugleich ein triumphierendes Lachen gewesen, das nur meine geheimsten Erwartungen bestätigt hätte. Alles andere aber, was mir sonst noch widerfahren sollte, lag in jenen Tagen ganz und gar außerhalb des Denkbaren. Nichts davon hätte ich mir vorzustellen vermocht, nichts von dem, was in künftigen Tagen alles allzu wirklich eintreffen sollte.
Das in dieser Nacht entfesselte Gewitter hatte das Bild des Stotterers mit ungestümer Hand hinweggefegt. Als ich am späten Vormittag neben dem Mädchen mit den Sommersprossen erwachte, war mein erster und einziger Gedanke, dass ich sie niemals wieder verlassen wollte. Und trotz allem, was passieren musste, hatte dieses Gefühl mich nicht getäuscht. Später, während ich mit verliebten Ohren lauschte, wie sie in ihrer kleinen Kochnische den Kaffee für uns beide zubereitete, erschien jedoch vor meinen Augen das Gesicht dieses Fremden wieder. Sekunden danach wusste ich auch, was genau an ihm mich so irritiert hatte. Es war der Ausdruck seines Gesichts, den ich wiedererkannt hatte. Aus weiter Ferne war er in diesem Moment in mir aufgetaucht. Als Jugendlicher hatte ich oft Bücher gekauft, alte und neue. Es war meine Leidenschaft gewesen, übrigens die Einzige, gegen die mein Vater keine Einwände vorbrachte. Eines dieser Bücher hatte auf dem Cover das gezeichnete Porträt eines mir unbekannten Dichters gezeigt, der genau hundert Jahre vor meiner Geburt gestorben war. Aus diesem Grund hatte ich es erworben. Von den Gedichten selbst verstand ich kein Wort, sie waren alle auf Deutsch geschrieben. Aber den Namen des Dichters hatte ich mir gemerkt, weil er so seltsam klang. Hölderlin. Einige Monate lang war dieses Buch auf meinem Schreibtisch gelegen und hatte mich angesehen. Irgendwann war es verschwunden. Verlegt, verloren, was weiß ich. Der Ausdruck dieses Gesichtes aber blieb in mir haften, fremd und streng. Wie ein Freund, oder ein Lehrer eben, wie ich noch nie einen gehabt hatte. Noch Tage nach dem missglückten Auftritt im Fog verfolgte ich in Gedanken seine Spur. Ich schlug sogar in einem Lexikon nach und erfuhr, dass dieser Hölderlin tatsächlich ein einst berühmter, jetzt aber fast vergessener Dichter war, der die zweite Hälfte seines Lebens, fast sechsunddreißig Jahre lang, angeblich geistig umnachtet, in einem Turm verbracht hatte. Nie allerdings hatte er damit aufgehört, eigensinnige und merkwürdige Gedichte zu schreiben.
Als der Fremde nach wirren Träumen jäh hochschreckte, herrschte vor den Fenstern des fremden Hotels noch Nacht. Es dauerte, bis er gänzlich zu sich kam, dann aber schlich er sich eilig wie ein Dieb aus dem Haus und atmete erleichtert auf, als er an der leeren, von einer funzeligen Leuchte erhellten Portiersloge vorbei war – ohne zu ahnen, dass er es war, den man bestohlen hatte. Die letzte Nacht lag als dunkle Wand hinter ihm, fremde Schatten tanzten dort. Worte, die er selbst gesprochen hatte, umkreisten ihn wie ein Vogelschwarm. So schlich er an fremden Häusern entlang, einer bloß ungefähr erahnten Richtung folgend nach Hause. Dieses vorläufige Zuhause lag eine Stunde Fußweg entfernt, am Rande der Stadt, am Beginn eines öden Brachlandes, und bestand aus einer versteckten Kammer unter dem Treppenaufgang eines unbewohnten Hauses. Einer der Vorgänger dort hatte ihm den Tipp gegeben, bevor er selbst irgendwohin verschwunden war.
Angekommen, nahm er vor einer zum Tisch umfunktionierten Kiste Platz, todmüde wie er war, um einen Brief fertig zu schreiben, den er tags zuvor nicht vollendet hatte, weil ihn Unruhe und Einsamkeit hinaus und zu fremden Menschen getrieben hatten. Nach wenigen Zeilen schon schlief er ein und erwachte erst wieder, als die Sonne durch ein schmales Fenster einen harten Lichtbalken auf seinen ohnehin schmerzenden Kopf warf. Er nahm die Schmerzen wie eine Strafe, beendete mit knappen Worten den Brief, auf den er seine vielleicht letzte Hoffnung setzte, steckte ihn ein und machte sich auf den Weg. Beim Weggehen fiel ihm ein, dass die Amerikaner einen zum Tode verurteilten Mann Dead Man Walking nannten.
So wanderte er durch die trostlosen Randgebiete dieser Stadt, die so riesig war, wie bei ihm zu Hause ein ganzes Land. Ihre lärmende Aura reichte bis zu ihm hin und schenkte ihm das Gefühl, irgendwie dazuzugehören. Hätte ihn jemand tatsächlich beobachtet, wäre er schnell als der Fremde erkannt worden, der er war. Immer wieder blieb er stehen, von Alltäglichkeiten angezogen, die den Einheimischen nicht mehr auffielen. Manchmal stand er staunend vor den Geschäften mit den schreienden Auslagen. Oder aus einer Kirche drang der Gesang einer Gottesdienst feiernden Gemeinde, der viel unbeschwerter klang als in seiner Heimat. Dann wartete er lauschend ab. Nach solchen Unterbrechungen wirkte er unruhig, wie einer, der noch sehr viel zu erledigen hatte. Hastig marschierte er die belebte, traurig bunte Straße entlang auf sein Ziel zu. Fußgänger gab es in dieser Gegend kaum. Wer es sich leisten konnte, fuhr mit dem Auto. Die Straßen waren so breit, dass noch zehnmal mehr Autos auf ihnen hätten fahren können. Wer selbst keines besaß, zählte nicht. Diese Leute, die nicht zählten, erkannte man auch daran, dass sie mit übertriebener Fröhlichkeit und kindlichem Mutwillen ihre Erbärmlichkeit überspielten.
Entlang seines Wegs gab es zwei Verkehrsampeln, die wie zum Trotz immer auf Rot standen, wenn er bei ihnen ankam. Er wartete das Grün ab, obwohl sich weder von links noch von rechts Fahrzeuge näherten. Einige Straßen weiter führte sein Weg an einer öffentlichen Schule vorbei. Vormittags war dort das Lachen und Rufen ausgelassener Kinder aus offenen Fenstern zu hören, dann beschleunigte er seine Schritte oder bog schon zwei Querstraßen früher ab, nahm einen Umweg in Kauf, den er sonst scheute wegen der vielen freilaufenden Hunde, um die sich niemand kümmerte. Mit einem dieser halbwilden Tiere verband ihn eine innige Feindschaft. Wenn der Hund ihn wahrnahm, stoppte er mitten im Lauf, die Nackenhaare sträubten sich, die Rute stand fast waagrecht nach hinten ab. Alles verriet seine Bereitschaft zum Angriff, und aus seinem Inneren kroch ein dumpfes Knurren heraus, das beständig lauter und böser wurde. Auch der Fremde blieb stehen, minutenlang Aug in Aug mit dem Tier, bevor er, als hätte er nie anderes vorgehabt, die Straßenseite wechselte. Der Hund durfte sich als Sieger fühlen, war zufrieden und trollte sich, vom Hunger getrieben oder einem anderen Widersacher entgegen.
Als der Stadtwanderer nach bestandener Mutprobe die Hände in die Hosentaschen steckte, fand er dort ein paar Geldscheine, die tags zuvor nicht dagewesen waren. Ungläubig betrachtete er den kleinen Schatz. Ein Geschenk des Himmels, über das er nicht weiter nachdenken wollte.
An der zweiten Ampel, schon etwas über der Hälfte seines Weges zum Postamt, wartete ein Zeitungsverkäufer auf Kundschaft. Ohne dass sie je viele Worte gewechselt hatten, bloß durch den Austausch freundlichen Lächelns, waren die beiden Außenseiter zu Freunden geworden. So durfte der Stadtwanderer gratis die ausgelegten Zeitungen lesen. Diesmal aber hielt er dem Verkäufer, ohne einen Blick auf die Zeitungen zu werfen, einen Dollarschein entgegen, wünschte dem Verblüfften einen erfolgreichen Tag und wanderte weiter. Diesen Weg entlang der äußeren Grenze der Stadt, von seinem brüchigen Wohnort zum Postoffice und wieder retour, unternahm er an manchen Tagen, wenn die Neugierde zu heftig wurde, sogar zweimal. Am Schalter, wo man ihn längst kannte, brauchte er nach Post für sich gar nicht zu fragen, die Antwort war an den mitfühlenden Gesichtern abzulesen. Die Frau hinter der Scheibe schob dann ihren Kaugummi von einer Backe in die andere, als wäre seine Enttäuschung auch die ihre. Dann wusste er, was los war, oder eben nicht los war, nickte und drehte wieder um. Sie kaute dann weiter und vertröstete ihn auf morgen.
„Maybe tomorrow! Okay? Good guy, see you!“
Die Trostworte, die sie ihm hinterherschickte, klangen wie der Refrain eines Blues, sie erleichterten seinen Heimweg. Diesmal aber kehrte er nicht gleich um, sondern legte den Brief auf den Tresen, den er am Morgen geschrieben hatte. Die Schwarze nahm es als Zeichen, dass er neue Hoffnungen hegte, und freute sich für ihn. Zum verlangten Porto schob er ihr ein Trinkgeld durch die Öffnung der Glasscheibe zu.
„Big fat blessing!“
Mit gespitzten Lippen spuckte sie dreimal auf das Kuvert, um dem Schreiben ihre Glück- und Segenswünsche mit auf den Weg zu geben.
Langsamer wanderte er auf Umwegen heimwärts, oft stundenlang. Zuhause erwartete ihn nichts, auf das er sich hätte freuen können. In der Dämmerung kreuzte er einen Straßenmarkt, der sich gerade auflöste. Hier bot sich ein kleines Schauspiel, das sich der Wanderer selten entgehen ließ. Lieferwägen rauschten hinweg, beladen mit dem, was vom Tage übrig war. Oft lagen ein paar hübsche Früchte auf der Straße, von denen er die hübschesten jeweils aufsammelte. So auch dieses Mal. Während der volle Mond wie ein kahlgeräumtes Ebenbild unserer Erde sich über die bunt blinkenden Reklameschilder der Vorstadt hob, während von irgendwoher ein paar stille Kirchenglocken tönten, die Nacht dem Himmel sein Blau nahm und die ersten Trunkenen bereits ihre Lieder grölten, stand der Wanderer still. Versonnen kaute er an einem rotbackigen Apfel, dessen einziger Makel aus einem kleinen, braunen Fleck bestand.
Die Unruhe, die von jenem Abend im Fog in mir zurückgeblieben war, trieb mich Wochen später an den Strand von Venice hinaus. Früher, als Student, hatte ich dort viele Nächte unter freiem Himmel verbracht. Hatte der beharrlich murmelnden Stimme des Meeres gelauscht, und versucht, seine Verheißungen zu entziffern. Wer sich diesem Rauschen hinzugeben vermag, braucht keinen anderen Stoff, um high zu sein. Das Meer mit seiner mal wilden, mal sanften Macht spielt mit den Kräften der Wirklichkeit, als wären diese nichts als kleine Kiesel, nichts als der Sand, mit dem sich alles bauen lässt, was man sich erträumt. Und alle Sinne spielen mit. Früher ließ ich sie oft frei schalten und walten – und wurde immer aufs Neue beschenkt. Solange wir bloß rechnen und planen, bleiben Augen und Ohren, bleibt unser Geist betäubt und nachlässig. Dann fertigen uns die Schatten der Wirklichkeit ab, als wären sie schon alles, was es zu erleben und zu erkennen gibt, und die Pracht, die in ihnen verborgen ist, wartet vergeblich auf unsere Freude. Als ich an diesem Tag wieder die Stimmen des Meeres vernahm, war ich mir sicher, dass sie es waren, die mich hierher gerufen hatten.
Diese Stelle, der Strand von Venice, ist geografisch tatsächlich der äußerste Vorposten der westlichen Welt. Wer von dort einst über den Ozean hinaus schaute, nach Osten hin, hätte diesen einzigartigen, ursprünglichen Menschheitstraum hinter sich spüren können, wie eine Vergangenheit, deren Bild nun immer schwächer wurde. Wo war die Kraft geblieben, aus der heraus der Westen, wenn er es denn wollte, heute noch seine Hoffnungen schöpfen könnte? Zweieinhalbtausend Jahre zuvor war dieser Traum im alten Griechenland geboren worden. Ein Traum aus Kunst, Musik und Sprache, mit dem Inhalt, dass der Mensch denkend lernen könnte, mit anderen Menschen zu leben und gemeinsam weiterzukommen. Aus Griechenland war diese Vision später weiter nach Westen gewandert, über Italiens Rom nach ganz Europa, hatte Religionen begründet, Staaten befruchtet, ungeheure Werke geschaffen – und war vor ein paar Jahrhunderten bis nach Amerika gekommen, um auch dieses wilde Land zu zivilisieren und zu einem Hort der Freiheit zu machen. Viele Menschen hatten auf diese Hoffnung gesetzt, Menschen aus der alten Welt waren in die USA gekommen, weil sie an die Kraft jenes Traumes glauben wollten.
The west
Is the best
Is the best
Is the best
Die Stimmen des Meeres klangen nach Ironie. Bis zum Überdruss wiederholten sie diesen Vers, der zur Lüge geworden war, als sollte ich genau das endlich begreifen. Was war unter den Händen unserer Väter aus diesem Traum vom Westen geworden? Was konnte er noch bewirken? Hatte sich die Welt von ihren Träumen abgekehrt? Hinter dem Stillen Ozean lag der Osten. Lagen China, Indien, Japan, mit vielen Geheimnissen. Was hatte der Westen ihnen heute entgegenzuhalten? Aber waren wir nicht alle jung genug, um unsere eigene Zukunft selbst zu gestalten? Wir durften es einfach nicht hinnehmen, dass unsere kühnsten Gedanken, unsere Utopien, für immer hinter uns, im längst Vergangenen, liegen blieben.
Hier, genau an dieser Stelle, wo die Landschaft selbst das Ende des Westens anzeigte, wo es sichtbar und hörbar war, hatten Ray und ich vor einigen Monaten die Idee der „Doors“ ins Leben gerufen. Damals waren wir nur zu zweit gewesen und hatten nicht gewusst, wohin mit uns. Einer war allein, aber zwei, die waren schon fast eine neue Menschheit! So dachten wir, so riefen wir es dem Rauschen des Meeres entgegen. Ohne dass wir es schon mit diesen Worten sagen hätten können, war die Band als Antwort auf diese Frage gemeint, wie dieser Traum zu neuem Leben erweckt werden könnte. Und in der Hoffnung, ihn neu zu erschaffen und ihn mit unserer Musik zu beleben, wollten wir die Größten werden. Mussten wir die Größten werden. Dann bräuchte das alles gar kein Traum mehr sein, sondern die Wirklichkeit für alle, die bereit waren, sie zusammen mit uns zu erkämpfen.
Ray und ich hatten uns damals erst flüchtig von der Universität her gekannt. Möglicherweise nur deshalb hatte ich den Mut, ihm eines meiner Gedichte vorzutragen, von denen ich früher mehr geschrieben hatte, ohne zu wissen, wozu. Er hatte wie elektrisiert gelauscht und immer nach mehr verlangt. Ich hatte die Worte wiederholen müssen, und bald begann er, einen Rhythmus in den Sand zu klopfen. Aus dem Rhythmus wiederum entstand in mir eine Melodie, wie von allein, und ich sang nun die Worte, statt sie zu sprechen. Und wieder ein paar Zeilen später lagen wir uns in den Armen, weinten und tanzten. Und ab da waren wir auf dem Weg. Auf unserem Weg.