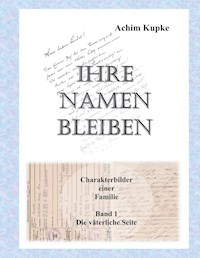
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Achim Kupke wurde im Februar 1945 im Raum Berlin geboren, inmitten des Kriegsgeschehens am Ende des Zweiten Weltkrieges. Er hat den größten Teil seiner väterlichen Familie nie bewusst kennengelernt. Die große Medizinerfamilie war durch Kriegseinwirkungen oder Krankheiten bereits Mitte der 1950er Jahre verstorben. Ihm verblieb nur ein Koffer, voll mit Hunderten von Dokumenten. Intensive genealogische Nachforschungen eröffneten ein Bild seiner Herkunft, zu der er die meisten Familienmitglieder nie befragen konnte. Aus den vielen Briefen, Fotografien, Urkunden und Dokumenten zeichnet er Charakterbilder einzelner Personen dieser väterlichen Familie nach. Die Lebenswege dieser Personen ergeben oft ein filigranes Bild der Zeitgeschichte. Wie lebt im 19. Jahrhundert eine Frau mit unehelichen Kindern? Wie lebt und forscht ein berühmter Anatomie-Professor? Wie gehen Väter in den Ersten Weltkrieg? Wie erleben Jugendliche den Zweiten Weltkrieg? Wie erträgt man das Kriegsende 1945? Wie schafft man den Neuanfang in Berlin zur Zeit der Blockade und in den frühen 1950er Jahren? Wie unterschiedlich verläuft dagegen ein Lebenslauf in den letzten Jahrzehnten? Respekt, historische Einordnung, liebevolles Betrachten und auch die Akzeptanz, nicht leichtfertig urteilen zu dürfen, prägen seine zum Teil erschütternden Darstellungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Stammbaum-Ausschnitt
Kapitel 1
Friedrich Wilhelm Theodor Kopsch
Die Entwicklung des braunen Grasfrosches
Kapitel 2
Willibald Henry Alexander Kupke
Die Forschung nach den eigenen Wurzeln
Kapitel 3
Wilhelmine Maria Charlotte Kopsch, geb. Kupke
Eine geschundene Seele
Kapitel 4
Erwin Alexander Hans-Heinz Kupke
Die entgangene Zukunft
Kapitel 5
Hans-Joachim Kupke
Eine Sicht von außen
Vorwort
„Nomen est omen“ (PLAUTUS, UM 250–184 V. CHR.):
Das Wesen eines Menschen liegt in seinem Namen, er gibt dem Menschen Bedeutung, der Name ist ein Zeichen.
„Ein guter Name ist mehr wert als Reichtum“ (MIGUEL DE CERVANTES, 1547-1616):
Ein guter Name öffnet Türen und schafft Vertrauen und Anerkennung.
Wer seinen guten Namen verliert, verarmt seelisch, er ist gesellschaftlich isoliert.
„Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.“ (DIE BIBEL, AT, JESAJA, KAP.43):
‚du bist mein’ ist kein Besitzanspruch, sondern ein Schutzversprechen. Wir können nicht verwechselt werden. Und wenn Gott mich ‚bei meinem Namen’ ruft, dann ist das eindeutig. Er ruft nicht ‚den Vierten von rechts’, sondern er meint mich. Es tut gut, wenn uns jemand beim Namen ruft.
Ein überfüllter Raum, eine Feier mit zahllosen Gästen, lauter unbekannte Gesichter - dann tut es gut, einen Bekannten zu entdecken, der mich mit meinem Namen anspricht. Der mir das Gefühl gibt, nicht allein unter Fremden zu sein.
Die Kenntnis des Namens schafft Beziehung. Wenn ich etwas beim Namen nennen kann, so ist es mir vertraut, ich kenne es und es verliert einen Teil seiner Bedrohlichkeit. Nicht umsonst reden wir vom "namenlosen Entsetzen", einer Gefahr, die so bedrohlich ist, dass wir ihr keinen Namen geben können. Im Märchen vom Rumpelstilzchen ist der Schrecken mit dem Moment gebannt, wo er beim Namen genannt wird, das Böse zerstört sich anschließend selbst.
Mit diesem Buch möchte ich einigen verstorbenen Personen ihren Namen erhalten, um sie vor Namenlosigkeit und damit dem Vergessen zu bewahren. Es sind alles Menschen aus meiner Familie, die einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen haben, und die mich sicherlich auch unterschiedlich stark prägten.
Dieser Gedanke entwickelte sich kurz nach dem Tod meiner Mutter im Jahr 2005.
Ich besaß bereits viele Bilder, Urkunden und Dokumente aus meiner Familie und nun bekam ich aus dem Nachlass erneut viele interessante und mir teilweise unbekannte Papiere. Darunter auch umfangreiche Briefwechsel und sogar zwei Tagebücher. Mir wurde nun erst nachdrücklich bewusst, dass ich als Letzter meiner Familie übriggeblieben war. Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, … niemand war mehr da! Geschwister hatte ich nicht. Es gab und gibt noch einige entfernte Verwandte, zu denen aber kaum Kontakt besteht.
Und es gibt meinen Sohn, der als Adoptivkind nur wenige Jahre in der Familie lebte. Für ihn werden diese Aufzeichnungen die einzige Quelle sein, diese Zeit zu verstehen.
Als junger Mann war mein Blick in die Zukunft gerichtet und aktuelle gesellschaftliche Fragen bestimmten mein Denken und Handeln. Die familiäre Geschichte war mir nicht sehr wichtig. Natürlich habe ich meine Verwandtschaft geliebt und teils bewundert. Ich habe auch aus ihrem Leben viele Erzählungen mit Spannung gehört und behalten. Aber ich habe sie nur selten über ihre Zeit befragt. Als typischer Vertreter der ersten Nachkriegsgeneration tat man das auch nicht. Wenn es dann trotzdem einmal dazu kam, waren die Antworten kurz, oft ausweichend und wenig konkret. Kritisches Nachfragen wurde erst gesellschaftlich relevant, als meine älteren Verwandten schon nicht mehr lebten. Hätte ich doch früher mal nachgefragt!
Heute merke ich, dass meine Gedanken immer wieder in die eigene Geschichte fliegen. Mein Interesse für Zeitgeschichte und politische Zusammenhänge hat sich erst entwickeln müssen. Nun habe ich Zeit und Interesse für die Geschichte meiner Familie, aber leider kann ich heute niemanden mehr fragen. Also muss ich aus alten Briefen, Aufzeichnungen und Urkunden genealogische Forschung betreiben und es ergibt sich aus einzelnen Mosaiksteinchen langsam ein Bild.
Was wird also aus den Lebenswegen der Menschen, wenn sie nicht mehr erzählt werden können? Geraten die Geschichte und die Geschichten dieser Menschen in Vergessenheit?
Werden sie mit meinem Tod zu Namenlosen, für die sich niemand mehr interessiert?
Dieses Buch ist keine Familienbiografie. Ich werde über einzelne Personen berichten, ihre Beziehung zueinander auch durch umfangreiche Briefwechsel aufzeigen, ihre Charaktere anhand von Dokumenten und Bildern beschreiben und ihren Stellenwert für mein Leben würdigen. Ich will das Fühlen, Denken und Handeln meiner Vorfahren verstehen.
Ich will ihre Namen bewahren, denn ihre Namen machen sie zu dem,
was auf vielen Grabsteinen steht:
‚UNVERGESSEN’.
Friedrich Wilhelm Theodor Kopsch
Kapitel 1
Die Entwicklung des braunen Grasfrosches
1952 erschien im Georg Thieme Verlag (Stuttgart) das wissenschaftliche Werk: „Die Entwicklung des braunen Grasfrosches“ von Prof. Dr. Friedrich Kopsch. Es ist das letzte Werk von Friedrich Kopsch, der drei Jahre später, am 24.1.1955 im Alter von 86 Jahren verstarb.
ABB.1 HANDEXEMPLAR
Das Handexemplar des Buches ist im Innendeckel beklebt mit 16 Ausschnitten aus verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften mit Hinweisen und Rezensionen. Fachblätter u.a. aus Italien, Brasilien, Japan, USA und der Schweiz berichten über eine bemerkenswerte Forschungsarbeit aus dem Bereich der Entwicklungsgeschichte der Wirbeltiere.
ABB. 2 INNENSEITE MIT BUCHREZENSIONEN
In dem Handexemplar befindet sich weiterhin ein fachwissenschaftlicher Schriftwechsel zwischen Friedrich Kopsch und Wolfgang Eilers. Der Briefwechsel begann im Dezember 1953 und endete im Oktober 1954, also kurz vor dem Tod von Friedrich Kopsch.
Wolfgang Eilers war „cand. rer. nat. am Zoologischen Institut der Technischen Hochschule Stuttgart“, also Doktorand der Naturwissenschaften; während Friedrich Kopsch „Ordentlicher Professor der Anatomie (i.R.), weiland II. Direktor des anatomischen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin“ war.
Dieser Standesunterschied zeigt sich in den formalen Aspekten der Briefe. Über das Jahr hin beginnt Eilers seine neun Briefe immer mit: „Hochverehrter Herr Professor“ und endet immer : „ ...mit vorzüglicher Hochachtung Ihr sehr ergebener... “. Friedrich Kopsch antwortet immer schnell innerhalb von höchstens zwei Tagen: „Sehr geehrter Herr Eilers“ und endet anfangs grußlos mit „Fr. Kopsch“, später mit „Hochachtungsvoll, Fr. Kopsch“ in den letzten Briefen schon deutlich persönlicher durch „mit besten Grüßen, Fr. Kopsch“.
Beide schreiben ihre Briefe mit der Maschine. Kopsch macht sich in den Briefen von Eilers handschriftliche Notizen.
Inhaltlich ist dieser Briefwechsel von gegenseitigem Respekt und wechselseitigem Interesse geprägt, trägt nie belehrende, sondern immer neugierige Züge. Einige interessante Details sollen den Alltag in Berlin 1954, sowie die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Forschung beschreiben:
Eilers schreibt am 5.12.1953:
„[...] Ich möchte Ihnen, sehr verehrter Herr Professor hiermit zum Ausdruck bringen, wie sehr ich von Ihrem hervorragenden Werk beeindruckt bin und welch großen Nutzen es mir gebracht hat, [...]. Zu großem Dank wäre ich Ihnen verpflichtet, wenn Sie bei Ihrer reichhaltigen Erfahrung die Güte hätten, mir ergänzend zu Ihren bisherigen Veröffentlichungen und meinen bescheidenen Erfahrungen einiges persönlich mitzuteilen. [...]“
ABB. 3 AUSSCHNITT BRIEF 1 EILERS AN KOPSCH
Kopsch antwortet am 22.12.1953:
„[...] Ihren Brief vom 5. Dezember erhielt ich soeben. [...] den Abdruck eines Datumstempels und zwar vom 10. Dezember. Entweder hat die Sekretärin des Instituts sich so lange Zeit gelassen, mir den Brief zuzusenden oder die Ostpost ist so langweilig gewesen. Jedenfalls besteht die Tatsache, dass Ihr Brief beinahe drei Wochen gebraucht hat, um mich zu erreichen. Ich sende meine ganze Post, die in die Westzone geht, durch Luftpost und empfehle Ihnen auch diesen Weg, wenn Sie mir schreiben. Man vermeidet dadurch die Post der Ostzone und damit größere Verzögerungen. Ich vermute, dass häufig die Westkorrespondenz geöffnet wird und dadurch eine Verzögerung erleidet. [...]“
Eilers, 15.1.1954:
„[...] Haben Sie eventuell Beziehungen nach den USA wegen der Beschaffung von Rana pipiens? Der Transport kommt ja nur mit Luftpost in Frage und ist relativ erschwinglich. Dagegen verlangen hiesige Herpetologen für einen von USA besorgten Frosch den horrenden Preis von DM 12 bis 15.- , obwohl Rana pipiens meines Wissens ebenso häufig ist wie unsere einheimischen Frösche. [...]“
Kopsch, 18.1.1954:
„[...] Beziehungen zu USA, die ich für den Bezug dieser Frösche benutzen könnte, habe ich nicht mehr. Ich bin aber überzeugt davon, dass Herr Rugh Ihnen Tiere schicken wird, wenn Sie ihm schreiben. R. Rugh, Ph. D. Associate Professor of Radiology (Biology) Department of Radiology, Columbia University. [...] Ich selber habe fast ausschließlich frisch gefangene Tiere verwendet. Zwischen 1892 bis 1900 kostete ein Froschpärchen in Berlin etwa 25 Pfennige. Im vergangenen Jahr musste ich 2,00 DM je Pärchen bezahlen, bei Abnahme von 10 Pärchen. [...]“
ABB. 4 AUSSCHNITT BRIEF 6 KOPSCH AN EILERS
Eilers, 22.1.1954:
„[...] Ein besonderes Problem innerhalb meiner Arbeit war die Blutentnahme bei Kaulquappen, besonders bei niederen Stufen. Die Methode der Herzpunktion gelingt mittels einer Glaskapillare nur bei älteren Stadien [...]. [...] bei erwachsenen Fröschen gewinne ich Blut aus der Zunge. [...]“
Kopsch, 24.1.1954:
„[...] Für die Blutentnahme nehmen Sie vielleicht besser eine Stahlnadel. Es gibt deren sehr feine zur subcutanen Injektion beim Menschen. Wenn Sie mit einer binokularen Lupe sich bewaffnen, könnte es Ihnen gelingen in die große Schwanzvene zu kommen. [...]“
~
Friedrich Kopsch wurde am 24. März 1868 in Saarbrücken geboren. Ab 1888 studierte er Medizin an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, die seit 1949 den heutigen Namen Humboldt-Universität Berlin trägt.
ABB. 5 IMMATRIKULATIONSURKUNDE 1888
ABB. 6 VEREIDIGUNGSURKUNDE 1888
Er war Schüler von Wilhelm Waldeyer und Hans Virchow, bei dem er 1892 promovierte. Die Dissertation mit dem Titel „Iris und corpus ciliare des Reptilienauges nebst Bemerkungen über einige andere Augentheile“ schloss er mit „Summa cum Laude“.
Er wurde Assistent beim Direktor des 2. Anatomischen Instituts Oskar Hertwig, wechselte an das 1. Anatomische Institut zu Wilhelm Waldeyer, habilitierte sich 1898 dort für Anatomie und wurde Privatdozent. 1908 wurde er Titularprofessor und blieb der Berliner Anatomie zunächst als zweiter und erster Prosektor, dann als außerordentlicher Professor über alle Jahre treu. 1935 wurde er zum Ordentlichen Professor für Histologie, Embryologie und Anatomie berufen. Er wurde 1936 emeritiert, war aber weiterhin in der Forschung und als Autor tätig.
Nach dem Tod von Friedrich Kopsch am 24.1.1955 erscheint in einem Sonderdruck der Deutschen Medizinischen Wochenschrift ein Nachruf von H. Becher:
„[...] In seinem großen Wirkungskreis hat Friedrich Kopsch mehr als 30 000 Studierende mit dem Bau des menschlichen Körpers vertraut gemacht. [...] Diese Zahl wird ungleich größer, wenn man diejenigen Studierenden an den deutschen und außerdeutschen Universitäten hinzuzählt, die durch die Benutzung seines Lehrbuches und Atlas der Anatomie des Menschen zu seinen Schülern geworden sind. Friedrich Kopsch hatte nach dem Tode von August Rauber (1917) die 7. Auflage dieses weit verbreiteten Lehrbuchs übernommen, völlig umgearbeitet und neu herausgegeben.
Von Auflage zu Auflage hat Friedrich Kopsch an der Vervollkommnung des Buches, seiner Abbildungen und des Textes unermüdlich gearbeitet, [...]. Friedrich Kopsch ist durch das Werk „Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen“ unter den Medizinern geradezu weltbekannt geworden, und wenn gelegentlich sein Name in Kreisen fiel, die ihn persönlich nicht kannten, erfolgte die beziehungsuchende Frage: ist das der „Rauber-Kopsch“? So sehr war ihm die Autorengemeinschaft zum Zwillingsnamen geworden.“ 1
Kurz vor seinem Tod konnte die 18. Auflage dieses Standardwerks der Anatomie im Thieme-Verlag erscheinen.
ABB. 7 RAUBER-KOPSCH, 18. AUFLAGE
ABB. 8 INNENSEITE MIT KORREKTUR-NOTIZEN
Hinter seiner Bedeutung als Lehrbuchverfasser tritt seine wissenschaftliche Tätigkeit zu Unrecht etwas in den Hintergrund. Die meisten Forschungsarbeiten befassten sich mit der experimentellen Entwicklungsmechanik der verschiedensten Tierarten.
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: U
NTERSUCHUNGEN ÜBER
G
ASTRULATION AND
E
MBRYOBILDUNG BEI DEN
C
HORDATEN
. G
EORG
T
HIEME
V
ERLAG
, 1904
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: D
IE
D
ARSTELLUNG DES
B
INNENNETZES IN SPINALEN
G
ANGLIENZELLEN UND ANDEREN
K
ÖRPERZELLEN MITTELS
O
SMIUMSÄURE
. 1902
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: D
IE
T
HROMBOCYTEN
(B
LUTPLÄTTCHEN
)
DES
M
ENSCHENBLUTES UND IHRE
V
ERÄNDERUNGEN BEI DER
B
LUTGERINNUNG
. 1901
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: A
RT
, O
RT UND
Z
EIT DER
E
NTSTEHUNG DES
D
OTTERSACHENTOBLASTS BEI VERSCHIEDENEN
K
NOCHENFISCHARTEN
. 1902
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: D
IE
N
OMINA ANATOMICA DES
J
AHRES
1895. G
EORG
T
HIEME
V
ERLAG
, 1941
F
RIEDRICH
K
OPSCH
: D
IE
E
NTSTEHUNG VON
G
RANULATIONSGESCHWÜLSTEN UND
A
DENOMEN
, K
ARZINOM
,
UND
S
ARKOM DURCH DIE
L
ARVE DER
N
EMATODE
R
HABDITIS PELLIO
: E
IN
B
EITRAG ZU DEN
B
EDINGUNGEN DER
E
NTSTEHUNG ECHTER
G
ESCHWÜLSTE
. G
EORG
T
HIEME
V
ERLAG
, 1919
Arbeiten wie diese brachten Friedrich Kopsch internationale Anerkennung und Ehrungen. So war er u.a. Mitglied der Kaiserlich Deutschen Akademie der Naturforscher in Halle, Ehrenmitglied der Anatomischen Gesellschaft und ausländisches korrespondierendes Mitglied der medizinischen Gesellschaft für Chirurgie von Bologna.
ABB. 9 BERUFUNG IN DIE MEDIZINISCHE GESELLSCHAFT FÜR CHIRURGIE AN DER UNIVERSITÄT BOLOGNA
ABB. 10 ERNENNUNG ZUM MITGLIED DER AKADEMIE DER NATURFORSCHER IN HALLE
1929 wurde ihm für seine Arbeit über grundlegende entwicklungsmechanische Versuche und Untersuchungen an Eiern von Forellenarten, Haifischen und Haushühnern die Wilhelm-Roux-Medaille verliehen.
Wilhelm Roux war u.a. Professor in Halle, dabei Mitbegründer und wesentlicher Vertreter der Entwicklungsmechanik. Er gab 1895 das „Archiv für Entwicklungsmechanik“ heraus. Hier sollten nicht nur rationale Beschreibungen, sondern auch die experimentellen Überprüfungen von Forschungen dargestellt werden.
ABB. 11 PROF. KOPSCH AM HÄUSLICHEN ARBEITSPLATZ
„[...] Verehrer, Freunde und Nachkommen gaben auf Wunsch von Roux eine Schaumünze mit seinem Profil heraus, die durch die Wilhelm-Roux-Stiftung als Preis verliehen werden sollte. Die Münze sollte als Auszeichnung für bedeutende Forschungen auf dem Gebiet der Entwicklungsmechanik dienen. Sie trägt auf der einen Seite das Bild Roux’ von 1897. Die Rückseite erhält eingraviert den Namen und in kurzer Fassung das Hauptverdienst des Beliehenen. Der erste Kandidat war Prof. Fr. Kopsch aus Berlin. Die Medaille wurde gemeinsam mit einer Verleihungsurkunde übereicht. Die Urkunde, unterschrieben von den Fakultätsmitgliedern, erhielt Kopsch, der sich für die überraschende Ehre am 30. Juni 1929 bei dem halleschen Dekan Fritz Goebel (1888-1950) bedankte und die Verleihung als großen Ansporn für weitere umfassende Forschungen auf und für das Gebiet der Entwicklungsmechanik sah. [...]“2
ABB. 12 VERLEIHUNGSURKUNDE ROUX MEDAILLE
ABB. 13 VORDERSEITE ROUX MEDAILLE RÜCKSEITE
~
Friedrich Kopsch heiratete Elsbeth Gaedke, sie wohnten lange in Charlottenburg und dort wurde am 10. Okt 1897 ihr einziger Sohn geboren, Friedrich August Emil, genannt Friedel. Ich werde hier kurz die Vita von Friedel einfügen und dazu die mir vorliegenden Briefe seiner Eltern kommentierend verwenden.
Das Ende von Friedels Schulzeit fiel in die Zeit des Ersten Weltkrieges und bereits als Schüler wurde er zum Heeresdienst eingezogen. Am 2.5.1916 begann er seinen Dienst beim Ersatz-Bataillon des Reserve Infanterie Regiments 35, schon am 31.10.1916 ging es „ins Feld“ und er nahm an den Stellungskämpfen um den Narocz-See (heute Weißrussland, Naratschsee) teil. Im Winter 1916/17 kämpfte er bei der Winterschlacht an der Aa (heute Lettland), und den anschließenden Stellungskämpfen um Riga. Im März 1917 wurde er zum Gefreiten ernannt. Mit dem Reserve Infanterie Regiment 13 nahm er an der Schlacht um Verdun teil. Ende November 1917 erhielt er Heimaturlaub, um im Dezember das Abitur zu machen. Er erhielt ein handschriftliches Notreifezeugnis mit Bezug auf einen Erlass des Preußischen Kultusministers August von Trott zu Solz vom 1. August 1914. Dieser Erlass war dem Zeugnis beigefügt:
„[...] Um den Schülern der Prima einer höheren Lehranstalt, welche infolge der angeordneten Mobilmachung der Armee in diese eintreten wollen oder müssen, die Möglichkeit zu gewähren, vorher noch die Reifeprüfung abzulegen, beauftrage ich das Königliche Provinzialschulkollegium, angesichts dieses die Direktoren der Gymnasien, Realgymnasien und Oberrealschulen anzuweisen, mit den Schülern, welche der Prima mindestens im dritten Halbjahr angehören und sich entweder über ihre Verpflichtung zum Eintritt in die Armee durch die betreffenden Militärpapiere ausweisen oder die Zustimmung ihrer Väter oder Vormünder zu ihrem freiwilligen Eintritt beibringen und für militärtauglich befunden worden sind, sogleich die Reifeprüfung abzuhalten. [...].“
ABB. 14 NOTREIFEZEUGNIS KRIEGSTEILNEHMERPRÜFUNG (AUSSCHNITTE)
ABB. 15 FRIEDEL KOPSCH CA. 1916
Nach Erhalt seines Reifezeugnisses ist Friedel Kopsch dann wieder an die Westfront kommandiert worden, wo er im April 1918 zum Unteroffizier befördert wurde. Bereits vier Wochen später erfolgte die nächste Beförderung zum Vizefeldwebel. Im Stellungskrieg in Flandern wurde Friedel Kopsch dann im Juli 1918 verwundet und erhielt das Verwundeten-Abzeichen. Aus dem Heeresdienst entlassen wurde er am 21.12.1918.
Es ist höchst erschreckend und heute kaum vorstellbar, dass ein 18jähriger wohl freiwillig, zumindest mit Zustimmung der Eltern, in einen grauenvollen Krieg zieht, dort an mehreren Fronten kämpft und innerhalb einiger Monate vom Rekruten zum Vizefeldwebel befördert wird, vermutlich um die Lücken zu schließen, die der Tod täglich riss! Dann macht er mal eben zwischendurch ein Notabitur, vom Staat so gewünscht, und letztlich wird er noch verwundet und mit Orden ausgezeichnet.
ABB. 16 BESITZZEUGNIS VERWUNDETENABZEICHEN
Am 25.11.1918 nahm er sein Studium der Medizin an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin auf. Natürlich belegte er auch Vorlesungen bei seinem Vater.
ABB. 17 STUDIENBUCH FRIEDEL
In dem Zusammenhang sind die Eintragungen in den Studienbüchern über Studiengebühren interessant. Für ein Semester sind Zahlungsvermerke für 12 Mark quittiert mit der Bemerkung: „sonst frei als Prof.-Sohn“.
Bereits 1920 bestand er die ärztliche Vorprüfung, 1922 das ärztliche Staatsexamen und war für das praktische Jahr am Kreiskrankenhaus Lichterfelde und im Lazarus-Krankenhaus Berlin tätig. Die Approbation als Arzt erhielt er im August 1923. Die handschriftliche Approbationsurkunde wurde kurz vor Einführung der Rentenmark ausgestellt und enthält Stempelmarken im Wert von 7500 Mark. Die Verwaltungsgebühr betrug 120 000 Mark!
ABB. 18 APPROBATIONSURKUNDE FRIEDEL
Friedel Kopsch war dann vom 1.9.1923 bis 31.3. 1927 als Assistent an der Hautklinik der Charité tätig. Dort machte er seinen Facharzt und promovierte am 31.5.1927 mit dem Thema „Über das Vorkommen und die Bedeutung der eosinophilen Zellen bei der Gonorrhoea acuta anterior und Gonorrhoea acuta posterior.“
ABB. 19 PROMOTIONSURKUNDE FRIEDEL
Vier Monate später heiratet er Charlotte Wilhelmine Maria Margaretha Kupke in Beelitz. Charlotte ist die älteste Schwester meines Vaters Hans-Heinz Kupke, also meine Tante.
Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Am 9.8.1928 wird Friedrich Wilhelm Alexander in Potsdam geboren. In dieser Familie mit Großvater Friedrich, Vater Friedrich (Friedel) wird der Enkel Friedrich nun ausschließlich Fritz genannt. Am 29.4.1932 wird ein zweiter Sohn Wolf-Dietrich Johannes, genannt Wolf, in Bielefeld geboren.
Seit 1.1.1929 hat die Familie ihre Wohnung in Detmold, Pallaisstr. 44. Im Hause hat Friedel seine Praxis als niedergelassener Hautarzt. Schon am 1.6.1929 übernimmt Friedel die Leitung der Fachabteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am Landeskrankenhaus Detmold.
In diesen wenigen Friedensjahren, wo sich Friedel seiner medizinischen Karriere widmet, schreibt Friedrich Kopsch häufig an seinen Sohn und zeigt sich dabei auch spendabel. So finanziert er den Ankauf eines gebrauchten Konzertflügels. Lotte hatte vor ihrer Heirat eine Ausbildung als Pianistin gemacht und bis dahin kein eigenes Klavier gehabt.
ABB. 20 PROF. AN FRIEDEL 31.1.1931
Zur Geburt des zweiten Enkels schenkt er Lotte einen Brillantring, wobei er die Familie über die Kosten nicht im Unklaren lässt.
ABB. 21 PROF. AN FRIEDEL 1.6.1932 (AUSSCHNITT)
Als der zweite Enkel von Friedrich Kopsch schon sehr früh Zähnchen zeigt, hat er natürlich wissenschaftlich fundierten Rat! Am 21.5.1932 schreibt Friedrich Kopsch an seinen Sohn Friedel:
ABB. 22 PROF. AN FRIEDEL 21.5.1932 (AUSSCHNITT)
Andererseits scheint sich Friedrich Kopsch wohl häufig zu sehr um die junge Familie gekümmert zu haben. Am 9.11.35 schreibt Friedel an Lotte wegen des bevorstehenden Umzugs von Detmold nach Leipzig. Dabei wird seine verärgerte Haltung zu den Eltern deutlich:
„[...] Also nun mal zu den Eltern. Vater hat in Berlin einen großen Berater und der heißt von Marenholz. Von dem bekommt Vater alles Mögliche und Unmögliche zu hören. So z.B., wie hoch mein Gehalt ist, wie hoch die Umzugskostenbeihilfe ist, daß in Leipzig die Dermatologen unheimlich zu tun haben und ich sicher sehr bald eine Riesenpraxis haben werde, etc. Du siehst also woher der Wind weht. Vater nimmt alles gläubig in sich auf. Und da ist denn bei Mutter der Wunsch der Vater des Gedankens. Ich habe es nun auch bald satt, immer nur bevormundet zu werden. Aber Du weißt ja, tue was dagegen, noch ist Vater immer der, der uns aus der Klemme geholfen hat. Daß Mutter zum Einrichten herkommt, darüber brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. [...]“
Im Oktober 1933 verkündete Hitler den Austritt aus dem Völkerbund und machte für seine Vorstellung damit den Weg frei für die massive Aufrüstung und Aufstellung eines zunächst 300 000 Mann Heeres. Die Beschränkungen des Versailler Vertrages wurden ignoriert und zum Oktober 1935 die allgemeine Wehrpflicht verkündet.
Mit Urkunde vom 28.September 1934 wird Friedel Kopsch das Ehrenkreuz für Frontkämpfer verliehen. Dieses Ehrenkreuz wurde zwar in großen Mengen an verwundete Kämpfer des Ersten Weltkrieges verliehen, musste allerdings in der Regel von den Eltern gefallener oder verwundeter Soldaten beantragt werden.
Hat Prof. Kopsch das also beantragt? Es liegen dazu keine Dokumente vor.
ABB. 23 VERLEIHUNGSURKUNDE EHRENKREUZ
Ab dem 28.11.34 nimmt Friedel an einer 4-wöchigen Übung als Ergänzungsführer (Unterarzt) bei der Sanitätsstaffel Detmold teil. Sein Vater muss zu dieser Zeit seine Beziehungen zu leitenden Medizinern genutzt haben, um Friedel den frühen Weg in das Reichsheer zu ebnen. Am 9.12.34 schreibt Friedel an den Wehrkreisarzt eine Bewerbung für seinen Eintritt in das Reichsheer. Er beginnt:
„[…] Unter Bezugnahme auf eine Unterredung zwischen Herrn Generaloberstabsarzt Dr. Waldmann und meinem Vater Prof. Dr. Kopsch, Berlin, anatomisches Institut der Universität Berlin, am 4. Dezember 1934 in Berlin bitte ich als Arzt in das Reichsheer eingestellt zu werden. (Aktive Sanitäts-Offiziers-Laufbahn). [...]“
Aus weiteren Schreiben geht hervor, welche Bewerbungsunterlagen zusätzlich eingereicht werden mussten. Es waren: Nachweis arischer Abstammung beider Ehepartner, Nachweis der Schuldenfreiheit, Führungszeugnis, Erklärung, kein Freimaurer zu sein und keine Bindungen zu Logen zu haben. Offensichtlich wurden diese Papiere innerhalb kürzester Zeit bereitgestellt, denn bereits im März 1935 erfolgt die Einstellung als Unterarzt in die Sanitätsstaffel Berlin. Das war wohl doch etwas plötzlich, denn Friedel schreibt eine sofortige Antwort an den Standortarzt Berlin:
„Euer Hochwohlgeboren!
Euer Hochwohlgeboren bitte ich ganz gehorsamst, mich erst am Montag, dem 11. März 1935, in Berlin melden zu dürfen, da ich erst meine Praxis auflösen und meine Patienten an andere Ärzte zur weiteren Behandlung überweisen muß. [...]
Mit vorzüglicher Hochachtung
Heil Hitler!“
Ab diesem Zeitpunkt geht alles immer schnell mit steiler Karriere:
1.5.1935
Ernennung zum Assistenzarzt bei San.-Abteilung Magdeburg, Staffel Berlin
10.10.1935
Versetzung nach Leipzig
1.11.1935
Beförderung zum Oberarzt und Stabsarzt der San.-Abtlg. 14, Leipzig
23.9.1936
Empfang des Dienstpferdes „Loki“
1.10.1936
Verpflichtungsschein für unbegrenzte Zeit in der Wehrmacht
2.10.1936
Verleihung der Dienstauszeichnung IV. Klasse, wegen vierjähriger treuer
Dienste in der Wehrmacht! (Dabei wurde die Dienstzeit des 1. Weltkrieges mitgerechnet)
28.11.1939
Eisernes Kreuz 2. Klasse, dort schon Oberstabsarzt! II. Artillerie-Reg 50
18.12.1939
Medaille zur Erinnerung an den 1.10.38 (Sudetenland-Medaille)
3
1.6.1942
Ernennung zum Oberfeldarzt
Gefallen ist Friedel am 8.7.42 in Saprudnoje bei Shisdra (Russland). Dort wurde er auf dem Soldatenfriedhof in Bukan beerdigt.
ABB.24 OHNE WORTE
~
Von seinem Vater Friedrich Kopsch sind zu den Kriegseinsätzen des Sohnes keine Briefe, Dokumente oder Aufzeichnungen bekannt. Auch zu Friedels Tod sind Briefe an Lotte nicht überliefert. Das ist umso erstaunlicher, da von ihm ansonsten sehr viele Briefe erhalten sind, aber immer nur zu zivilen Angelegenheiten. Regelmäßig hat er alle Familienereignisse gerne und detailliert kommentiert.
Im Sommer 1940 begann der erste Luftangriff auf Berlin, doch erst ab August 1943 begann die British Air Force mit den verheerenden Großangriffen auf die Hauptstadt. Erst jetzt sind in den Briefen von Friedrich Kopsch auch seine Erlebnisse und Kommentierungen zum Kriegsgeschehen enthalten:
Am 11.8.1943 sendet Friedrich Kopsch an seine Schwiegertochter Lotte in einem versiegelten Umschlag eine Abschrift seines Testaments mit genauen Anweisungen zum Verfahren im Falle seines Todes:
„[...] denn, wenn das Testament nicht vorhanden ist, erben Deine Söhne und Du gehst des Niesbrauchs verlustig, den Du nach meinem Willen am Gesamterbe haben sollst solange Du lebst und im Witwenstande verharrst.[...]“ .
Weiter schreibt er:
„[...] Seit Anfang vergangener Woche schleppe ich täglich etwa 20 Pfund meiner Apparate und Instrumente und Präparate von der Anatomie nach Dahlem, denn die Anatomie ist doch wohl noch mehr gefährdet, wie unser Haus in Dahlem, das allerdings durch die Nähe der Flack und der Scheinwerfer auch ziemlich stark gefährdet ist. In unserem Luftschutzkeller habe ich nunmehr auch die Absteifung der Decke richtig und besser gemacht, als sie vorher war. [...] Aus den Kellern ist, soweit es möglich war, alles brennbare entfernt, denn wir müssen damit rechnen, dass die Brandbomben bis in den Keller durchschlagen. Im Luftschutzraum steht auch das Harmonikabett, [...] damit wir wenigstens bei einem totalen Brande des Hauses [...] etwas zum Schlafen haben, denn ich ziehe es vor, als Kellerbewohner weiter zu wohnen und nicht bei anderen Leuten herumzusitzen [...]“.
21.12.1943 Friedrich an Lotte in Leipzig:
„[...] Die Fenster [...] sind sorgfältig und solide mit dicker Pappe geschlossen.[...] Nur bekommen wir hier sehr schwer kleine Nägel (von 25mm Länge) mit der die Pappen befestigt werden müssen. Heute habe ich ein Paar bekommen, vielleicht reichen sie für die Fenster der Fremdenstube. Dort entdeckte ich heute Vormittag auch, dass durch das breite untere Querholz eines Fensterflügels ein Bombensplitter vollständig durchgegangen war. Diese Splitter müssen mit einer ungeheuren Gewalt fliegen. [...]“.
Briefe an seine Enkel Fritz und Wolf sind immer verbunden mit erzieherischen Worten und einem liebevoll erhobenen Zeigefinger. So zum 15. Geburtstag von Fritz im August 1943:
„[...] Sei fleißig und sei gut zu Deiner Mutter! Dein Großvater“
Im März 1944 wurde sein ältester Enkel Fritz konfirmiert. Friedrich Kopsch schrieb bisher alle seiner Briefe mit Schreibmaschine, zu diesem Anlass verfasste er ihn handschriftlich:
ABB. 25 PROF. AN FRITZ 15.3.1944 (AUSSCHNITT)
„Mein Lieber Fritz!
Am Sonnabend den 18. März findet Deine „Einsegnung“ statt. Dieser Vorgang bedeutete früher für die Schüler der Volksschule einen gewissen Abschluß der Kinderzeit und den Anfang der Beschäftigung mit einem Beruf, bei den Schülern der höheren Lehranstalten trat mehr das geistige Moment in den Vordergrund, das Bekenntnis zum christlichen Glauben.
In meiner Jugendzeit war dies für die Mehrheit wohl nur eine äußerliche Angelegenheit. Wie es sich heute damit verhält, kann ich nicht beurteilen, vermute aber, daß es noch viele junge Menschen geben wird, die sich der Bedeutung dieses Tages bewusst sind. Für die Familie war die Einsegnung eines Kindes stets der Anlaß zusammenzukommen, um den Tag festlich zu begehen. Darum wären Großmutter und ich sehr gerne nach Detmold gekommen, hätten mit Deiner Mutter, mit Dir und Wölfi gefeiert und hätten uns gefreut, einmal wieder mit Euch Allen zusammen zu sein. Das geht aber zu unserer großen Betrübnis nicht und zwar aus verschiedenen Gründen: Zunächst ist die Entfernung zu groß und wir alten Leute können uns nicht dem aussetzen, daß wir etwa stundenlang im Eisenbahnwagen stehen oder in drangvoller Enge viele Stunden zubringen müßten. Dazu kommt für mich noch, daß ich das Haus wegen der derzeit drohenden Luftangriffe nicht verlassen kann. [...] Sehr gern hätten wir Dir irgendein wertvolles Erinnerungstück zu diesem Tage geschenkt. Du weißt aber selber, daß man zur Zeit nichts derartiges auftreiben kann und unter unseren Besitztümern befindet sich nichts, was sich für Dich und für diese Gelegenheit eignen könnte. Als Einziges kann ich Dir ein Exemplar der gesammelten Werke von Löns zueignen, ich hoffe, daß Dir vieles davon gefallen wird. [...] Lies zuerst den Wehrwolf! Das ist vielleicht das Beste, was Löns verfaßt hat. Ich habe ihn viele Male mit stets neuer Freude gelesen. [...]“.
Auf der Rückseite des Briefes ist ein Glückwunsch von Elsbeth Kopsch zu lesen. Auch sie schreibt zur Konfirmation, allerdings mit anderen Schwerpunkten:
„[...] Du trittst früher in die Welt hinaus, als wir alle, die Dich lieben, es gedacht haben, es werden an Dich so ernste Anforderungen gestellt, wie wohl noch niemals an so junge Menschen wie Dich und alle Deine Kameraden, hilf unserem geliebten Vaterland nach besten Kräften und bleibe heil und gesund. Sei immer eingedenk bei allem was Du beginnst, daß Du es auch vor Deinem lieben Vater, der Euch so früh verlassen musste, als wenn Du vor ihm ständest, verantworten kannst, und ob Deine gute Mutter keinen Kummer darüber haben müsste. Werde ein guter und tüchtiger Mensch, wie wir es alle nach Deinem bisherigen Verhalten und Handeln von Dir erwarten. Viel Glück und Segen über Dich, [...] Deine Großmutter Kopsch.“
Am 3. November 1944 schrieb Friedrich Kopsch erneut an seinen Enkel Fritz:
„[...] Wir wünschen Dir auch für die Zukunft alles Gute [...]. Du hast ja nun schon allerlei Schweres erlebt und Dich dabei tätig beteiligt. Sehr gern möchte ich erfahren, wie es kam, daß Du bei dem letzten Angriff im Bahnhofsbunker gewesen bist. [...] Hast Du Dich selber in dem Sanitätsraum angeboten? Welcher Art ist Deine Tätigkeit dort gewesen? Hast Du bei den Verbänden mitgeholfen [...]? Schreibe aber nicht davon, wenn es nicht erlaubt ist, damit Du und wir keine Ungelegenheiten deswegen haben. [...] Ich lege Dir 5,00 RM ein, die Du zu Deinem und Deiner Kameraden Besten verwenden magst. Laß Dich aber nicht in zu großer Gutmütigkeit missbrauchen. Auch das ist nicht richtig. Alle Freundschaft und Kameradschaft muss auf Gegenseitigkeit beruhen.
Lebe wohl und sei herzlich gegrüßt von Deinem Großvater.“
Dieses Lebewohl hat leider sofort eine größere Bedeutung erhalten. Fritz war bei einem Fliegerangriff auf Bielefeld als Luftwaffenhelfer in seiner Flakstellung am 4.11. gefallen.
Der obige Brief vom 3.11. hat ihn nicht mehr erreicht.
Das innige Verhältnis beider Großeltern Kopsch sowohl zu ihren Enkeln als auch zu ihrer Schwiegertöchter Lotte wird nach diesem erneuten Schlag in den Briefen sehr deutlich.
Am 5.11.1944, einen Tag nach dem Tod von Fritz schreibt Friedrich an Lotte:
„Meine liebe Lotte!
Du arme unglückliche Mutter und wir armen unglücklichen Großeltern! [...] Als gestern Abend das Telefon aus Detmold sich meldete, und ich verlangt wurde, ahnten wir schon ein Unheil! Die Wirklichkeit aber war vor Allem für Mutter ganz niederschmetternd: sie sagte immer nur ach Gott der liebe Junge und lehnte ganz verzweifelt an der Wand. Wir empfinden seinen Tod so besonders schwer, weil er unsere ganze Hoffnung war [...]. Nun ist auch diese Hoffnung dahin. [...] Nach dem Warum aller dieser Prüfungen darf man nicht fragen. Die Gottgläubigen haben es sehr einfach; wir müssen zusehen, wie wir mit dem uns zufallenden Schicksal fertig werden und wollen es tapfer versuchen. [...] Sei von Herzen gegrüßt von Deinem Vater.“
Im selben Brief schreibt Elsbeth:
„Meine liebe, liebe Lotte, unser liebes Kind!
All mein Denken und Fühlen ist bei Dir und dem großen, unsagbaren Schmerz, der Dich, den lieben Wölfi und uns getroffen. [...] Worte sind ja viel zu arm, um meinen Schmerz um dieses Kind auszudrücken [...]. Wie gern würde ich bei Dir sein, [...], bei dem letzten Gang mit ihm, das alles darf nicht sein, der grausame Krieg verbietet alles, der meine Gesundheit so mitgenommen hat, dass Vater die Reise zu Dir nicht zulassen will. [...] In unsagbarem Schmerz und in tiefer Trauer mit Dir vereint, meine liebe, liebe Lotte,
Mutter, Fritz II Mutter, und Fritz III Großmutter.“
Wenige Wochen danach, zum Weihnachtsfest 1944 schreibt Elsbeth:
„[...] Ach ja, es wäre ein anderes Weihnachtsfest gewesen, [...] wenn er noch unter uns weilte, der von allen, [...] so hochgeschätzte Junge, ich habe all diese Tage nur an Dich und Ihn gedacht, [...]. Jetzt müssen wir seinen lieben Vater mit ihm vereint über den Sternen suchen, [...]. Und dennoch, liebe Lotte, bitte ich Dich aus tiefsten Herzen, Du bist noch jung, wende Dich wieder dem Leben zu, da ist zunächst Wölfi, der durch die Erlebnisse des letzten Jahres, dem frühen Tode des Vaters und des Bruders, die letzten 5 Kriegsjahren mit seinen 12 ½ Jahren schon so viel Schweres erlebt hat, er braucht nicht nur eine gute Mutter, [...] mach’s ihm nicht so schwer, [...] wenn Du Dich so ganz dem Schmerz und Herzeleid hingibst. [...] im neuen Jahre, das uns endlich den guten Frieden bringen möge, schließe ich für heute, Mutter“
ABB. 26 ELSBETH AN LOTTE 26.12.1944 (AUSSCHNITT)
Tatsächlich ging der Krieg nun in seine letzten grausamen Monate. In allen am Krieg beteiligten Völkern hat fast jede Familie Briefe der obigen Art verfassen müssen, erhalten und gelesen, und der Trauer und Verzweiflung auf sehr individuelle Weise Raum gegeben. Doch mit dem Ende des Krieges war das Elend ja nicht beendet. Gefangenschaft, Besatzung, Hunger und Zerstörung von materiellen und geistigen Gütern wirkten noch Jahre weiter.
Am 18.8.45 schreibt Elsbeth an Lotte:
„[...] Die Tage die folgten waren mit soviel Unruhe ausgefüllt, waren doch die Häuser 2, 3a und 3 von den Amerikanern beschlagnahmt und mussten innerhalb drei Stunden geräumt werden, einen alten Herrn daraus haben wir 14 Tage im Fremdenzimmer beherbergt, das selbe könnte uns jeden Tag auch drohen, Du kannst Dir denken wie uns zu Mute war und ist. Bis jetzt sind nur ein Sofa und die beiden Sessel aus meinem Zimmer für einen Leutnant, ausgerechnet mit Seide bezogen, beschlagnahmt und sofort aufgeladen und abgefahren worden.[...] Vor gut 14 Tagen habe ich nach Beelitz geschrieben, aber noch keine Antwort von Deinen lieben Eltern bekommen, ich bat so sehr um ein Lebenszeichen, hoffentlich geht es ihnen so gut, wie es heute möglich ist., auch Hans-Heinz mit Frau und Söhnchen. [...]“
Der nächste erhalten gebliebene Brief stammt aus dem November 1945. Elsbeth Kopsch schreibt ihn an ihre Schwiegertochter Lotte. Er erreicht sie aber erst im Dezember 1945. Dieser Brief enthält eine Nachricht, die bei allen anderen Familienmitgliedern, in dieser und der Folgezeit, ein einschneidendes Ereignis darstellt. Es übertrifft bei weitem die vielen traurigen Meldungen der Zeit an Schwere und wird auch bei vielen anderen hier beschriebenen Personen eine zentrale Rolle spielen.
„[...] Ich kann Dich nur bitten weiter stark und tapfer zu sein und zu bleiben bei der Nachricht, die gerade ich Dir, liebes, gutes Kind, zu meinem Schmerz ausersehen scheine Dir zu geben, ich glaubte Traute würde es inzwischen tun mit näheren Erklärungen vielleicht, es ist aber wohl nicht der Fall, sie wäre jedenfalls die nächste dazu. Deine lieben Eltern sind tot auch Grete. Wir standen beide dieser Nachricht fassungslos gegenüber. Eine Karte, die ich am 22. 9. an die Eltern sandte, bekam ich am 25. oder 26.9. zurück mit dem Vermerk „Ganze Familie verstorben“. Nachdem ich mich von diesem Schlag etwas erholt hatte, schrieb ich an Herrn Dathe, den einzigen Namen, den ich in B. kannte und bat um nähere Auskunft, ich konnte es ja nicht fassen und war sehr, sehr traurig. Herr D. antwortete am 3.10. folgendes:
„Am 24. April, einen Tag nachdem die Russen in Beelitz waren, hat sich die ganze Familie durch Morphiumspritzen das Leben genommen. Von Hans-Heinz und Lotte haben wir bis jetzt auch noch keine Nachricht. Es war für uns eine furchtbare Überraschung. Wir haben dann die ganze Familie mit noch mehr Beelitzern hier auf dem Friedhof beigesetzt. Sonst geht hier in Beelitz alles seinen geregelten Lauf weiter. In der Hoffnung, dass Ihnen diese Zeilen genügen, verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen Ihr W. Dathe.“ Diese Zeilen wurden erst am 17.10. uns zugestellt, dass ich zuerst wie gelähmt darüber war, kannst Du Dir wohl denken, hatte ich doch Deinen lieben Vater am Sonntag nach Ostern wieder am Bahnhof Zehlendorf begrüssen können, und wieder einiges sehr willkommenes entgegen nehmen dürfen, es waren Kartoffeln u. einige Eier, mit dem letzten sehr gehüteten, backte ich meinen Geburtstagskuchen u. gedachten der Eltern, ahnungslos über ihr Schicksal. Dein lieber Vater machte auf mich damals schon einen recht gedrückten Eindruck, aber wer war es nicht, denn es war doch das trostlose Ende dieses grauenvollen Krieges schon abzusehen, und wer weiss, was er und Mutter u. Grete mit den R. erlebt haben, da haben sie getan, was so viele Familien hier getan haben in den ersten Tagen deren Hierseins, es ist erschütternd davon zu hören.
Dein Elternhaus ist jetzt das unsere allein und jederzeit bist Du uns als liebe Tochter willkommen, das weisst Du auch, um den Verlust Deiner rechten lieben Eltern, die Deine Kindheit behütet haben, trauern wir von ganzem Herzen mit Dir, wir grämen uns sehr über das neue Leid, dass mit dieser Nachricht über Dich kommt, es gilt auch, das zu überwinden, um das junge Leben Wölfis zu betreuen und um uns Alten noch den Lebensabend zu erhellen und freundlich zu gestalten, wir hoffen auf Dich, Du unser einziges liebes Kind Lotte! [...]“
Wieder wird das liebevolle Verhältnis des Ehepaares Kopsch zu ihrer Schwiegertochter sehr deutlich. Elsbeth Kopsch formuliert in allen ihren Briefen immer mit sehr langen und verschachtelten Sätzen. In diesem Brief ist dieser Stil noch viel augenfälliger. Sie fließt förmlich über und ihre Gedanken finden keinen Punkt. Nur ein Satz ist so kurz wie kein anderer vorher: „Deine lieben Eltern sind tot auch Grete.“
Zu dieser Zeit konnte Elsbeth Kopsch nicht wissen, dass auch die im Brief genannte Traute mit ihrer kleinen zweijährigen Tochter Jutta zu den Toten gehörte. Traute und Grete waren Schwestern von Lotte und Hans-Heinz Kupke.
Aus diesem Brief wird wiederholt deutlich, wie nahe sich die Eltern Kopsch und die Eltern Kupke gestanden haben. Nicht nur, dass der Tierarzt vom Lande die einen oder anderen Lebensmittel organisieren konnte, sondern es bestand ein freundschaftlich verbundenes Verhältnis. Natürlich äußert sich auch Friedrich Kopsch zu dem schrecklichen Ereignis:
„[...] Was für ein schweres Schicksal ist Dir bisher beschieden gewesen. Ich hoffe, dass Dir die Zukunft einen Ausgleich dafür geben wird [...]. Man wird Näheres darüber abwarten müssen, welche schweren Erlebnisse die Ursache des unfassbaren Entschlusses Deiner Eltern gewesen sind, denn es müssen doch sehr gewichtige Gründe gewesen sein. [...]“
Wie Elsbeth Kopsch in ihren Briefen bei allem Schmerz auch immer wieder aufmunternde Worte findet und ans Durchhalten appelliert, so bleibt Friedrich Kopsch immer sehr sachlich und wirkt etwas distanziert. Jedoch hat er auch schnell praktische Lösungsvorschläge zur Hand. So auch in diesen Brief. Lottes Wohnung in Detmold war durch Granatbeschuss völlig zerstört, sie lebte jetzt in einer Behelfswohnung. Friedrich Kopsch schreibt in demselben Brief, mit dem Lotte die Nachricht von Tod ihrer Eltern erhält:
„[...] Nun bitte ich Dich, Dir zu überlegen, ob es unter den obwaltenden Umständen nicht das beste wäre, wenn Du mit Wölfi zu uns in unser Haus kämest und dort bliebest. [...] Diese Verhältnisse sind zur Zeit nicht ganz klar zu überschauen, aber mich dünkt, dass die Hinterbliebenen-Pensionen, [...] aufs Äußerste gekürzt werden. Einmal um den Staat von dem Übermass seiner geldlichen Beanspruchungen etwas zu entlasten, zweitens, um alle Personen zu zwingen Arbeit zu suchen [...]. Ich vermute, dass auch Du Dir eine Beschäftigung wirst suchen müssen und ich glaube, dass Du eine entsprechende Stellung in Berlin leichter finden wirst, als in Detmold.
Ein anderer Grund ist für mich die Hinfälligkeit von Mutter. Diese Zeit zusammen mit ihrem Alter haben sie sehr mitgenommen und unsere Wirtschaft könnt eine junge Kraft sehr gut gebrauchen. [...] Ein dritter Grund ist die Möglichkeit, dass wir fremde Leute in das Haus gesetzt bekommen können und da ist es doch besser unsere Räume mit Dir und Wölfi, als mit Fremden zu teilen. [...]“
In dem langen Brief geht es auch um einige persönliche Details, die die Situation Ende 1945 in Berlin und im Hause des Professors beleuchten. Diese Sorgen sind nicht vergleichbar mit den Sorgen der meisten anderen Menschen im Nachkriegs-Berlin! So hatte Friedrich Kopsch auch zu der Zeit immer noch Personal, den Hausmeister und Gärtner August Musal, sowie die Hauswirtschafterin Edith Behnick.
„[...] Du schriebst davon, dass Edith treu bei uns ausgehalten hat. Nun ausgehalten hat sie bei uns und hat auch viel für uns getan. Sie wäre aber schon während des Krieges sehr gerne nach Hause gegangen, um ihre alte Mutter zu unterstützen. Nur hat das Arbeitsamt ihr dazu die Erlaubnis nicht gegeben. Es ist für sie sehr gut gewesen, dass sie hierbleiben musste, denn so hat sie von ihren Besitztümern nichts eingebüßt, während ihre Eltern alles eingebüßt haben und nur das besitzen, was sie auf dem Leibe tragen. Unsere eigenen Soldaten, die Russen und jetzt die Polen haben ihnen alles genommen.[...]“
Zu seiner eigenen Situation schreibt er weiter:
„[...] und warte ab, wie sich die Geldverhältnisse entwickeln werden. Davon hängt natürlich auch für mich vieles ab, aber ich bekomme mein Gehalt. Allerdings auch um etwa 25 bis 30 % gekürzt durch die sozialen Abgaben und die Steuern, habe aber die Einnahmen aus dem Rauber zu erwarten, doch ist letzteres auch noch ganz unsicher, denn der Verlag in Leipzig kann nicht arbeiten. Die Russen haben das ganze graphische Gewerbe in Leipzig stillgelegt, die Engländer haben den Inhaber des Verlages nach Wiesbaden transferiert. [...] Jedenfalls kann die XVII. Auflage des Lehrbuches, die dringend notwendig ist für die Studenten, vorerst nicht hergestellt werden. Ich werde also1946 kein Honorar vom Verlag zu erwarten haben, kann aber allein vom Gehalt auch leben.
Die Universität ist von Professoren gereinigt, die Pg4waren oder SA oder SS und das ist gut, denn diese Leute waren meistens nur aus Rücksicht auf bessere Karriere zur Partei gegangen. Etwa 90% der Universitätslehrer wollten von Hitler nichts wissen. [...]“
Prof. Kopsch stellte sich mit seinen inzwischen 77 Lebensjahren, als es 1945 bei Wiedereröffnung der Universität Berlin an Lehrkräften mangelte, bis 1949 erneut zur Verfügung. Er hielt Vorlesungen, präparierte, prüfte und arbeitete an einer weiteren Neuauflage des Rauber-Kopsch.
ABB. 27 PROF. KOPSCH IM LABOR
Die Korrespondenz mit Lotte führte in diesen Jahren ausschließlich Elsbeth Kopsch. Dabei ging es immer wieder um die Alltagssorgen im Nachkriegs-Berlin und natürlich um Trauer, Schmerz und Hoffnung.
12.1.1946 Elsbeth an Lotte:





























