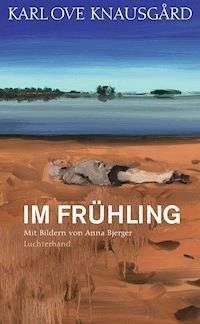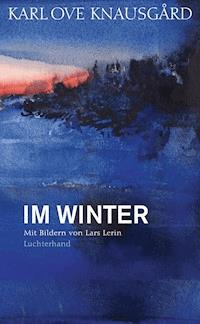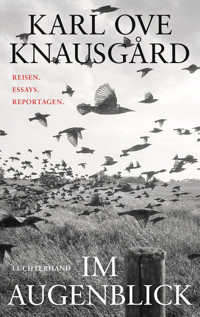
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geht um Faust und den Teufel, um skandinavische Malerei und den Tod, russische Tankstellen und die amerikanische Prairie: Das Essayistische ist eine treibende Kraft in Karl Ove Knausgårds schriftstellerischem Werk, seine preisgekrönten Romane sind undenkbar ohne essayistische Einschübe, in der sich die großen Fragen zur menschlichen Existenz mit dem alltäglichen Leben seiner Protagonisten verbinden. Knausgårds Interesse ist dabei breit gefächert, gesucht und verhandelt wird immer das Große im Kleinen, und vermeintlich Nebensächliches entpuppt sich nicht selten als das eigentlich Wesentliche. Was sind die Bedingungen für kreatives Schaffen – und was ist es, was unsere Welt und letztendlich unsere Wahrnehmung formt? Das sind die Fragen, um die sein Schreiben kreist und denen er sich auf verschiedene Weise nähert.
In dieser Sammlung seiner wichtigsten Texte, die eigens für die deutschen Leser und Leserinnen zusammengestellt wurden, begleiten wir Karl Ove Knausgård auf einer Reise durch Amerika und zu einem Operationssaal in Albanien, gewinnen u.a. Einblicke in norwegische Mentalität, in Malerei und Literatur – und werden Zeuge dessen, was ihn antreibt, Romane zu schreiben, und immer wieder zu versuchen, hinter die unerklärlichen Mechanismen des Lebens zu schauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1045
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
ESGEHTUMFAUST und den Teufel, um skandinavische Malerei und den Tod, russische Tankstellen und die amerikanische Prärie: Das Essayistische ist eine treibende Kraft in Karl Ove Knausgårds schriftstellerischem Werk, seine preisgekrönten Romane sind undenkbar ohne essayistische Einschübe, in der sich die großen Fragen zur menschlichen Existenz mit dem alltäglichen Leben seiner Protagonisten verbinden. Knausgårds Interesse ist dabei breit gefächert, gesucht und verhandelt wird immer das Große im Kleinen, und vermeintlich Nebensächliches entpuppt sich nicht selten als das eigentlich Wesentliche. Was sind die Bedingungen für kreatives Schaffen – und was ist es, was unsere Welt und letztendlich unsere Wahrnehmung formt? Das sind die Fragen, um die sein Schreiben kreist und denen er sich auf verschiedene Weise nähert.
In dieser Sammlung seiner wichtigsten Texte, die eigens für die deutschen Leser und Leserinnen zusammengestellt wurden, begleiten wir Karl Ove Knausgård auf einer Reise durch Amerika und zu einem Operationssaal in Albanien, gewinnen u. a. Einblicke in norwegische Mentalität, in Malerei und Literatur – und werden Zeuge dessen, was ihn antreibt, Romane zu schreiben, und immer wieder zu versuchen, hinter die unerklärlichen Mechanismen des Lebens zu schauen.
Zum Autor
KARLOVEKNAUSGÅRD wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes wurden weltweit zur Sensation. Sein großer »Morgenstern«-Romankosmos um das plötzliche Auftauchen eines neuen Sterns am Himmel lotet die Abgründe menschlichen Lebens aus und fasziniert mit seiner Soghaftigkeit auf ähnliche Weise. Das Essayistische ist eine treibende Kraft in Knausgårds schriftstellerischem Werk, das in 35 Sprachen übersetzt ist und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur, 2022 nahm er in Kopenhagen den Hans-Christan-Andersen-Literaturpreis entgegen. Er lebt in London.
KARL OVE KNAUSGÅRD
IMAUGENBLICK
REISEN. ESSAYS. REPORTAGEN.
Luchterhand
INHALT
WARUMDERROMANWICHTIGIST
WIEICHAMERIKANICHTENTDECKTE
DERKUSSINSEVILLA
HIER, JETZT, DORT, DAMALS
DIENATURDERZAHLEN
AMRANDMITTENINDERWELT
DIEINGENIEUREDESFLEISCHS
BÄUMEUNDPFERDEIMVERLORENENPARADIES
WIRKLICHKEITSVARIATIONEN
DASLANDDERVÖGEL
TÜBINGERVORLESUNGEN 2019
RUSSLAND, OKTOBER 2017
FRANKFURT, OKTOBER 2019
UNVERHOFFT
ÜBERDASSCHICKSAL
DIERÜCKSEITEDESGESICHTS
DASSCHWIMMBECKENMITGRÜNEMWASSER
UNTERWERFUNG
IMLANDDERZYKLOPEN
GEFÜHLUNDGEFÜHLUNDGEFÜHL
PETERHANDKEUNDDASPARTIKULARE
GEHIRNCHIRURGIEINALBANIEN
Quellenangaben und Literaturhinweise
WARUM DER ROMAN WICHTIG IST
rainer maria rilke schrieb einmal sinngemäß, Musik könne ihn aus ihm selbst fortheben – und das ist ja nicht weiter bemerkenswert –, bis er hinzufügte: und mich an einem anderen Ort absetzen. Ich liebe dieses Zitat. Ich liebe es, weil mir das so vertraut ist, nicht nur im Hinblick auf Musik, sondern auch auf Literatur. Dieses eigentümliche Gefühl, von dem man gelegentlich erfüllt ist, wenn die Lektüre vorbei ist und man das Buch gesenkt hat, aber für Minuten noch in seiner Welt ist. Das letzte Mal habe ich das im vorigen Winter erlebt, als ich Claire Keegans Roman Kleine Dinge wie diese las. Ich hatte vorher nie von Keegan gehört, es war reiner Zufall, dass ich zu ihrem Buch griff. Es ist ein kleiner, im Original einhundertsechzehn Seiten langer Roman, den ich in ein paar Stunden auslas. Als ich fertig war, blieb ich minutenlang im Wohnzimmer sitzen, noch ganz erfüllt von den Gefühlen und Stimmungen des Buchs, die ich auf seltsame Weise als akut erlebte. Schließlich stand ich auf und tauchte in den Alltag ein, und die Eindrücke des Romans schwanden langsam dahin, bis von ihnen kaum etwas zurückblieb außer einem speziellen Gefühl, das sich einstellte, sobald ich an ihn dachte. Und so geht es mir mit allen guten Romanen, sie können mich vollkommen ausfüllen, aber nur im Augenblick; ist die Lektüre vorbei, löst sich ihr Erlebnis auf.
Spielt dieses Erlebnis eine Rolle? Ist es in irgendeiner Weise wichtig? Oder ist das Lesen von Romanen nur ein interessanter Zeitvertreib? In der Regel denken wir, wichtig ist, was etwas verändert oder in etwas eingreift, also ein Phänomen, eine Handlung oder Äußerung, die über sich hinausgehend Konsequenzen zeitigt. Je größer und entscheidender diese Konsequenzen sind, desto wichtiger ist es. Würde ich fragen, was zurzeit wichtig ist, würden manche vielleicht antworten »der Krieg in der Ukraine«, andere »der Klimawandel«, wieder andere »die Inflation und die wachsende Armut« oder auch »das Erstarken des Rechtspopulismus« oder »der strukturelle Rassismus«. Für manche mag es ein ermüdender Konflikt auf der Arbeit sein oder dass eine Mutter krank ist und im Sterben liegt oder eine schimmernd neue Liebe. Ich bezweifle, dass auf die Frage »Was ist wichtig?« viele »der Roman« antworten würden. Dass der Roman wichtig sei.
Ist der Roman wichtig? Für wen, und warum?
Bevor ich weitergehe, muss ich gestehen, dass ich in dieser Frage befangen bin. Ich habe mein Leben lang Romane gelesen und selbst einige geschrieben, wenn ich die Frage mit Nein beantworte, sage ich folglich, dass ich mein ganzes Leben mit etwas Unbedeutendem und letztlich Sinnlosem vergeudet habe. Wenn ich mit Ja antworte, könnte man das als eine verzweifelte Selbstverteidigung verstehen. Aber das ändert nichts, gehört nicht einmal hierher, denn da saß ich auf meinem Stuhl im Wohnzimmer mit Kleine Dinge wie diese im Schoß und war intensiv von den Gefühlen und Stimmungen des Romans erfüllt. Warum seine Wirkung so groß war, ist schwer zu sagen. Die Erinnerung an Lektüren ist ein wenig wie die Erinnerung an Schmerzen – wir können beschreiben, was geschah und wie es war, aber ohne die Gefühle, die uns in jenem Moment übermannten, und da die Gefühle der Schmerz sind, sprechen wir über die Schale, über das, was von ihm im Gedächtnis geblieben ist. Das Zeichen für den Schmerz, nicht der Schmerz. Lesen ist Gegenwart, es bedeutet, etwas nahezukommen.
Was ist es, dem wir in Kleine Dinge wie diese nahekommen?
Der Roman beginnt so:
Im Oktober färbten sich die Bäume gelb. Dann wurden die Uhren eine Stunde zurückgestellt, und die Novemberwinde kamen, wehten unablässig übers Land und entblößten die Bäume. In der Stadt New Ross stießen die Schornsteine Rauchschwaden aus, die sich herabsenkten und in haarfeinen, langgezogenen Fäden davonschwebten, bevor sie sich entlang der Kais verteilten, und bald schwoll der Fluss Barrow, dunkel wie Stout, mit Regenwasser an.
Innerhalb von drei Sätzen und auf einfachste Weise hat sich eine ganze kleine Welt geöffnet. Die Sätze enthalten Bilder, wir sehen die Bäume, die Stadt mit den Schornsteinen und den Kais, den durch sie strömenden Fluss, aber die Sätze sind auch mit einer Stimmung aufgeladen, was daran liegt, dass die Bilder, die Bäume, die Schornsteine nicht an sich beschrieben sind, sondern alle mit Bewegung verbunden werden: Wir sehen die Bäume, wenn der Wind die Blätter abreißt, wir sehen die Schornsteine, wenn der Wind den Rauch aus ihnen zieht, wir sehen den Fluss, wenn er mit Regenwasser anschwillt. Wir sehen mehr als die Stadt, wir sehen die Stadt, die in der Gewalt äußerer Kräfte ist, wir sehen einen Ort, durch den etwas strömt.
Im nächsten Absatz tauchen Menschen in der Stadt auf, als ein Gewimmel anonymer Gestalten im Supermarkt und der Bingohalle, in der Arbeitslosenschlange und auf dem Weg zur Schule, die Köpfe gegen den Wind gesenkt. Sie werden wie aus großer Höhe gesehen, genauso in der Gewalt äußerer Kräfte wie die Blätter, die der Wind von den Bäumen reißt. Mitten in diesem Wirbel aus Menschen hält der Text bei einem von ihnen inne, und die Perspektive verändert sich: Von nun an sehen wir die Stadt und das Leben von innen, durch die Wahrnehmungen und Gedanken eines gewissen Bill Furlong. Er ist das, was häufig ein ganz gewöhnlicher Mann genannt wird, womit gemeint ist, dass an ihm oder seinem Leben nichts außergewöhnlich ist. Er verkauft Holz und Kohle, ist verheiratet und hat fünf Töchter. Er arbeitet viel, die Familie hat nicht viel Geld, und manchmal beschleicht ihn das Gefühl, dass das Leben in der strikten Routine verschwindet. Er denkt, dass es im Leben mehr geben muss als arbeiten, essen und schlafen. Doch das Besondere an ihm, was ihm selbst vielleicht gar nicht klar ist, besteht darin, dass er ein guter Mensch ist. Und so ist Kleine Dinge wie diese in vieler Hinsicht ein Roman über das Gute.
Was ist das Gute?
Für sich genommen ist es eine abstrakte Vorstellung ohne konkrete Existenz. Als eine Art menschliche Maßeinheit verhält es sich zu einer Handlung wie das Litermaß zur Milch. In dem großen Roman über das Gute, Dostojewskijs Der Idiot, erhält das Gute als Idee eine physische Existenz durch Fürst Myschkin, den absolut guten Menschen, und bezieht seine Kraft aus der Kollision zwischen dem Idealen und dem Realen, es ist, als würde das Ideale, das Gute, das Reale vollständig bloßlegen, als würde in einem nächtlich dunklen Raum voller Betrunkener Licht gemacht. Der Idiot ist ein Ideenroman oder mit Dostojewskijs Worten fantastischer Realismus. Das Gute in Kleine Dinge wie diese ist von völlig anderer Art. Es ist fast nichts, vage, flüchtig, ausweichend – bei Bill Furlong zeigt es sich in einem Gedanken, einer kleinen Handlung, aber es steht niemals allein, steht immer inmitten anderer Gedanken, anderer Handlungen. Wenn das Gute hier ein Licht ist, dann ist es kein kräftiges, grelles, das brutal die sozialen Verhältnisse enthüllt wie bei Dostojewskij, sondern ein schwaches, flackerndes, das im nächsten Moment von konkurrierenden Gedanken, Rücksichten, Handlungen ausgepustet wird. Ja, so zart ist es, dass schon darüber zu sprechen, wie ich es tue, es ausbläst – wenn ich mit meinem Gerede über »das Gute« angetrampelt komme, wirkt es nur noch banal und dumm und selbstverständlich. In Keegans Roman redet keiner über das Gute, dort existiert es jenseits der Begriffe, ist es nur etwas, das sich namenlos und alltäglich zeigt. Und dies, etwas Bekanntes lebendig und sichtbar zu machen, sozusagen unter den Begriffen, die es in ihrem eisernen Griff festhalten, kann nur der Roman.
Aber ist das wichtig? Und wenn ja, warum?
Einer der vielen, die ihre eigenen Vorstellungen davon hatten, warum der Roman wichtig ist, war D. H. Lawrence. 1925 schrieb er vier Essays über den Roman als Genre. »Morality and the Novel«, »The Novel«, »The Novel and the Feelings« und »Why the Novel Matters«. Lawrence nahm kein Blatt vor den Mund, als es um die Größe des Romans ging, denn für ihn war er eine der größten Entdeckungen aller Zeiten und verkörperte die höchste Ausdrucksform, die die Menschheit bis heute erreicht hat. Der Grund dafür sei, schrieb er, dass der Roman unfähig zum Absoluten sei. Während Wissenschaft, Philosophie und Religion jeweils das Endgültige suchten und die Welt fixierten, halte der Roman das Leben offen. Lawrence war Vitalist, er bejahte das Leben in allem, was er schrieb, und der Roman war seine bevorzugte Ausdrucksform, weil dieser dem Leben so nahe war. In seinem Essay gewinnt man gelegentlich den Eindruck, dass der Roman lebendiger ist als das Leben selbst. »Lebendig sein, ein lebendiger Mensch sein, als ganzer Mensch lebendig sein: darum geht es. Und in seinen besten Momenten kann der Roman, und ganz besonders der Roman, einem helfen. Er kann einem helfen, kein toter Mensch im Leben zu sein.«
Was heißt das, ein toter Mensch im Leben zu sein?
Für Lawrence war das Leben überbordend, unbändig, unvorhersehbar und in ständiger Veränderung begriffen. Alles, was sich der Veränderung widersetzte, also das Fertige, Definierte, Kategorisierte, Absolute, widersetzte sich dem Leben. Deshalb waren sämtliche Routinen, Pläne, geordneten Systeme eine Art Tod im Lebendigen. Dem liegt die unausgesprochene, aber deutliche Vorstellung zu Grunde, dass die Natur und das Natürliche authentisch sind, während die Zivilisation nicht authentisch ist, und dass die Aufgabe der Kultur darin besteht, das Nicht-Authentische zu durchbrechen, damit der Mensch in ihr authentisch leben kann, oder wie Lawrence es formulierte, »lebendig sein« kann.
Lawrence stand mit diesen Gedanken nicht allein; in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts florierten Vorstellungen vom nicht-authentischen Menschen, in denen die Zivilisation als etwas Lebensverhinderndes und Unterjochendes betrachtet wurde. Diese Vorstellung ist eine der Erklärungen dafür, dass der Erste Weltkrieg im Sommer 1914 fast unisono mit Jubel und Enthusiasmus begrüßt wurde: Mit dem Krieg drang das echte Leben durch.
Die gleiche Vorstellung vom Echten und Ursprünglichen, von Blut, Wald, Erde saugte der Nationalsozialismus auf, und deshalb konnte Bertrand Russell schreiben, dass Lawrences »mystische Philosophie des Bluts geradewegs nach Auschwitz führte«.
Das ist einerseits richtig, andererseits aber auch nicht, denn die Lebensbejahung bei Lawrence hatte eine andere Konsequenz, um die es in seinem Essay »Why the Novel Matters« geht, nämlich um eine Bejahung der Form des Lebens, die offen, unübersichtlich, beweglich, veränderlich, unabgeschlossen ist – also das Gegenteil vom Absolutismus des Nationalsozialismus. Das ist einer der wichtigsten Punkte in Lawrences Essay, in dem es heißt: »Wir sollten nicht absolute Dinge oder das Absolute anstreben. Wir wollen uns endgültig und für immer von diesem hässlichen Imperialismus des Absoluten verabschieden.« Der Roman, meint er offenbar, löst das Absolute praktisch von selbst auf, kraft seiner Form, in der es stets um Beziehungen geht, also um die Beziehungen zwischen Menschen und zwischen den Menschen und der Welt und zwischen den Menschen und der Sprache. Und je weiter man sich dort hineinbegibt, desto beweglicher und relativer wird alles. Ein gutes Beispiel dafür liefert ein anderer vitalistischer Autor und Zeitgenosse von Lawrence: Knut Hamsun. Er war Nationalsozialist und wurde nach dem Krieg wegen Landesverrats verurteilt, sein Werk wird in Norwegen seither kontrovers diskutiert. 1915 beteiligte sich Hamsun an einer Zeitungsdebatte über zwei junge Frauen, die heimlich Kinder geboren und diese anschließend getötet hatten. Hamsun empörte sich über die milden Strafen – fünf beziehungsweise acht Monate Gefängnis. Er forderte die Todesstrafe. Hängt sie, hängt sie, schrieb er in den Zeitungen. Zwei Jahre später erschien sein Roman Segen der Erde. Darin geht es unter anderem um eine Frau, die ihr neugeborenes Kind tötet. Es wird aus ihrer Sicht erzählt, wir lernen sie kennen, begleiten sie durch die Tage, verstehen sie, was ihre Untat nicht verharmlost, im Gegenteil, sie wird verstärkt, weil die Tragödie von allen Seiten sichtbar wird und nicht mehr nur eine einfache Tatsache ist, die eine einfache Reaktion auslöst: hängt sie. Das ist es, was der Roman tut, er zieht jede abstrakte Vorstellung vom Leben, ob politischer, philosophischer oder wissenschaftlicher Art, in das Menschliche, wo sie nicht alleinsteht, sondern auf eine Myriade anderer Eindrücke, Gedanken, Gefühle und Handlungen stößt. Sie wird nicht unbedingt ausgelöscht, aber dem Einfachen an ihr wird von der Komplexität widersprochen, in der sie sich befindet. Deshalb lassen sich Dostojewskijs Romane bis heute lesen, denn in ihnen ist das Verhältnis zwischen abstrakten und reinen Ideen und chaotischer, unübersichtlicher, gefühlsgetriebener Wirklichkeit die treibende Kraft, die gedankliche Strategie – Dostojewskijs eigene Ideale können dabei verloren gehen, weil die Gegenstimme einem interessanteren Charakter gehört, was nicht selten der Fall ist. Und deshalb sind D. H. Lawrences Romane nicht so gut wie Dostojewskijs –, denn obgleich Lawrence wollte, dass die Romane wie das Leben selbst waren, ist die Idee vom Leben in seinen Romanen manchmal so stark, dass sie das Lebende fesselt, das daraufhin nicht mehr fließt und veränderlich und widersprüchlich ist, sondern in einer Denkform erstarrt. Es ist viele Jahre her, dass ich seinen Roman Der Regenbogen las, aber eine der wenigen Szenen, an die ich mich erinnere, spielte sich zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau auf einem Feld im Mondschein ab, und ich entsinne mich ihrer, weil die Frau und der Mann wie Riesen waren, sie waren so voller Leben und Menschsein, dass sie den Realismus verließen und zwischen den Weizenähren zu einer Art griechische Helden oder Giganten wurden. Die Szene löste Unbehagen bei mir aus, weil der Wille zum Leben absolut wurde und so das Leben erstickte und sich selbst zunichte machte. Der Roman wurde falsch. Das heißt nicht, dass er uninteressant ist, denn ein Roman ist immer auch ein Abbild seiner Zeit, und zusammen mit Hamsuns Segen der Erde trägt er dazu bei, die Tiefenströmungen sichtbar werden zu lassen, die zwischen Vitalismus und Totalitarismus verliefen. Das heißt nicht, dass die Romane totalitär sind – ein totalitärer Roman ist ein Widerspruch in sich, ist unmöglich. Im Roman geht es um Beziehungen, eines Menschen zur Welt oder um die Beziehungen der Menschen untereinander, und jede dieser Beziehungen enthält eine Komplexität, die einmalig für sie ist. Selbst ein monomaner, fanatischer Monolog wie Hitlers Mein Kampf handelt von Beziehungen, und schon auf den ersten Seiten zeigt sich die enthaltene Komplexität, wenn Hitler einige Sätze über die Kindheit mit Vater und Mutter schreibt und dabei offenkundig beschönigt und verschweigt, und sein Wunsch, das Bild von sich zu steuern, macht das Ich automatisch instabil und führt zu einem inneren Kampf zwischen Ordnung und Chaos, der verborgen werden soll, aber durchsickert und auf den monomanen Monolog abfärbt.
Beim Totalitären geht es um Abstand und Kontrolle, um das Generelle und das, was für alle gilt. Jedem, der einmal in Russland gewesen ist, muss die riesige Zahl von Kriegsdenkmälern aufgefallen sein, in jedem noch so kleinen Städtchen gibt es eins, und an jedem brennt eine Fackel. Sie verkörpern die große, heroische, russische Erzählung vom Zweiten Weltkrieg. Im Laufe der letzten Jahre sind alle Äußerungen, die dieser einfachen Erzählung widersprochen oder sie kompliziert haben, erstickt worden, zum Beispiel die Arbeit der Menschenrechtsorganisation Memorial, die versuchte, die Erinnerung an die Opfer von Unterdrückung und Gewalt in der Sowjetunion zu stärken. Es ist ein extremes Beispiel aus einem extremen Land, aber jegliche Geschichte wird in Form von Erzählungen vermittelt, so wie alle Nachrichten als Erzählungen vermittelt werden, und es ist immer die Rolle des Romans gewesen, sich unter diesen großen Erzählungen zu bewegen, sie formal und thematisch aufzubrechen, um so der konkreten Erfahrung der Wirklichkeit näherzukommen.
Cervantes’ Don Quijote, für viele der erste Roman und bis heute einer der bekanntesten, wovon handelt er? Vom jähen Ende der großen Erzählung in der Wirklichkeit; die Kollision zwischen der Romantik und dem Heldenmut der Rittersagen und der trivialen Welt, in der sich das Heer als gewöhnliche Schafherde und die Riesen als gewöhnliche, knarrende Windmühlen herausstellen. Laurence Sternes Tristram Shandy, ein anderer kanonisierter Roman, wovon handelt er? Von nichts! Er sabotiert die Erzählung und macht sich mit seinen Millionen Abschweifungen lustig über sie. Ganz zu schweigen vom großen Romanklassiker des Modernismus, James Joyces Ulysses, der nicht nur das Heldenepos Odyssee zu gewöhnlichem Alltag herunterbricht, sondern auch den Überbau der Geschichte herunterbricht, der allgemeinen und individuellen, indem es sie nur in Fragmenten an diesem einen Tag gibt, an dem der Roman spielt, und gleichzeitig relativiert er die Erzählung als Form, indem er zahllose unterschiedliche Erzählweisen auf dieselben Menschen am selben Tag anwendet.
Ulysses erschien 1920, fünf Jahre, bevor Lawrence seine Essays über den Roman schrieb, und man sollte meinen, dass er Joyces totale Demontage des Absoluten zu schätzen wusste. Doch das tat er nicht, im Gegenteil: Lawrence verabscheute Ulysses ebenso intensiv, wie er Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit verabscheute. In seinen Augen befanden sie sich auf dem Sterbebett des Romans und er ließ es sich nicht nehmen, sie zu verhöhnen:
Liegt Ulysses in seiner Wiege? Du meine Güte! Was für ein graues Gesicht! Und M. Proust? Wie traurig! Man hört das Todesröcheln in ihren Kehlen. Sie können es selbst hören. Sie lauschen ihm mit großem Interesse und versuchen festzustellen, ob die Intervalle Terzen in Moll oder Quarten in Dur sind. Was wirklich ziemlich infantil ist.
Da haben wir also den »ernsthaften« Roman, sterbend in einem langgezogenen, vierzehnbändigen Todeskampf und versunken, kindisch interessiert an dem Phänomen. »Habe ich ein Stechen in meinem kleinen Zeh gespürt oder nicht«, (nicht?) fragt jede Figur von Mr. Joyce oder Miss Richardson oder M. Proust.
Dass man Joyce und Proust zusammen mit Virginia Woolf hundert Jahre später als die literarischen Giganten ihrer Zeit betrachten würde, konnte Lawrence natürlich nicht ahnen. Ebenso wenig, dass ausgerechnet die Romane, die er verhöhnte, das ganze Genre revolutionierten. Und wenn man Lawrence liest, versteht man nur zu gut, dass er für die Qualität gerade dieser Romane blind sein musste. Sie alle – Joyce, Lawrence, Woolf und Proust – versuchten mit ihren Romanen, der Wirklichkeit nahezukommen. Aber während Lawrence dazu die Erzählung nutzte, bildete sie für die anderen drei ein Hindernis, sie war etwas, das den Roman von der Wirklichkeit ausschloss und überwunden werden musste, was zu einer formalen Explosion führte. Betrachten wir zunächst eine Textstelle aus Lawrences Der Regenbogen:
Während der letzten Monate ihrer Schwangerschaft war er in einem bedrohlichen, niedergedrückten Zustand, der nicht weichen wollte. Auch sie war bedrückt, und manchmal weinte sie. Es kostete zu viel Lebenskraft, wieder neu anzufangen, nachdem sie schon viel zu viel davon eingebüßt hatte. Manchmal weinte sie. Dann stand er stumm dabei und meinte, das Herz breche ihm entzwei. Denn sie wollte nichts von ihm wissen, sie wollte nicht einmal auf ihn aufmerksam gemacht werden. Sobald ein bestimmtes Zucken auf ihrem Gesicht erschien, wußte er, dass er sich zurückhalten mußte und sie nicht belästigen durfte. Denn das war der alte Kummer, der wieder in ihr aufstieg, der zurückliegende Verlust, der Schmerz über das Vergangene, den toten Mann, die toten Kinder. Das war ihr sicher heilig, und er durfte sie natürlich mit seinen Tröstungen nicht verletzen. Wenn sie etwas von ihm wollte, so würde sie gewiß von selber kommen. Und so stand er mit wehem Herzen abseits.
Es ist eine großartige Passage. Durchdrungen von Schicksal, von gelebtem Leben und psychologischer Einsicht. Es ist verständlich, dass es jemanden, der diese Zeilen mit Herzblut geschrieben hatte, provozieren musste, wenn er in Ulysses Folgendes las:
Bald eine Tasse Tee. Gut. Trockener Mund. Die Katze umschritt steif ein Tischbein, den Schwanz in der Höh. […] Just wie sie über meinen Schreibtisch stakt. Prr. Kraul mir den Kopf. Prr.
Mr. Bloom beobachtete neugierig, freundlich, die geschmeidige schwarze Gestalt. Sauberer Anblick: der Glanz ihres glatten Fells, der weiße Knubbel unter dem Knauf ihres Schwanzes, die grünen blitzenden Augen. Er bückte sich zu ihr hinab, die Hände auf den Knien.
»Milch für das Pussilein«, sagte er.
»Mrkgnau!«, schrie die Katze.
Die sollen nun dumm sein. Dabei verstehn sie besser, was wir sagen, als wir sie verstehn. Die da versteht haarscharf alles, was sie verstehen will. Ist auch nachtragend. Möchte wohl wissen, wie ich so wirke auf sie. Hoch wie ein Turm? Nein, springt mir doch glatt auf die Schulter.
»Angst vor den Hühnerchen hat sie«, sagte er spottend. »Angst vor den kleinen Putputputs. Wer hat wohl schon mal so ein dummes Pussilein gesehn wie unser Pussilein hier!«
Grausam auch. Ihre Natur. Komisch, die Mäuse quieken nie. Scheinens wohl gar zu mögen.
»Mrkrgnau!«, machte die Katze laut.
Der Unterschied zwischen den beiden Passagen hat mit Abstand zu tun. Lawrence geht es darum, den Gefühlen nahezukommen. Sie werden als etwas für sich – Depression, Trauer – beschrieben, sie werden zeitlich gedehnt und sind abstrakt. Joyce möchte dem Augenblick nahekommen. Und im Augenblick gibt es keine Erzählung, nur Handlungen und Gedanken, die noch nicht definiert sind. Die Erzählung erfordert einen größeren Abstand – es war der Tag, an dem der irische Anzeigenakquisiteur Bloom, mittleren Alters und jüdischer Abstammung, in der Küche saß und sich Gedanken über die Natur der Katze machte, während seine Frau Molly, die ihn ein paar Stunden später betrügen würde, in der oberen Etage schlief. Es ist der gleiche Abstand, den Virginia Woolf ein paar Jahre später in dem Roman Die Fahrt zum Leuchtturm bearbeitete. Der Rahmen hat praktisch keine Handlung – eine Familie in einem Sommerhaus, Mahlzeiten und Spaziergänge in der Küstenlandschaft –, man könnte sich vorstellen, dass sich das Ganze am besten in einer Serie von Urlaubsfotos des alten Schwarzweißtyps festhalten ließe: Hier sitzt die Familie zu Tisch, hier spielt die Familie im Garten Krocket und so weiter. Woolf geht ganz nah an jeden der Charaktere heran, wo sie enorme Mengen kleiner alltäglicher Emotionen freisetzt, während gleichzeitig die Beziehungen zwischen den Menschen geöffnet werden und das statische Bild von der Familie mit ihren Rollen vor Leben förmlich explodiert. Joyce und Woolf gehen unter die Erzählungen und expandieren den kleinen Zeitraum, den es dort gibt.
Warum?
Dort leben wir. Was uns definiert und bestimmt, was wir sehen, was wir glauben, was wir denken und von der Welt um uns verstehen, kommt von außen zu uns und ist meistens als Erzählungen organisiert. Hier sind wir innen. Hier sind wir im Augenblick, und nur im Augenblick entsteht etwas.
Ein anderes, wesentlich aktuelleres und näheres Beispiel für einen Roman, der im Grenzland zwischen dem Abstand der Erzählungen und der Nähe des Romans operiert, ist Internat des ukrainischen Autors Serhij Zhadan. Das Buch erschien 2017 in der Ukraine und handelt vom Konflikt im Donbass im Osten der Ukraine, wo bewaffnete russische Separatisten sich von der Ukraine losgesagt hatten, also in den Jahren vor dem russischen Angriffskrieg. Aber nichts von diesem Hintergrund ist angegeben, der Leser wird direkt ins Hier und Jetzt geworfen, wo alles auf Augenhöhe betrachtet wird durch den Blick Pashas, eines Lehrers in Donezk, der am Anfang des Romans seinen Neffen aus einem Internat am anderen Ende der Stadt abholen soll. Es ist auffällig, wie unklar alles erscheint, wer Freund oder Feind ist, wer mit Artillerie schießt, wer flieht. Er spricht mit Menschen, denen er begegnet, eine Sprache, mit anderen Leuten eine andere. Es gibt keine großen Linien, an die man sich halten könnte, alles ist in den Augenblicken aufgelöst, die er durchlebt, und damit ähnelt der Roman der ersten Szene von Stendahls Die Kartause von Parma, in der die Schlacht von Waterloo so anschaulich beschrieben wird, als befänden wir uns in der Geschichte, bevor sie Geschichte geworden ist, wo nur Chaos und Verwirrung herrscht. In Internat empfindet man es ähnlich, ein Ereignis, ein Krieg wird beschrieben, bevor er Geschichte wird – oder während er noch Wirklichkeit ist. Von innen, das ist der Ort des Romans –, im Unterschied etwa zum Journalismus, der von außen schaut und das Gesehene in eine bestimmte Erzählung gießt, es niemals offenlässt.
Ja, das ist der Roman: Er sieht die Welt von innen, und er lässt sie offen. Der Roman gibt dieser Erfahrung eine Sprache, wodurch sie einen Ort bekommt. Diesen Ort gibt es nirgendwo sonst. Er existiert nicht im Film, nicht im Journalismus, nicht im Sachbuch, nicht in Philosophie oder Psychologie, nicht in Biologie oder Chemie, auch nicht in der Religion. Dieser Ort, die Welt von innen betrachtet, offengehalten, existiert nur im Roman. Es ist die Aufgabe des Romans, den Weg dorthin zu finden, wo noch nichts definiert ist, was den wenigsten gelingt, denn der Roman benutzt die gleiche Sprache und die gleichen Erzählungen, von denen die Wirklichkeit definiert wird, und der Schriftsteller hat natürlich auch seine bestimmte Auffassung davon, wie die Welt ist, und all das fließt in den Roman ein, wenn er geschrieben wird. Deshalb beeindruckte mich Kleine Dinge wie diese so sehr, er ist im Innen und hält es offen.
Es gibt eine weitverbreitete Vorstellung, dass der Roman wichtig ist, wenn er von etwas Wichtigem handelt, insbesondere, wenn dieses Wichtige aktuell ist. Aber dass sein Thema wichtig ist, entscheidet niemals darüber, ob der Roman es ist. Für den Roman kann das eher ein Problem sein, denn zum Wichtigen hat man oft klare Meinungen, die im Voraus da sind, und alles, was im Voraus da ist, bildet ein Problem für den Roman, denn wichtig macht ihn ja gerade, dass er etwas eine Sprache gibt, was keine Sprache hat, was sonst nicht zur Sprache käme, und da über das Wichtige überall gesprochen wird, ist das Wichtige ein Gebiet, in dem der Aufenthalt für den Roman schwierig ist. Er kann es schaffen, wenn er dem Wichtigen so nahekommt, dass er der Meinung darüber entrinnt.
Nun könnte man einwenden, was ist der Wert von Nähe?
Eine gute Frage, aber nicht besser als die Gegenfrage, was ist der Wert einer Meinung?
Eine Meinung zu etwas zu haben, heißt die Kontrolle darüber zu übernehmen. Das ist eine aktive Handlung. Um etwas nahe zu sein und sich davon ausfüllen zu lassen, ist das Gegenteil erforderlich, es kommt darauf an, die Kontrolle aufzugeben und passiv zu sein. Ob man eine Meinung zu etwas hat oder etwas nahe ist, bildet den Unterschied zwischen Raum einnehmen und Raum lassen. Ersteres hat in unserer Kultur zweifellos Vorrang, und das Passive, nicht zu handeln, wird nicht sonderlich geschätzt.
Das klingt abstrakt und sagt ohne konkreten Kontext vielleicht nicht viel aus. Aber wenn wir uns nun erneut Keegans Roman und seiner Welt zuwenden, sehen wir, dass diese Haltung auf allen Ebenen des Romans verankert ist. Der Roman gibt einem Mann Raum, der selbst keinen Raum in der Handlung einnimmt, noch dazu einem Mann, der aus einer Gesellschaftsschicht stammt, die keinen Raum in der Kultur einnimmt. Am wichtigsten ist jedoch, dass der Roman etwas in ihm Raum lässt – und damit in uns –, das so filigran und flüchtig ist, dass er selbst sich dessen nicht bewusst ist und es erst im Romantext sichtbar wird.
Einer der besten Romane, die ich jemals gelesen habe, mit der vielleicht größten Bedeutung für die Gedanken über den Roman in diesem Text, ist Die Vögel von Tarjei Vesaas von 1957. Die Hauptfigur in Die Vögel ist ein Mann um die vierzig namens Mattis, der mit seiner Schwester Hege in einem kleinen Haus an einem See am Rand eines Walds lebt. Mattis ist wie ein Kind, mit anderen Menschen kommt er nicht zurecht, weil er die sozialen Codes nicht versteht. Manchmal arbeitet er als Tagelöhner auf einem der Höfe im Ort, richtet aber mehr Schaden an, als nützlich zu sein – wenn jemand ihm Arbeit gibt, geschieht es ihm zuliebe –, so dass er die meiste Zeit für sich ist. Mattis ist das, was man früher zurückgeblieben nannte.
Im Roman haben wir vollen Zugang zu seinen Gedanken. Wir sehen, wie ihn die Begegnung mit anderen einschränkt und alles unmöglich macht, aber wir sehen auch, wie seine Gedanken sich ausbreiten und reich werden, wenn er allein ist und ihnen nichts im Weg steht. Wenn das Entscheidende an John Furlong ist, dass er gut ist, dann ist es bei Mattis, dass er dem Dasein nahe ist. Er ist niemand, der etwas macht – das kann er nicht –, er ist einfach. Und dieses Sein ist randvoll mit dem Dasein um ihn herum gefüllt – dem der Schwester, aber auch dem der Vögel, der Bäume, des Himmels, des Sees. Statt nahe könnte man auch offen sagen. Der Autor ist offen für die Sprache, die Sprache ist offen für Mattis, Mattis ist offen für das Dasein. Es durchströmt ihn, durch die Sprache, und über die Sprache durchströmt es den Leser.
Die Konflikte, die in Die Vögel artikuliert werden, sind die eines Idioten, auf den keiner hört, für den sich keiner interessiert und der nirgendwo zu Wort kommt – auch weil sein Wesen so ist, dass es ihm unmöglich ist zu kommunizieren, es folgt einer anderen Logik, und diese andere Logik wird in der Begegnung mit der Normalität kontinuierlich erstickt. Es ist nicht so sehr Mattis’ Wesen, worum es geht, sondern dass die Welt darin auf eine andere Art gefiltert wird, und das bedeutet auch keine Kritik an der Normalität, die trotz allem das ist, was auch Mattis am Leben erhält. Der Roman macht etwas sichtbar, das ansonsten in den Schatten verborgen liegt, die unsere Gedanken und Handlungen werfen. Im Passiven, dem Willenlosen, dem Handlungslosen wird etwas sichtbar, es ist die Welt zu ihren eigenen Bedingungen, und wenn sie zerstört werden kann, dann weil wir sie zu unseren Bedingungen sehen. Nicht bewusst, dies liegt tiefer als die Gedanken und hat mit Überleben zu tun – wir müssen handeln, wir müssen produzieren, wir müssen benutzen. Nur ein Roman kann diese beiden widersprüchlichen Logiken gleichzeitig aufrechterhalten, und nur ein Roman ist in der Lage, die wichtigsten Konflikte zu artikulieren, in denen wir stecken, ohne sie in Definitionen festzulegen, indem er sie für die Gefühle und Erfahrungen offen stehen lässt.
Das ist das Wichtigste von allem, denn Veränderung muss von innen kommen, dort leben die Haltungen und Vorstellungen über die Welt und uns selbst, und genau dorthin zieht es immer den Roman. In den norwegischen Idioten, in den irischen Holzverkäufer, in den ukrainischen Lehrer. Das ist die Aufgabe des Romans, in die Welt hineinzugehen und sie offenzuhalten, und weil er das tatsächlich kann, ist er wichtig.
(2022)
WIE ICH AMERIKA NICHT ENTDECKTE
Neufundland
vor etwas mehr als einem Jahr habe ich meinen Führerschein verloren. Es passiert mir ständig, dass ich Dinge verliere. Kreditkarte, Pass, Autoschlüssel, Geld, Bücher, Taschen, Computer. Ich mache mir deshalb keine Sorgen, in der Regel tauchen die Sachen wieder auf. Als ich neulich in Paris war, rief mir ein Mann auf der Straße hinterher, Hallo, Sie haben etwas verloren, und lief mir mit meinem Portemonnaie in der Hand hinterher, es hatte in der Innentasche des Jacketts gesteckt und war offenbar herausgefallen, als ich mir das Jackett über die Schulter geworfen hatte. Als ich das letzte Mal in New York war, vergaß ich meinen Rucksack in einem Taxi. Ich war mit drei meiner Kinder unterwegs und war leicht gestresst, als wir ausstiegen. Sowohl ihre Pässe als auch meiner steckten in dem Rucksack, darüber hinaus mein Notebook, auf dem alles, was ich in den letzten zwanzig Jahren geschrieben habe, gespeichert war. Ich unterhalte mich sonst nie mit Taxifahrern, aber dieser war so freundlich gewesen, dass ich ihn schließlich gefragt hatte, woher er kam, wie lange er schon in New York lebte, ob es ihm dort gefiel, ob er Kinder hatte. An einer Ampel hatte er sogar ein Foto von seinen Kindern herausgeholt, das er mir zeigte. Als wir an diesem Nachmittag ins Hotel zurückkamen, ohne Pass und Computer, fragte ich den Portier, was wir tun könnten. Er schüttelte nur den Kopf und meinte, dass ich es wohl vergessen könne, meinen Rucksack zurückzubekommen. Das ist New York, sagte er. Aber er stammte aus Nepal, erwiderte ich. Und er hatte zwei Kinder. Tut mir leid, sagte der Portier, ich glaube nicht, dass dies eine große Hilfe sein wird. Aber sie können den Rucksack selbstverständlich als verloren melden. Dann kam der Türsteher zu uns, er hatte unser Gespräch mitgehört und meinte, er kenne ein paar Leute aus Nepal, solle er sie für mich anrufen? Das tat er, und kurze Zeit später traf ich mich vor dem Hotel mit ihnen. Anhand meiner Beschreibung identifizierten sie den Fahrer, und am nächsten Morgen wartete mein Rucksack an der Rezeption auf mich.
Solche Dinge passieren häufig, meiner Erfahrung nach geht es immer gut aus. Außerdem, denke ich insgeheim, gibt es eine Redensart, die besagt, dass jemand, der Geld verliert, Geld bekommen wird, und ich glaube, das stimmt, denn wenn man Dinge verliert, passt man nicht ununterbrochen auf, ist man nicht darauf aus, alles ständig zu kontrollieren, ist man nicht dauernd so verdammt kleinkariert, und wenn man das nicht ist, sondern der Welt offen gegenübersteht, kann so ziemlich alles zu einem kommen.
Wenn ich das denke, weiß ich, dass es zutrifft, aber gleichzeitig auch, dass ich das sage, um meine zahlreichen Fehler und Mängel und Schwächen in Stärken zu verwandeln. Es ist gut, dass ich mich nicht traue, mit anderen als meinen allerengsten Freunden zu telefonieren. Es ist gut, dass ich es immer weiter aufschiebe, meine Rechnungen zu bezahlen, mit Vorliebe, bis ein Inkassobüro eingeschaltet worden ist. Es ist gut, dass ich nie die Schecks einlöse, die ich regelmäßig bekomme, weil ich dieselbe Rechnung versehentlich zwei oder drei Mal bezahlt habe. Es bedeutet, dass ich Schriftsteller bin, denke ich, nicht so fokussiert auf weltliche Dinge, was wiederum bedeutet, dass ich eines Tages vielleicht ein Meisterwerk schreiben werde.
Als der Führerschein nicht wieder auftauchte, sondern verschwunden blieb, gehörte dies deshalb in die gleiche Kategorie, wurde es zu einem Teil des Stoffs, aus dem ein Schriftsteller besteht. Außerdem konnte ich auch ohne ihn fahren, denn dort, wo ich wohne, gibt es ohnehin nie Polizeikontrollen.
Als sich dann Mitte Dezember The New York Times bei mir meldete und fragte, ob ich durch die USA reisen und für sie darüber schreiben wolle, dachte ich im ersten Moment nicht an den Führerschein. Sie schlugen vor, dass ich nach Neufundland fahren und mir den Ort ansehen solle, an dem die Wikinger sich angesiedelt hatten, um danach ein Auto zu mieten und nach Süden zu fahren, in die USA und die ganze weite Strecke westwärts bis Minnesota, wo die meisten norwegischen Einwanderer gelandet waren, und darüber zu schreiben. »A tongue in cheek Tocqueville«, wie der Redakteur sich ausdrückte.
Ich sagte auf der Stelle zu. Ich hatte gerade die Isländersagas gelesen und über sie geschrieben, und die Chance, den Ort zu sehen, an dem zwei von ihnen spielten, wo die Wikinger in Amerika an Land gegangen waren und Häuser gebaut hatten, das Gebiet, das sie Vinland nannten, konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen.
Ich habe mich nie besonders für amerikanische Kultur interessiert, vielleicht auch, weil sie in meinem Leben stets auf eine ganz selbstverständliche Art so präsent war, dass sie nichts zu sein schien, worauf man neugierig sein musste, so wie man sich auch nicht mit Hochspannungsleitungen oder Leitplanken, Aufzügen oder Kaffeemaschinen beschäftigt. Die amerikanische Natur fasziniert mich dagegen seit Langem. In den amerikanischen Filmen und Fernsehserien, die ich schaue, ist sie mehr oder weniger abwesend, genau wie in den amerikanischen Romanen, die ich lese. Nicht nur, weil sie hauptsächlich in den Städten spielen, auf Straßen und in Wohnungen, in Clubs und Hotellobbys, auf Parkplätzen und in Einkaufszentren, in Vorstädten, unter Brücken, auf Autobahnen und in Yachthäfen, in Parks und Hinterhöfen, sondern auch in dem Sinn, dass die Natur keine Rolle zu spielen scheint, offenbar keinen Einfluss hat, nichts zu prägen scheint. Wenn die Natur überhaupt sichtbar ist, bildet sie die Kulisse, vor deren Hintergrund sich das eigentliche Leben abspielt. Aber sie ist ja da, das weiß ich, auch in den USA gibt es Wälder und Seen, Berge und Flüsse, Schluchten und Abgründe, Bäume und Wiesen, Wäldchen und Lichtungen, und wenn ich amerikanische Filme sehe, die sich außerhalb von Stadtlandschaften bewegen, ist es das, worauf ich starre, die Natur im Hintergrund, die gerade dadurch, dass sie amerikanisch ist, sich also in dem Land befindet, das seine Wirklichkeit im höchsten Maß von allen fiktionalisiert hat, eine enorme Anziehungskraft und Ausstrahlung besitzt.
Außerdem hat die amerikanische Natur etwas Exotisches, weil vieles an ihr der Natur ähnelt, die ich kenne, aber dennoch anders ist, weil die Kultur, die sie umgibt, anders ist. So ähneln Teile der Landschaft in Maine der Gegend, in der ich im südlichen Norwegen aufgewachsen bin, und wenn ich sie in einem Film sehe, wo das Heimische abrupt etwas Fremdes geworden ist, kann ich einen plötzlichen Stich von etwas verspüren, das Glück ähnelt.
Es ist seltsam, das gebe ich zu.
Was macht ein so großes Gefühl in Gesellschaft einer so kleinen Erkenntnis?
Ich glaube, was sichtbar wird, ist das Utopische in einem kräftig minimalisierten Maßstab: Eine andere Welt ist möglich und damit auch ein anderes Leben.
Einige Wochen später saß ich an Bord eines Flugzeugs von London nach Toronto. Ich hatte Fieber, und nachdem ich mich an diesem Morgen mit schmerzenden Gliedern durch sämtliche Warteschlangen und Kontrollen auf Heathrow gekämpft hatte, wäre es mir lieb gewesen, wir flögen ewig, dass es niemals enden würde, ich wollte einfach nur dort sitzen und Filme sehen und dösen, wollte fort von allem. Ab und zu stoppte ich den Film und wechselte zur Karte, um zu sehen, wo wir waren. Wir flogen über Island, nach Grönland hinauf und über den amerikanischen Kontinent. Es war die Route, auf der die Wikinger tausend Jahre zuvor gesegelt waren. Als wir das Thema in der Schule durchnahmen, kam es einem vor, als gehörten diese Ortsnamen auch der Mythologie an, ich stellte mir niemals wirklich vor, dass es tatsächlich geschehen war, selbst als wir in der neunten Klasse die authentischen Wikingerschiffe in Oslo besichtigten, begriff ich es nicht wirklich. Es war, als gehörten die Schiffe mit ihren handfesten Planken, ihren geschnitzten Drachenköpfen und Reihen von Ruderlöchern der physischen Welt an, während alles, was ich über sie gelesen hatte, zur immateriellen Welt der Bücher und Fantasien gehörte. In dieser Welt war Island »Island«, Grönland »Grönland« und die Entdeckung von »Amerika« ein Märchen. Dass Helge Ingstad 1960 den genauen Ort lokalisiert hatte, an dem die Wikinger ihre Häuser gebaut hatten, an der Nordspitze von Neufundland, in der Nähe einer kleinen Ortschaft namens L’Ance aux Meadows, und seine Frau, Anne Stine Ingstad, dort in den sechziger und siebziger Jahren die Ausgrabungen geleitet hatte, die jeden Zweifel daran zerstreuten, dass das Märchen der Wahrheit entsprach, legte sich lediglich als eine neue Schicht von Erzählung auf das Ganze. Ich hatte viel über L’Ance aux Meadows gelesen, in den Siebzigern war die Sache häufig in den Nachrichten, meine ich mich zu erinnern, aber kein einziges Mal war mir in den Sinn gekommen, dass tatsächlich die Möglichkeit bestand, dorthin zu reisen.
Jetzt war ich unterwegs.
Dass die Wikinger den amerikanischen Kontinent früher oder später entdecken würden, war vollkommen logisch. Sie stammten von der weitläufigen und rauen norwegischen Atlantikküste, aus einer Landschaft voller Fjorde und Berge, in der Boote natürliche Verkehrsmittel waren und die Fischerei einen wichtigen Wirtschaftsfaktor bildete. Mit der Zeit entwickelten sie seetüchtige Schiffe, sowohl Kriegs- und Frachtschiffe als auch Handelsschiffe, und mit ihrer Hilfe erweiterten sie allmählich die ihnen bekannte Welt. Sie fuhren zu den Hebriden, den Orkney- und den Shetlandinseln, sie fuhren nach Irland, Schottland, England und Frankreich. Ende des neunten Jahrhunderts besiedelten sie Island, ein paar Generationen später entdeckten sie Grönland und besiedelten es auch. Von der grönländischen Westküste ist der amerikanische Kontinent mit einem Segelschiff nur ein paar Tage entfernt. Angesichts des Treibholzes, das bei ihnen angetrieben wurde, müssen sie verstanden haben, dass es noch weiter draußen Land gab. Und selbst wenn sie nicht bewusst weiter nach Westen gesegelt waren, aus Abenteuerlust oder Not, standen die Chancen gut, dass es eher zufällig dazu kam: Sie kannten weder Kompass noch Sextant, manövrierten stattdessen anhand der Himmelskörper und kamen bei Nebel, der in diesen Gewässern häufig auftrat, nicht selten weit vom Kurs ab. Den beiden Isländersagas zufolge, die sich der Entdeckung des neuen Kontinents widmen, war genau das geschehen. Ein Schiff kam vom Kurs ab und entdeckte eine Landschaft, die keiner an Bord je zuvor gesehen und von der niemand gehört hatte. Sie gingen nicht an Land, folgten dem neuen Land jedoch in nördlicher Richtung, ehe sie Kurs nach Osten nahmen und Grönland erreichten. Dort erzählten sie, was sie gesehen hatten, und im Jahr darauf brach ein Schiff mit einer fünfunddreißigköpfigen Mannschaft auf, um der Sache nachzugehen. Das erste Land, das sie sahen, nannten sie Helleland – aller Wahrscheinlichkeit nach war es Buffin Island –, das nächste tauften sie Markland, was wahrscheinlich Labrador ist, und das dritte nannten sie Vinland. Dort gingen sie an der Nordspitze an Land, dort bauten sie sich Häuser, und dort blieben sie ein Jahr, ehe sie nach Grönland zurückkehrten. Zwei weitere Expeditionen folgten, sie benutzten dieselben Häuser und blieben ebenfalls nur kurz. Danach verschwinden die Häuser und der Kontinent aus der Geschichte, so als gäbe es ihn nicht oder mehr oder minder nur in Gestalt der beiden Erzählungen.
Die Maschine landete am Nachmittag in Toronto. Der Himmel war vollkommen grau, die Luft voller Schnee. Das Fieber hatte nicht nachgelassen, und ich schleppte mich zu dem Gate, von dem der Flug nach St. John abgehen sollte, durch die endlosen Gänge. Gab das Gepäck erneut auf, ging erneut durch die Sicherheitskontrolle, konnte mich endlich setzen und warten. Ich war auf nordamerikanischem Boden, aber was ich hier sah, unterschied sich nur wenig von dem, was ich am Morgen in London gesehen hatte. Der einzige große Unterschied war, dass die Leute durchgängig dicker waren und kaum einmal elegant gekleidet waren, sondern Freizeitkleidung trugen, die sie anscheinend bei Ketten gekauft hatten, dass die meisten Männer eine Kappe trugen und es an den Kiosken kaum Zeitungen gab. Oder es war einfach nur so, dass der schmerzende Körper die Sinne irgendwie beschäftigt hielt, so dass alles, was ich sah, außerhalb von mir blieb, als etwas zutiefst Unwichtiges. In gewisser Weise war es herrlich, denn normalerweise strömte alles, was ich sah, mit Gewalt in mich hinein, und auf Flughäfen mit ihrer Flut von Eindrücken ließ mich das häufig verwirrt und verzweifelt zurück. Hier jedoch nicht. Dennoch war ich besorgt, denn die erlösende Mail mit dem Dokument darüber, dass ich tatsächlich einen Führerschein besaß, war noch nicht gekommen. Und was sollte ich dann tun?
Ich hatte zehn Tage Zeit, um die Siedlungen der Wikinger auf Neufundland zu besichtigen und von dort in die USA hinunter und nach Minnesota zu fahren, von wo der Rückflug abging. Ich hatte geplant, morgens drei Stunden zu schreiben, danach acht Stunden am Tag zu fahren, und bei jeder interessanten Sache, die mir ins Auge fiel, würde ich dem Fotografen, der zwei Tage später meiner Spur folgen sollte, eine Mail schicken.
Ohne Führerschein würde doch alles den Bach hinuntergehen.
Wie hatte ich nur so dumm sein können, die Angelegenheit vor meiner Abreise nicht zu regeln?
Wie schwierig konnte es sein?
Weihnachten war mit so viel Stress verbunden gewesen, wir hatten erst zu Hause gefeiert, waren dann zu meiner Mutter nach Norwegen hinaufgefahren, um anschließend wiederum das Flugzeug nach Hause zu nehmen und eine Silvesterparty zu organisieren, so dass ich nicht die erforderliche Tatkraft besessen hatte, die Papiere für einen neuen Führerschein abzuschicken. Stattdessen hatte ich ein paar Tage vor Silvester der Botschaft in Washington eine Mail geschickt und mich erkundigt, ob sie das für mich regeln könnten. Das konnten sie nicht. Danach hatte ich darauf gesetzt, bei der Behörde anrufen zu können, wenn ich im Flughafen von Kopenhagen ankam, was der erste Tag war, an dem die Büros wieder geöffnet hatten, und dass sie das Dokument dann an die Botschaft faxen konnten, die es mir daraufhin zumailte. Das alles hatte ich getan, und man hatte mir versprochen, es am Vortag zu schicken. Aber es hatte sich wie gesagt nichts getan.
Dann muss ich eben bis Montag warten, dachte ich und stützte meinen schmerzenden Kopf in die Hände. Es war keine Katastrophe, ich verlor nur einen Tag und würde den Rückflug von Minnesota aus weiterhin erreichen können.
Ich traf in der abendlichen Dunkelheit mit Fieber in St. John ein und verließ die Stadt ein paar Stunden später gesund und munter, ohne etwas anderes von ihr gesehen zu haben als einen kleinen, beleuchteten Teil des Hafens von meinem Hotelzimmer aus, das ich bekommen hatte, weil ich auf die Frage, ob ich ein Zimmer mit »Meerblick« haben wolle, als ich es in London buchte, bestätigend geantwortet hatte. Das Wort »Meerblick« hatte in mir die Vorstellung geweckt, dass St. John eine kleine, gemütliche Hafenstadt mit kleinen, windschiefen Häusern, altmodischen Kneipen und Booten war, auf denen Krabben über die Reling hinweg verkauft wurden. Und vielleicht war der Ort ja auch so, zumindest außerhalb des Industriegebiets mit seinen Tankern und Kränen, auf das ich hinabblickte.
Das Flugzeug nach St. Anthony, das in aller Herrgottsfrüh abging, war klein, eingesetzt von Provincial Airlines, mit zwei Piloten und einer Flugbegleiterin an Bord, und eiskalt: Als wir einstiegen, waren es draußen gut und gerne zehn Grad unter null. Die Landschaft unter uns war flach und karg und bestand größtenteils aus glattgeschliffenen Felsen, aber auch vereinzelten Arealen, auf denen niedrige Fichten wuchsen. Hier und da eisbedeckte Seen, viele von ihnen ohne Schnee, bestimmt, weil die Winde, die vom Meer kamen, sie sauberfegten. Aber nicht ein Haus, nicht ein Boot, nicht ein Zeichen von Leben irgendwo.
Meine Augen folgten gelegentlich der Flugbegleiterin. Sie war nicht schön, ihr Gesicht war irgendwie leicht schief, dennoch war sie sehr anziehend. Es mochte an dem seltsamen Akzent liegen, mit dem sie Französisch sprach, als sie die Sicherheitshinweise vortrug, es mochte an den Lederhandschuhen liegen, die sie benutzte, und in der die Hand steckte, die den Telefonhörer hielt, es mochte an der blauen Uniform liegen, es mochte an all den sicheren Bewegungen liegen, die sie ausführte, als sie in dem kleinen Raum der Maschine ihrer Arbeit nachging.
Oder es lag einfach an ihrer Rolle, dass sie frei war und sich hin und her bewegte, während wir anderen still auf unseren Plätzen saßen, wodurch sie herausstach.
Als das Flugzeug langsam einen Bogen flog und der Landeanflug begann, war die Sonne herausgekommen. Der Flugplatz lag mitten in einer großen Ebene, umgeben von Fichten, und abgesehen von einigen Hütten, die mir ins Auge fielen, schien es in der Nähe keine Bebauung zu geben.
Ich ging die Flugzeugtreppe hinunter und über den Asphalt zu der kleinen, barackenartigen Ankunftshalle. Es war furchtbar kalt. Ich warf einen Blick auf mein Handy, im Freien waren es siebzehn Grad unter null. Aber es war wenigstens windstill.
Drei dicke junge Männer in Arbeitsoveralls saßen entspannt an einem Tisch und unterhielten sich, zwei dicke Frauen standen hinter einer Theke; dort saß auch ein schlanker Mann in einem blauen Hemd, er mochte Anfang sechzig sein. Als ich hereinkam, sahen mich alle an. Ich stellte mich etwas abgewandt in die Ecke, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen, während ich mir die anderen Passagiere ansah, die eintraten und von denen die meisten sich zu kennen schienen.
Das Gebäude war renovierungsbedürftig; an der Tür hingen Kabel von der Decke herab, die Wand dahinter war frisch errichtet worden und wirkte provisorisch, sie war aus einem anderen Material als der Rest, aus mehreren der Kunstledersitze quoll die Füllung heraus. Es ist fast schon eine Regel, dachte ich. Je weiter man nach Norden kommt, desto weniger Geld gibt es, und je rauer das Klima ist, desto stärker gewinnt Funktionalität die Oberhand über Ästhetik. Wer macht sich schon Gedanken über sein Aussehen, wenn es minus fünfundzwanzig Grad sind und der Wind vom Meer weht?
Der Ort erinnerte mich an Nordnorwegen, wo ich vor langer Zeit einmal ein Jahr gelebt hatte; auch die Stimmung unter den Menschen im Raum war ähnlich, ihre Vertrautheit untereinander.
Ich ging nach draußen, um eine zu rauchen. Eine Frau mittleren Alters in einer schwarzen Canada Goose-Jacke folgte mir. Sie sagte etwas über »smoke«, das ich nicht verstand, ich lächelte und nickte, drehte mich weg und schaute auf den Parkplatz hinaus. Dort standen fast nur große, robuste Autos, Pickups und SUVs. Aber keine Taxis? Wo waren die Taxis? Gab es hier keine Taxis?
Ein Gefühl von Panik überkam mich. Ich starrte um mich herum. Nirgendwo war ein Taxischild zu sehen, und auch kein Taxi. Wie sollte ich in den Ort kommen? Fuhr ein Bus?
Nein, es war auch kein Bus in der Nähe.
Und es war so verflucht kalt!
Ich warf die Zigarette von mir, ging wieder hinein und zu dem Tisch mit den drei Männern.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Gibt es hier Taxis?«
»Da müssen Sie mit dem da reden«, sagte der eine und zeigte auf den Mann in dem blauen Hemd. Ich ging zu ihm und wiederholte meine Frage.
»Ja«, sagte er.
Ich sah ihn an. Es hatte nicht den Anschein, als wollte er noch etwas sagen, und ich wollte nicht dumm erscheinen, so dass ich lediglich nickte und zu meinem Platz zurückkehrte.
Dann gab es hier jedenfalls Taxis.
Als das Gepäck kam, behielt ich den Mann in dem blauen Hemd im Auge. Er nahm den Koffer einer Frau und rollte ihn für sie hinaus. Ich folgte ihnen zu einem dunkelblauen und schmutzigen Kleinbus. Er riss mir wortlos den Koffer aus der Hand und warf ihn hinein.
»Ist das das Taxi?«, fragte ich.
Er antwortete mir nicht, vielleicht, weil ich so leise gesprochen hatte, und ich setzte mich zögernd hinein. Ein paar Minuten später war der Wagen halb voll, und der Fahrer, denn das war er offensichtlich und kein Flughafenangestellter, setzte ihn in Bewegung. Als wir auf die Straße kamen, die Sonne vor uns, gab er Gas, und kurz darauf sausten wir an einer endlosen Reihe von Fichten vorbei. Auf einem Schild las ich, dass es bis St. Anthony fünfzig Meilen waren. Unterwegs begegneten wir drei Autos und kamen an einem Mann vorbei, der eine Motorsäge in der Hand hielt und neben einem Pickup Brennholz kleinsägte. Ansonsten war alles leer und sonnendurchflutet, die Straße frei und die Erde zu beiden Seiten von einer dünnen Schneeschicht bedeckt.
Einer der anderen Fahrgäste wollte ebenfalls zum Hotel. Dem Gespräch, das er mit der Frau an der Rezeption führte, entnahm ich, dass wir nur vier Gäste waren. Als ich an der Reihe war, fragte ich sie, ob es ein Taxi gäbe, das mich etwas später nach L’ance aux Meadows fahren könne.
»Aber da ist alles geschlossen«, sagte sie. »Sie wollen jetzt dahin?«
Ich nickte. Sie griff nach dem Telefonhörer und sah mich dabei an. Sie war zwischen sechzig und siebzig, trug eine Brille, hatte lockige, rotgrau melierte Haare und sah ein wenig streng aus.
»Ich glaube nicht, dass man Sie bis ganz nach draußen fahren kann.«
»Das ist in Ordnung«, erwiderte ich.
Sie hielt weiter den Hörer in der Hand.
»Außerdem wird es teuer. Möchten Sie, dass es da draußen auf Sie wartet?«
Ich nickte. Endlich rief sie an. Es war offenbar kein Problem. Für zweihundert Dollar würde man mich fahren.
Es war nur ein Zimmer, aber es war groß und hatte eine Küchenzeile, wo man sich etwas zu essen machen konnte. Die Badewanne war von einer Art, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, Wand und Wanne waren in einem Stück gegossen, und ich stand eine Weile davor und fragte mich, wie sie das Ding ins Zimmer bekommen hatten; ich konnte nirgendwo eine Fuge entdecken, aber war das wirklich möglich?
Das Telefon klingelte, und ich eilte hinaus und hob ab.
»Hallo?«, sagte ich.
»Kommen Sie in die Rezeption«, sagte die Frau.
Es stellte sich heraus, dass ihr Mann mich fahren konnte. Er hatte einen Wagen mit Allradantrieb, der die ganze Strecke bis da draußen bewältigen könnte, das hieß, wenn die Straße nicht gesperrt war, außerdem werde er nicht so viel Geld dafür verlangen, erklärte sie mir. Ich begrüßte ihn, er hieß Pierce, war zwischen sechzig und siebzig, hatte freundliche Augen hinter den Brillengläsern in seinem zerfurchten Gesicht. Er sagte, für morgen seien große Mengen Schnee gemeldet, und dass es wahrscheinlich die letzte Chance für lange Zeit sei, dorthin zu kommen. Wir verabredeten, uns eine halbe Stunde später in der Rezeption zu treffen. Ich ging wieder auf mein Zimmer, öffnete die Tür zur Terrasse und zog mehrere Male an einer Zigarette – es war viel zu kalt, um dort länger zu rauchen. Dann zog ich die lange Wollunterhose an, eine Hose, zwei dicke Pullover, eine gefütterte Outdoorhose und schließlich die winddichte Jacke, die ich mir für diese Reise gekauft hatte, darüber hinaus gefütterte Fäustlinge, eine Mütze und einen langen dicken Schal.
Als ich kam, saß Pierce wartend auf der Couch. Wir gingen zu seinem Auto hinaus, die Windschutzscheibe glitzerte im Licht der tiefstehenden Sonne. Der Himmel war leuchtend blau.
Schönes Auto, sagte ich, als ich eingestiegen war. Er lächelte, ließ den Motor an und fuhr den sanften, leicht schneebedeckten Anstieg hinauf. Direkt vor uns auf der anderen Seite der Hauptstraße, die durch die kleine Stadt führte, lag ein Altersheim. Links davon stand ein größeres gelbgraues Backsteingebäude, das, erkannte ich, ein Krankenhaus war. Die Flagge davor war auf halbmast gehisst. Das Hotel war auf irgendeine Art damit verbunden, denn in der Lobby hatten lokale Schwarzweißaufnahmen gehangen, offenbar von der Jahrhundertwende, auf denen ein Arzt im Mittelpunkt stand, und darüber hinaus gab es neben der Rezeption eine Glasvitrine voller alter medizinischer Geräte. War es das alte Krankenhaus gewesen?
Gehört Ihnen das Hotel, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf und lachte. Oh nein, sagte er. Ich deutete es so, dass er dort eine Art Hausmeister oder Mädchen für alles war, sicher war ich mir jedoch nicht, denn er sprach in einem breiten Dialekt und war schwer zu verstehen.
Das ist unser Einkaufszentrum, sagte er und nickte nach links, zu einem fast fensterlosen, klotzartigen Gebäude, das sich ein kleines Stück weiter mitten auf einem Parkplatz erstreckte. Und das ist Jungle Jims Eatery, fuhr er fort und nickte in Richtung eines Gebäudes auf der anderen Straßenseite.
Wenige Minuten später hatten wir die Stadt hinter uns gelassen. Pierce redete ununterbrochen, ich nickte und sagte Ja und Aha, während ich versuchte, Sinn in die Worte zu bringen, die ich verstand. Er hatte sein ganzes Leben in dieser Gegend verbracht, war in einem Dorf in der Nähe aufgewachsen und vor ein paar Jahren nach St. Anthony gezogen, er hatte als Fischer und Bootsbauer gearbeitet, eventuell auch in einer Autowerkstatt, und ihm war ein Herzschrittmacher eingesetzt worden, so viel verstand ich. Während er erzählte, schaute ich zu den Reihen aus niedrigen Fichten hinaus, schwarz in den Schatten, dunkelgrün im Sonnenlicht, an manchen Stellen mit Flecken aus funkelnd weißem Schnee.
Nach einer Weile bogen wir an einer Kreuzung rechts ab, und als ich das Schild mit L’Ance aux Meadows zum ersten Mal sah, lief mir ein Schauer über den Rücken.
Ich war da.
Bald tauchten Reklameschilder für Übernachtungsmöglichkeiten und Gaststätten auf, die Namen mit Wikingerbezug hatten, irgendwo sah ich »Snorre Cabins« und fragte mich, ob der Name auf den Isländer anspielte, der die Heimskringla geschrieben hatte, oder ob es dabei um das Kind ging, von dem die Saga erzählt, es sei in dem ersten Winter, den die Wikinger in Vinland verbrachten, geboren worden. Denn nur ein paar Kilometer von hier war Snorre zur Welt gekommen, als das erste europäischstämmige Kind in Amerika, vor ziemlich genau eintausend Jahren.
Es ist nicht weiter seltsam, dass die Wikinger Amerika entdeckten, seltsamer ist, dass sie nicht blieben, sondern wieder heimkehrten. Grönland ist eine arktische Insel mit extrem rauem Klima und als Wohnort eine Herausforderung, selbst für einen Menschenschlag, der an schwierige Existenzbedingungen gewöhnt ist. Die wenigen Bäume, die es dort gab, verschwanden schnell, und es reichte schon, wenn Kleinigkeiten schiefgingen, um die Haustiere im Winter zugrunde gehen zu lassen. Verglichen damit muss Neufundland das reine Paradies gewesen sein. Reichlich Wild, jede Menge Fisch und Robben und Wale, genügend Gras für die Haustiere, warme, schöne Sommer. Außerdem müssen sie gesehen haben, dass das Land in südlicher Richtung weiterging und noch fruchtbarer und üppiger wurde. Es wäre logisch gewesen, zurückzufahren und die ganze Kolonie hierher überzusiedeln. Sie waren nach Grönland gefahren, um Land zu bekommen; hier war nur ein paar Tagesreisen entfernt ein Land, das radikal besser war. Es ging um höchstens vier- bis fünftausend Menschen. Und damals, um die Jahrtausendwende, waren die Verbindungen zu Island und von dort zu Norwegen und dem europäischen Kontinent ausgeprägt und aktiv.
Was wirklich geschah, weiß keiner. Die altnordische Kolonie auf Grönland hinterließ, im Gegensatz zur isländischen, nichts Schriftliches. Keine Sagas, keine Lieder, keine Gedichte oder Mythen. Sie existierte rund fünfhundert Jahre, im Laufe der Zeit immer isolierter, nachdem die Infrastruktur im Norden zusammengebrochen war, nicht zuletzt auf Grund des Schwarzen Tods, der im Jahr 1349 mehr als die Hälfte der norwegischen Bevölkerung auslöschte, und am Ende verschwand die ganze Kolonie spurlos. Als 1721 ein norwegischer Missionar auf die Insel kam, hatte er erwartet, dort eine norwegischstämmige Bevölkerung anzutreffen, aber außer Ruinen war nichts geblieben. Zum letzten Mal schriftlich erwähnt wurden die Siedlungen 1410, als ein Schiff auf Grönland anlegte, nachdem es vom Kurs abgekommen war. Da war alles normal gewesen. Was dazu führte, dass die ganze Kolonie verschwand, bleibt bis heute ein Mysterium. Es könnte eine Epidemie gegeben haben, es könnte Klimaveränderungen gegeben haben, es könnte feindliche Angriffe gegeben haben – oder es kam als Folge eines dieser Elemente zur Emigration. Welche Art von Kontakt die grönländische Kolonie in den vierhundert Jahren, seit man zum ersten Mal den Fuß dorthin gesetzt hatte, zu Amerika hatte, weiß auch niemand – aber dass sie nie dorthin zurückgekehrt sein sollen, ist schwer vorstellbar. Sie könnten hingefahren sein, um Bauholz zu holen, um zu jagen, sie könnten zu Expeditionen nach Süden und Westen aufgebrochen sein, landeinwärts auf den großen Flüssen und Seen – denn wie wir wissen, segelten die Wikinger im Osten auf den osteuropäischen Flussrouten bis weit ins Innere Russlands hinein und nach Konstantinopel hinab.
Die Sonne hing im Südwesten tief am Himmel, als wir L’Ance aux Meadows erreichten. Pierce bog links in eine kleine Straße ein. Dort gab es einen Schlagbaum, der offen stand. Pierce schien das zu überraschen, als er langsam weiterfuhr. An manchen Stellen war die Straße von blankem Eis bedeckt. So nah am Meer wuchsen die Bäume um uns nur verstreut und waren niedrig und verkrüppelt. Die Straße machte wieder einen Bogen, und auf der Kuppe eines sanften Anstiegs stand unter einem Felsvorsprung ein graues Holzgebäude. Rauch stieg daraus auf. Pierce hielt an. Da sind wir, sagte er.