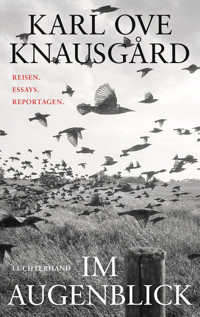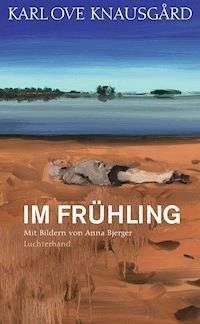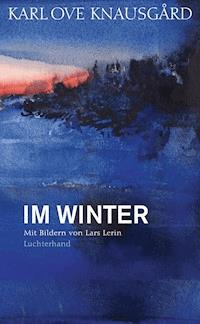14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie wurde Edvard Munch zu einem der berühmtesten Künstler der Welt?
Wie wurde Edvard Munch zu einem der berühmtesten Künstler der Welt? In einer höchst persönlichen Weise nähert sich Karl Ove Knausgård bekannten wie unbekannten Bildern Munchs - in dem Versuch zu ergründen, was in ihnen auf dem Spiel steht und auf welche Art sie in unserer Kultur weiterleben. Er fährt zu Orten, an denen Munch lebte, spricht mit Kunstkennern und Künstlern – aber vor allem schreibt er über seine eigene Beziehung zu Edvard Munch, ausgehend von der naiven Frage: Was ist Kunst und wozu brauchen wir sie eigentlich?
„Edvard Munch - gesehen von Karl Ove Knausgård“. Große Ausstellung vom 12. Oktober 2019 bis 1. März 2020 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Wie wurde Edvard Munch zu einem der berühmtesten Künstler der Welt? In einer höchst persönlichen Weise nähert sich Karl Ove Knausgård bekannten wie unbekannten Bildern Munchs – in dem Versuch zu ergründen, was in ihnen auf dem Spiel steht und auf welche Art sie in unserer Kultur weiterleben. Er fährt zu Orten, an denen Munch lebte, spricht mit Kunstkennern und Künstlern – aber vor allem schreibt er über seine eigene Beziehung zu Edvard Munch, ausgehend von der naiven Frage: Was ist Kunst und wozu brauchen wir sie eigentlich?
Zum Autor
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes wurden weltweit zur Sensation. Sie sind in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. Knausgård erhielt u.a. den WELT-Literaturpreis, den italienischen Malaparte-Preis, den Wall Street Journal’s Innovator Award for Literature, den Sunday Times Award for Literary Exellence sowie den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Er lebt in London.
So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche entstand anlässlich der Zusammenarbeit des Autors mit dem Munch-Museum und der von ihm kuratierten Munch-Ausstellung in Oslo, die im Sommer 2017 eröffnet wurde und für die Knausgård unter anderem mehrere Gemälde, Graphiken und Skulpturen auswählte, die nie zuvor öffentlich gezeigt wurden. Über die Ausstellung schreibt Knausgård: »Ich wollte unbekannte Bilder zeigen, geleitet von der Vorstellung, dass man dadurch Munch sehen könnte, als sähe man ihn zum ersten Mal und als das, was er war, ein Maler, der niemals stehenblieb und niemals erstarrte.«
KARL OVE KNAUSGÅRD
So viel Sehnsucht auf so kleiner Fläche
Edvard Munch und seine Bilder
Aus dem Norwegischen von Paul Berf
Luchterhand
Die norwegische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Så mye lengsel på så liten flate. En bok om Edvard Munchs bilder« im Oktober Verlag, Oslo.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert. Der Verlag bedankt sich dafür.
Copyright © der Originalausgabe 2017
Forlaget Oktober AS, Oslo
© der deutschsprachigen Ausgabe 2019
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Lektorat: Regina Kammerer
Umschlaggestaltung: bux design, München
Covermotiv: © Edvard Munch, Knorriger Baumstamm im Schnee, 1923, Öl auf Leinwand 95 x 100 cm, Munchmuseet, Oslo
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24172-8V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
Für Sissel
MANCHMAL LÄSST ES SICH einfach nicht sagen, wie und warum ein Kunstwerk seine Wirkung entfaltet. Ich kann vor einem Gemälde stehen und von Gefühlen und Gedanken erfüllt werden, die offensichtlich von dem Bild auf mich übertragen werden, ohne dass sich diese Gefühle und Gedanken auf es zurückführen lassen und man beispielsweise sagen könnte, dass die Trauer den Farben oder die Sehnsucht den Pinselstrichen entspringt oder dass die schlagartige Einsicht in die Endlichkeit des Lebens im Motiv verankert ist.
Ein Bild, bei dem es mir so geht, hat Edvard Munch 1915 gemalt. Es zeigt einen Kohlacker. Die Kohlpflanzen im Vordergrund sind grob und fast skizzenhaft gemalt und lösen sich zum Hintergrund hin in grüne und blaue Pinselstriche auf. Neben dem Acker befindet sich ein Feld in Gelb, darüber ein Feld in Dunkelgrün und wiederum darüber ein schmales Feld mit einem sich verdunkelnden Himmel.
Das ist alles, das ist das ganze Bild.
Dennoch ist dieses Gemälde magisch. Es ist so aufgeladen, dass es, wenn ich es betrachte, beinahe so ist, als würde etwas in mir zerbrechen. Gleichzeitig ist es nichts als ein Kohlacker.
Wie kommt es dazu?
Wenn ich diese Farben und Formen sehe, die so radikal heruntergebrochen sind, dass sie eine Landschaft eher andeuten als repräsentieren, sehe ich den Tod, als wolle sich im Bild etwas mit dem Tod versöhnen, obgleich ein Rest von etwas Schrecklichem zurückgeblieben ist, und dieses Schreckliche ist das Unbekannte, dass wir nicht wissen, was uns erwartet.
Doch in Munchs Bild wird ja gar nichts gesagt, wird ja nichts gestaltet, außer Kohl, Korn, Bäumen und Himmel. Gleichwohl der Tod, gleichwohl Versöhnung, gleichwohl Frieden, gleichwohl ein Rest von etwas Schrecklichem.
Liegt es schlicht daran, dass die Linie des Ackers zu einer Dunkelheit hinführt und sich am Himmel über ihm die Dunkelheit herabsenkt?
Vielleicht. Aber viele haben Äcker gemalt, viele haben die Abenddämmerung gemalt, ohne zu erreichen, was dieses Bild in solcher Ruhe ausstrahlt.
Munch war um die fünfzig, als er Kohlacker malte. Man kannte ihn als einen Maler des Innenlebens, des Traums, des Todes und der Sexualität. Er war in eine Lebenskrise geraten, nach der er sich zurückzog und sich beim Malen nicht länger dem Schmerz zuwandte, sondern vielmehr nach außen wandte, er malte die Sonne. Und es fällt einem leicht, das zu verstehen, denn wenn sie aufsteigt, beginnt alles von Neuem. Die Dunkelheit weicht, der Tag öffnet sich, die Welt wird erneut sichtbar. In den nächsten dreißig Jahren malte er, was er dort, in der sichtbaren Welt, sah. Aber diese sichtbare Welt ist keine objektive Realität, sie präsentiert sich so, wie sie von jedem Einzelnen gesehen wird, und Munchs großes Talent bestand in seiner Fähigkeit, nicht nur zu malen, was der Blick sah, sondern auch, womit dieser Blick aufgeladen war.
Es herrscht eine Sehnsucht in diesem Bild des Kohlackers, die Sehnsucht zu verschwinden und eins zu werden mit der Welt. Und diese Sehnsucht, zu verschwinden und eins zu werden mit der Welt, ging für ihn in dem Gemälde in Erfüllung, denke ich, sie ging durch das Malen in Erfüllung. Deshalb ist das Bild so gut, denn was verschwindet, wird sichtbar in dem, was entsteht, und auch wenn das Verschwinden für den Maler zu Ende ging, als das Gemälde vollendet war, ist es im Bild, das uns wieder und wieder mit seiner Leere erfüllt, weiterhin dargestellt.
Also Kohl. Korn und Wald.
Gelb und grün, blau und orange.
ERSTER TEIL
EDVARD MUNCH malte sein Leben lang, von der Zeit, in der er als Jugendlicher kleine Bilder von Topfpflanzen und Interieurs, Portraits von Familienmitgliedern und Exterieurs des Orts, an dem er aufwuchs, anfertigte, bis zu seinem Tod in Ekely, umgeben von seinen Werken, mit achtzig Jahren. Die kontinuierliche Tätigkeit, die das Malen für ihn war, lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen, wobei die erste seine Lehrjahre umfasst, als er sich in die Tradition hineinmalte, zunächst mit jugendlich unbeholfenen Landschaftsgemälden und Portraits, danach verblüffend schnell mit sicheren und guten Bildern, die in einem Bruch kulminierten, der zugleich sein erstes Meisterwerk war, Das kranke Kind, entstanden 1885–86. Da war er zweiundzwanzig Jahre alt. Die zweite umfasst die Jahre bis 1892, als er in vielen Stilarten malte und offensichtlich nach einer Ausdrucksform suchte, die freisetzen konnte, was in ihm war; die Bilder aus dieser Phase enthalten alles, von realistisch gemalten Seemotiven bis hin zu klassisch impressionistischen Straßenszenen. Die dritte Phase enthält all das, was wir mit Munch verbinden – in dieser Zeit malte er Melancholie, Vampir, Der Schrei, Abend auf der Karl Johans gate, Tod im Krankenzimmer, Pubertät, Angst, Madonna, Eifersucht. Die vierte Phase begann ungefähr um die Jahrhundertwende, als er die symbolistische Sprache und Denkweise hinter sich ließ und sich mit seinem nun eigenständigen Stil und seiner Methode etwas Anderem, weniger Literarischem und mehr Malerischem, zuwandte, und parallel hierzu bis zu seinem Tod im Jahre 1944 wieder und wieder frühere Motive ein weiteres Mal malte.
Diese Phasen lassen sich natürlich nicht eindeutig voneinander trennen. So malte er während seiner gesamten Laufbahn Portraits in Ganzfigur, die nahezu unberührt von dem sind, was sonst in seinem künstlerischen Werk geschieht, außerdem malte er kontinuierlich Selbstportraits, die bis zum Schluss zum Besten gehörten, was er machte. Diese letzte, lange Phase enthält wiederum eine Reihe von Phasen, die sich voneinander abgrenzen lassen, so etwa die vitalistische Phase, in der er nackte Männer und Badende, Pferde und Arbeiter malte, oder die monumentale Phase, in der er an unterschiedlichen öffentlichen Gestaltungsaufträgen arbeitete, unter denen Die Sonne in der Aula der Universität Oslo einen Höhepunkt bildet.
Das Werk eines Künstlers einzuteilen ist eine Methode, es zu ordnen, was man in Munchs Fall als besonders wichtig empfindet, da die Bilder, die von ihm im Bewusstsein geblieben sind, fast ausschließlich aus einer bestimmten Phase stammen und sich auf vielleicht zehn, fünfzehn Gemälde aus einer Produktion von über eintausendsiebenhundert Bildern belaufen, die so bekannt sind, dass sie zu Emblemen ihrer selbst geworden sind, was es fast unmöglich macht, sie als etwas anderes zu sehen. Der Stil verweist auf Munch, und das Munchsche verweist in einer Rückkoppelung auf den Stil, die seine Bilder ab- und den Betrachter ausschließt. Diese Bewegung gehört zur Modernität, zum Zeitalter der Reproduktion; neben van Goghs Sonnenblumen und Monets Seerosenteichen, Picassos Guernica und Matisses tanzenden Frauen ist Munchs Der Schrei vielleicht das ikonischste Bild unserer Zeit. Dies bedeutet, dass sein Gemälde immer schon gesehen worden ist und es somit unmöglich erscheint, es so zu sehen, als geschähe es zum ersten Mal, und da so viel von dem, was Munch in dieses Gemälde investierte, gerade von Entfremdung handelt, gerade davon handelt, die Welt zu sehen, als wäre es das erste Mal, indem er eine Distanz schuf, die nicht vertraulich war, steht fest, dass Der Schrei für uns als Kunstwerk in gewisser Weise zerstört ist.
Munch als Künstler ist jedoch nicht zerstört. Seine Produktion war so groß, und so wenig von ihr ist ausgestellt worden, dass man weiterhin neu zu seinen Bildern finden kann. Und indem man keine Meisterwerke heraushebt, nicht bei ihnen stehenbleibt, sie vielmehr als Stationen einer mehr als sechzigjährigen, fortwährenden Suche nach Sinn betrachtet, als eine kontinuierliche Erforschung der Welt mit den Mitteln der Malerei, erfüllt von Fehlschlägen, tastenden Versuchen und Banalem, aber auch von Leidenschaft, Kühnheit und Triumphen, wird vielleicht auch Der Schrei als Kunstwerk zu seinem Recht kommen, also als etwas gesehen werden, das zwischen dem Lächerlichen und dem Fantastischen, zwischen dem Vollendeten und dem Unfertigen, dem Schönen und dem Hässlichen vibriert, gemalt in einer kleinen Stadt am Rande der Welt, an der Nahtstelle zwischen Altem und Neuem, am Anfang der Zeit, die zu unserer werden sollte.
*
Als Mensch war Munch gefühlsgeleitet, nervös und egozentrisch, und als Künstler hatte er das Glück, schon zu Beginn seiner Karriere Beachtung zu finden und so gefördert zu werden, dass er sich recht schnell der Malerei verschrieb, die am Anfang ebenso sehr ein Weg war, gesehen zu werden, wie selbst zu sehen, und die danach zu einer Lebensweise wurde, der einzigen, die er kannte. Er tat nie etwas anderes als zu malen, er hatte nie eine Arbeit, er gründete nie eine Familie und verwandte kaum Zeit auf praktische Belange, von denen ein Leben normalerweise erfüllt ist. Munchs Leben war deshalb in vieler Hinsicht extrem – extrem monoman, extrem hingebungsvoll, extrem eigenbrötlerisch. Aber es war alles andere als heroisch, es ging darin ebenso sehr darum, sich vor der Welt und ihren Herausforderungen zu verstecken oder ihr zu entfliehen, wie darum, ihrer Geborgenheit zu entsagen und sehenden Auges den Preis dafür zu zahlen, etwas Einzigartiges zu erschaffen. Munch scheint die grundlegende menschliche Eigenschaft zu fehlen, sich anderen Menschen anzuschließen, in einem engen Kontakt mit ihnen zu leben. Liest man Biografien über ihn, tritt offen zutage, dass er eine große Furcht vor Intimität hatte, und ebenso offen tritt zutage, warum es so war: Er verlor seine Mutter, als er fünf war, und seine große Schwester, die ihm sehr nahestand, als er dreizehn war. Der Vater starb, als er fünfundzwanzig war, der jüngere Bruder, als er zweiunddreißig war, und seine Schwester Laura verlor er in gewissem Sinne auch, sie wurde früh psychisch krank. Ergänzt man diese Reihe von Verlusten um eine ungeheure Empfindsamkeit sowie um eine distanzierte, zeitweise religiös verwirrte, teils freundliche, teils brutale Vaterfigur in seiner Kindheit, erhält man ein Kind, einen Jugendlichen und einen erwachsenen Mann, der unter derartigen Verlustängsten leidet, dass er dies verarbeitet, indem er keine Verbindungen eingeht. Munch achtete mit der Zeit sorgsam darauf, sich nicht dorthin zu begeben, wo es wehtun konnte, es wurde zu einer Lebensstrategie. Als die Schwester seiner Mutter, die für ihn wie eine Mutter gewesen war, gegen Ende seines Lebens starb, nahm er nicht an der Beerdigung teil, sondern verfolgte die Zeremonie aus der Distanz, er stand außerhalb der Kirchhofmauern und sah zu.
Wie wichtig ist diese Information, wenn wir seine Bilder betrachten? Das ist eine entscheidende Frage im Hinblick auf Munchs Kunst, aber auch auf die von Kunst im Allgemeinen. Es ist klar, dass es eine Verbindung zwischen den persönlichen Erfahrungen von Künstlern und ihren Werken gibt, aber worin diese Verbindung besteht, ist weniger klar. Malte Picasso wegen seiner Beziehung zu den Eltern, wie er es tat, wegen der Umstände, unter denen er aufwuchs, wegen seines eigenwilligen Seelenlebens? Dies wäre eine absurde Reduktion von Picassos Werk, und ausgesprochen unsensibel angesichts der Aufgaben, die er zu lösen versuchte, wenn er vor einem noch ungemalten Bild stand. Gleiches gilt für Schriftsteller, deren Biografie selbstverständlich in die von ihnen verfassten Bücher einfließt, jedoch auf eine Weise, die sich selten zurückverfolgen lässt – man denke nur an Herman Brochs Roman Der Tod des Vergil (1945) oder einen Film wie Solaris (1972) von Andrej Tarkowskij, um zwei eigenwillige Werke aus dem vorigen Jahrhundert zu erwähnen, in denen das Biografische eine minimale Rolle für das Verständnis oder das Erlebnis der Kunstwerke spielt, die aber gleichzeitig in einer Weise persönlich sind, die es kaum vorstellbar erscheinen lässt, dass ein anderer als Broch und Tarkowskij sie erschaffen haben könnten.
Ein Kunstwerk ist wie ein Punkt in einem System mit drei Koordinaten: der bestimmte Ort, die bestimmte Zeit, der bestimmte Mensch. Je mehr Zeit seit der Entstehung eines Werks vergangen ist, desto deutlicher wird, dass die Bedeutung des Individuellen, die Erfahrungen und die Psychologie des bestimmten Menschen, eine geringere Rolle spielen als die Kultur, in der sie sich ausdrückte. Ich bin mir sicher, dass ein versierter und kundiger Leser im Mittelalter in der Lage war, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Buchillustrationen seiner Zeit zu erkennen, und dass diese Unterschiede zwischen den diversen Illustratoren möglicherweise sogar als entscheidend wahrgenommen wurden, während der Stil für uns, zumindest für mich, genau eines und nur eines ausdrückt: Mittelalter.
Ein Beispiel aus jüngerer Zeit könnte das literarische Œuvre Dag Solstads sein, das sich von den sechziger Jahren bis heute erstreckt und in dem die literarische Ästhetik der verschiedenen Jahrzehnte stets mitschwingt, so dass der Ton der sechziger Jahre in Irr! Grønt! (Grünspan! Grün!) erklingt, der Ton der Siebziger in 25. september-plassen (Der Platz des 25. Septembers), der Ton der Achtziger in Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land (Gymnasiallehrer Pedersens Erzählung von der großen politischen Erweckung, die unser Land heimgesucht hat), der Ton der Neunziger in Scham und Würde, der Ton der Nullerjahre in Armand V. Fußnoten zu einem unausgegrabenen Roman. Interessant ist, dass Solstads eigene, originelle und zutiefst idiosynkratische Stimme durch diese fünf Jahrzehnte hinweg ebenfalls präsent ist, man braucht nur einen oder zwei Sätze aus einem beliebigen dieser Romane zu lesen, um genau zu wissen, dass er sie geschrieben hat. Als Irr! Grønt! herauskam, war es diese Stimme, die herausstach und deutlich war, während sich das Sechzigerjahrehafte im Hintergrund hielt, fast unsichtbar blieb. Heute sehen wir als Erstes dieses Sechzigerjahrehafte, und Dag Solstads Stimme befindet sich im Hintergrund.
So ist es, weil wir die Welt sehen, ohne uns der Art bewusst zu sein, in der wir sie sehen, die beiden Faktoren sind für uns häufig ein und dasselbe. Wir haben das Gefühl, in einer unvermittelten Wirklichkeit zu leben, und wenn jemand sie vermittelt, was Künstler tun, vermitteln sie diese oft auf Weisen, die so eng mit unserer eigenen Wirklichkeitsauffassung verbunden sind, dass wir auch sie verwechseln. Das gilt für alles, dem wir Beachtung schenken und was wir für wichtig halten, es gilt für die Vorstellungen, die wir von Menschen und der Welt haben, es gilt für die Sprache und die Bildsprache, die wir benutzen. Wenn wir beispielsweise eine Ausgabe der Fernsehnachrichten von 1977 sehen, fallen uns augenblicklich die Kleider auf, die anders sind, und das häufig in einer Weise, die uns ebenso schmunzeln lässt wie die Frisuren und Brillen. Uns fällt die Art auf, sich sprachlich auszudrücken, die steifer und formeller war, als wir es heute gewohnt sind, und uns fällt auf, wie unglaublich lokal und unschuldig die Berichterstattung war. Damals, 1977, fiel das alles jedoch niemandem auf. Der Klang der siebziger Jahre existierte nicht, weil alle und alles Siebzigerjahre war, die Art, sich zu kleiden, die Frisuren, das Brillendesign, die Ausdrucksweise, die Interessen waren allen gemeinsam. All das befindet sich mitten unter uns, es ist das, was wir den Zeitgeist nennen, gleichzeitig drücken wir uns durch ihn aus. Ein schwacher Roman wird nur genau dies ausdrücken, unabhängig davon, ob er sich auf persönliche Erfahrungen stützt und vielleicht sogar auch selbst erlebt ist, und nach ein paar Jahren wird er nur noch einen Wert als Zeitdokument haben.
Dass die Kultur als Natur gesehen wird, dass Bewertungen und Vorstellungen, die willkürlich und zeitgebunden sind, unbewusst als zeitlos wahr aufgefasst werden, fällt unter den rhetorischen Begriff Doxa, und es waren solche zugrunde liegenden Vorstellungen, die Roland Barthes in seinem Buch Mythen des Alltags definierte und beschrieb. Als ich Anfang der neunziger Jahre studierte, waren dies vorherrschende Gedanken, die französische Philosophie dominierte das akademische Leben, was meinen Blick auf Zeit und Kunst geprägt hat, und dies wahrscheinlich auch auf eine Art, die ich selbst nicht überblicke. Der für mich mit Abstand wichtigste Theoretiker war Michel Foucault, vor allem sein Buch Die Ordnung der Dinge, das wie eine Offenbarung war, als ich es das erste Mal las. Ja, genau, so ist es!, dachte ich damals und denke es heute noch. Und selbstverständlich ist alles, was ich hier schreibe, sowohl die Art, in der ich es schreibe, als auch die Gedanken, die ich dadurch zum Ausdruck bringe, ebenfalls ein Teil des Zeitgeistes, ebenso ein Teil von Vorstellungen, die ich in diesem Moment als wahr erlebe, denn so sieht die Wirklichkeit für mich aus, weshalb die Möglichkeit groß ist, dass auch dies eines Tages nur das zeitlich Lokale ausdrücken wird.
Ich glaube, aus diesem Grund sprechen so viele Künstler und Schriftsteller über das Wahre, darüber, dass sie das Wahre ausdrücken wollen. Die Wahrheit wird dabei als etwas dahinter Liegendes aufgefasst, es existiert immer ein Schleier aus Vorstellungen, die weggerissen werden müssen, um die Wahrheit sehen zu können, um die Welt so sehen zu können, wie sie wirklich ist. Und um das zu tun, muss man Zugang zu einer anderen Sprache haben als der unserer Gegenwart, weil die Sprache der Gegenwart Bestandteil dessen ist, was verdeckt oder verschleiert. Aus diesem Grund gehört die Originalität zu den Eigenschaften, die in der Kunst am meisten geschätzt werden. Das Originale ist das Idiosynkratische, es ist das Eigene, es ist das Neue. Während das Wahre immer das Gleiche ist.
Das erste Gemälde, das Munch unseres Wissens bewunderte, war Brautfahrt auf dem Hardangerfjord von Adolph Tidemand und Hans Gude. Da war er ein Kind. Gegen Ende seiner Jugendjahre hatte er eine starke Aversion gegen diesen Typus von Bildern mit ihren vielen fotorealistischen Details und glänzenden Oberflächen entwickelt, und es ist sicher keine wüste Spekulation, wenn man sagt, dass diese Aversion seinen eigenen Erfahrungen geschuldet war, die so gar nicht dem Bild der Wirklichkeit entsprachen, das in diesen Bildern von Zusammenhang, Gleichgewicht, Schönheit und Sinn gezeichnet wurde. Als die Mutter starb, suchte er die Nähe seiner Schwester Sophie, die beiden gehörten zusammen, sie hatten ihre eigene Welt, und er war der Kranke, er war es, der Blut hustete und in den Wintermonaten das Bett hüten musste, doch sie starb, plötzlich, nach einem Sommer, in dem er in eine ihrer Freundinnen verliebt gewesen war, es geschah innerhalb von wenigen Wochen, sie wurde immer schwächer und starb in dem Sessel am Fenster, ihr Vater Christian und ihre Tante Karen trugen sie tot zum Bett, und es war Edvard, der weiterlebte. Er kam nie ganz über diesen Verlust hinweg, er sehnte sich für den Rest seines Lebens nach Sophie. Das Urvertrauen in andere und die Welt, das die meisten von uns besitzen, muss bei ihm zerbrochen sein. Sue Prideaux, die eine der Biografien über ihn verfasst hat, versteht es so, dass er das Trauma verarbeitete, indem er sich in sich selbst zurückzog, wodurch die Verbindung zwischen Innen und Außen abbrach und dieser Bruch im Laufe der Zeit permanent wurde. Sein Inneres lebte er lesend und zeichnend aus, und seine Zeichnungen brachten ihm schon früh so viel Anerkennung ein, dass er seine Identität damit verknüpft haben muss. Als er, mittlerweile ein junger Mann mit Künstleridentität, die norwegischen romantischen Gemälde sah, die praktisch das Einzige waren, was es damals in Kristiania, dem heutigen Oslo, gab, sah er nichts, was seine eigene Wirklichkeit und seine Erfahrungen widerspiegelte, und er erkannte früh, dass er diese Beschönigung, die zwischen den Bildern der Wirklichkeit und dem stand, was er als wirklich erlebte, einreißen musste, falls er zu etwas Wahrem vordringen wollte, zu etwas, das wirklich zählte. Er las Ibsen, dem es darum ging, eine Fassade aus Beschönigung einzureißen, um die Wahrheit zu finden, und er las Dostojewskij, der vor einem Hintergrund aus Armut und Unvollkommenheit und einem unerträglichen inneren Schmerz etwas Leuchtendes, Glänzendes, Brennendes schrieb. Er lernte den Maler Christian Krohg kennen, der mit großer und umwälzender Kraft aus Paris kam und praktisch im Alleingang Impulse von dort in dem kleinen norwegischen Künstlermilieu etablierte und die Frage stellte, was die barocke Hirtenmalerei des siebzehnten Jahrhunderts mit der modernen norwegischen Wirklichkeit des neunzehnten Jahrhunderts zu tun hatte. Und er begegnete dem Schriftsteller Hans Jæger, der nicht nur über die Heuchelei und Unfreiheit des Bürgertums sprach, sondern auch darüber, sein Leben so offen und ehrlich und nackt und wahr zu beschreiben, wie es nur ging. Dass sich Jæger selbst als Heuchler erwies, verringerte nicht den Wert dessen, was Munch von ihm lernte, und so sollte er später sagen, dass Jæger den bedeutendsten Einfluss auf ihn hatte, nicht Strindberg; als er Strindberg begegnete, hatten die wichtigsten Gedanken bereits Gestalt angenommen.
Solche Kämpfe zwischen dem Individuellen und dem Kulturellen, beides zeitabhängige Kategorien, spielen sich in allen Kunstwerken ab. Der Künstler versucht, zum Wahren vorzustoßen, indem er sich von Zeit und Ort befreit, von der Sprache, die dort vorherrscht, gleichzeitig ist er oder sie zwangsläufig auch ein Teil davon, denn das Zeitlose und Ortlose existiert ja nicht, selbst das originellste Werk und originellste Denken bleibt an einen Ort und eine Zeit gebunden. So gesehen hat die Kunstgeschichte eine ironische Dimension; typisch für die Epoche werden nur jene Werke, die mit der Epoche brechen, die Werke, in denen sich der Künstler selbst mit seiner Individualität in der Sprache und den Methoden Bahn bricht, die wiederum allen zugänglich und Allgemeingut sind. Deshalb sind die Werke Albrecht Dürers und Dante Alighieris bis heute relevant für uns, während so viele andere Werke aus dem Mittelalter es nicht sind. Indem sie sich selbst ausdrücken, sprechen sie an, was wir mit ihnen gemeinsam haben, unser Ich. Dieses »Ich« war einst mit einem ganz bestimmten Charakter verbunden, der durch eine Reihe ganz bestimmter Erfahrungen entstanden war und im Laufe der Zeit verblasst ist, bis von ihm nichts als ein bestimmter Ton geblieben ist, eine bestimmte Einstellung zur zugänglichen Sprache und Form, und für uns kaum von der Zeit zu trennen, in der er formuliert wurde.
Edvard Munchs Zeit ist uns noch so nahe, dass seine Biografie bisher nicht in den Bildern verschwunden ist, so dass wir weiter nach der Ursache für das Idiosynkratische suchen, nach dem in seiner Persönlichkeit und seinen Erfahrungen, was es ihm ermöglichte, mit der Kunst seiner Zeit zu brechen. Er verlor seine Mutter und seine Schwester, als er ein Kind war, und er war außerordentlich empfindsam, deshalb malte er Der Schrei.
Aber warum malte Dürer sich als Christus? Die meisten ordnen dies in einen großen kulturgeschichtlichen Zusammenhang ein, so etwa Peter Sloterdijk, der das Bild als einen bemerkenswert konkreten Ausdruck für »die Hebung des profanen Gesichts zur Portraitwürde« sieht. Damit sind wir an der Schnittstelle zwischen Mittelalter und Renaissance, dem Übergang von einem Glauben an die Wahrheit in der überlieferten Schrift zur Wahrheit in der gegenwärtigen Natur, und das ist ein Ort, an dem die Frage, ob Dürers Mutter oder eine seiner Schwestern starb, als er ein Kind war, nicht relevant ist, selbst wenn sein Selbstportrait als ebenso persönlich und inniglich wie Munchs wahrgenommen würde.
Was sich in einer Epoche sagen lässt, und auf welche Weise, definiert mehr als alles andere die verschiedenen Ausdrucksweisen der Kunst, und dies gilt natürlich auch für Munch. Dass er in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts begann, Szenen aus seinem eigenen Leben zu malen, und versuchte, seinem Gefühlsleben eine äußere malerische Form zu geben, lag nicht nur an einem großen inneren Druck – ich vermute, dass die meisten bedeutenden Maler in der Geschichte einen großen inneren Druck in sich trugen –, sondern auch daran, dass sich in der Kultur etwas so veränderte, dass ihm diese Möglichkeit offen stand.
Dass Munch nur zehn Jahre später begann, sich von der Methode, die er gefunden hatte, zu entfernen, und für den Rest seines Lebens, also annähernd vierzig Jahre lang, einen ganz anderen Typus von Bildern malte, die selten mit seiner Biografie oder mit intensiven Gefühlen aufgeladen sind, bedeutet meines Erachtens, dass ihn niemals nur das Biografische oder sein eigenes Innenleben an sich interessierte und antrieb, sondern auch, welche Kunst daraus entstehen konnte. Vielleicht ging es ihm sogar in erster Linie darum.
Nach zehn Jahren hatte sich die Methode erschöpft, was bedeutet, dass sie als genau das, eine Methode, durchschaubar geworden war und nichts Neues mehr hervorbrachte, sondern Wiederholung bedeutete, also genau das, was seinem Empfinden nach die Regeln der Malerei, denen er der Lehre nach folgen sollte und die ihn umgaben, als er zu malen begann, einst repräsentierten. Das, was im Voraus vorhanden war, bevor der Pinsel auch nur gehoben wurde.
*
Der Konflikt zwischen dem, was im Voraus vorhanden ist, und dem, was voraussetzungslos entsteht, war für Munch von fundamentaler Bedeutung, es war ein Kampf, den er ausfocht, mit großen Siegen und ebenso großen Niederlagen. Ironischerweise verarbeiten die Bilder, die von ihm in Erinnerung bleiben, nicht nur Erinnerungen, also etwas, was gewesen ist, sondern auch Gemütszustände und emotionale Konflikte, die durch die Bildelemente herausgearbeitet werden sollen, so dass manche von ihnen weniger etwas in sich selbst sind als etwas, das sie verkörpern – als Beispiel hierfür kann uns Eifersucht mit seinem Schablonen-Adam und seiner Schablonen-Eva mit Äpfeln im Hintergrund und einem bleichen, leidenden Gesicht im Vordergrund dienen, denn die Figuren scheinen einem Schema folgend eingefügt worden zu sein, als eine Illustration des Gefühls, in einem Bild, das eigentlich nicht mehr als das zu bieten hat – während die Bilder, in denen er siegte, indem er sich dem, was er malte, vorurteilsfrei annäherte, auf denen eine Ulme eine Ulme ist, ein Heureiter ein Heureiter, ein Pferd ein Pferd, aber nicht nach allen Regeln der Kunst, das gerade nicht, sondern schnell und oft achtlos, so dass sie auch in hohem Maße zu einer sichtlich gemalten Ulme, einem sichtlich gemalten Heureiter, einem sichtlich gemalten Pferd werden, größtenteils dem unwesentlichen Teil seiner Produktion zugerechnet werden.
»Es ist ein Irrtum zu glauben, der Maler stehe vor einer weißen Oberfläche«, schreibt Gilles Deleuze in seinem Buch über den britischen Maler Francis Bacon. Damit meint er, dass es niemals nur darum geht, ein Motiv, vor dem man steht, auf eine leere Leinwand zu übertragen, weil die Leinwand niemals leer ist, sondern voller Bilder und Vorstellungen, die der Maler bereits in sich trägt, wodurch es beim Akt des Malens im Grunde eher darum geht, zu entleeren, zu reinigen, Dinge fortzunehmen, als darum, eine leere Fläche zu füllen. Der Maler malt »um ein Gemälde zu produzieren, dessen Funktionsweise die Bezüge zwischen Modell und Kopie verkehren wird. Kurz, es müssen all jene ›Gegebenheiten‹ definiert werden, die bereits auf der Leinwand sind, bevor die Arbeit des Malers beginnt. Und es muss definiert werden, welche von diesen Gegebenheiten ein Hindernis, welche eine Hilfe oder die Effekte einer vorbereitenden Arbeit sind.«
Das ist die Ausgangsposition, die Grundlage für jede Betätigung als Maler, und im Grunde auch für jede andere künstlerische Betätigung, auch für das Schreiben, wenngleich auf andere Art. Deleuze hat dieses Kapitel »Die Malerei vor der Malerei« genannt, und das, was immer schon im Voraus da ist und bereits bevor das Gemälde begonnen wird, zwischen dem Maler und seinem Motiv steht, ist einerseits das Klischee, mit allem, was es mit sich bringt, andererseits die Möglichkeit, mit allem, was sie mit sich bringt. Malen heißt, sich in das Klischee und die Möglichkeit zu begeben, und, schreibt Deleuze, der Maler bewegt sich in das Bild, gerade weil er weiß, was er zu tun wünscht, aber nicht, wie er es tun soll, und der einzige Weg zu dieser Gewissheit führt durch das Bild und aus ihm heraus.
Für Munch als junger Mann in Kristiania, bestand das Klischee – die Sprache, die ihm am unmittelbarsten zur Verfügung stand – nicht in den romantischen, pedantisch ausgemalten Bildern, die hatte er bereits hinter sich gelassen, sondern in den der Realität näher stehenden Gegenwartsbildern des Naturalismus. Die Möglichkeiten – also das, was er wollte und auf die eine oder andere Art vor sich sah oder erahnte –, müssen andererseits mit seinen eigenen Erfahrungen und dem Erlebnis von Dostojewskijs brutal direkten Schilderungen des Äußeren, gesehen durch oder temperiert vom Inneren, verbunden gewesen sein. Es muss ein großer Konflikt gewesen sein, da der Unterschied zwischen Munchs Innenleben und der äußeren Wirklichkeit, in der er sich bewegte, offenbar so umfassend war.
Wenn wir die Werke eines Künstlers in der Rückschau betrachten, folgt eine Periode mit einer gewissen Selbstverständlichkeit auf die andere, wir wissen immer, was als Nächstes kommt, und diese Gewissheit kann man unmöglich völlig außer Acht lassen. Für den Künstler war dagegen nichts selbstverständlich, es gab nur, was er gemalt hatte, sowie das, was er gerade malte. Als Munch mit achtzehn Jahren an einem schönen Sommertag einen Garten malt, weiß er nichts von Der Schrei, weiß er nichts von Melancholie, weiß er nichts von Die Sonne oder Frühling im Ulmenwald. Wenn ihn ein Konflikt zwischen dem Inneren und dem Äußeren umtreibt, so ist dieser nicht artikuliert und deutet auch nicht unbedingt auf etwas voraus. Die Malerei ist mehr als ein Ort, an dem innere Konflikte formuliert werden, sie ist auch ein Ort, an dem die Konflikte ausgehalten werden, also ein Ort für Frieden und Freude. Malen heißt, zu sehen und das Gesehene in Farben und Formen zu formulieren. Das tat Munch angesichts dieses Gartens, er sah ihn, und er malte, was er sah. Nichts von den traumatischen Erfahrungen, die er in sich trägt, ist in dem Bild repräsentiert, wohl aber seine Fähigkeit zu sehen, und seine Fähigkeit, das Gesehene in ein Bild umzusetzen. Der schwedische Titel von John Bergers Buch Ways of seeing (1972) lautet Die Kunst zu sehen, was sich seltsam anhören mag, denn wir können ja alle sehen, nicht wahr, das ist doch keine Kunst? Wir können alle vor einem Baum stehen und ihn betrachten, seine Äste und Blätter, seine Rinde und Wurzeln, das Spiel von Licht und Schatten, das auf die Fläche um ihn herum wie gestreut erscheint, wenn die Seebrise ihn hin und her schwanken lässt. Aber vieles von dem, was wir sehen, sehen wir, weil wir wissen, dass es dort ist, häufig handelt es sich eher um ein Wiedererkennen, ein Registrieren, das etwas bereits in uns Existierendes bestätigt. Namen sind ein wichtiger Teil hiervon, so vieles von dem, was wir sehen, liegt im Namen; das ist ein Apfelbaum, das ist eine Ulme, das ist ein Kirschbaum, das ist eine Fichte. Betrachten wir ihn länger, können wir vielleicht hinter den Namen gelangen und ihn als einen einzigartigen, singulären Baum sehen und nicht nur als einen Repräsentanten seiner Kategorie. Und vielleicht können wir am Ende sehen, was er »ist«, in der Welt. Dann wird er uns jedoch so bekannt sein, dass er uns vertraut geworden ist, was uns wiederum von ihm entfernt, denn so ergeht es einem ja mit vertrauten Freunden, mit denen man seit vielen Jahren befreundet ist, man sieht sie nicht mehr, registriert sie nur noch, lässt ihre Gegenwart die Kategorie ausfüllen, in die man sie eingeordnet hat, nicht wahr?
Hätten wir diesen Baum gemalt, hätten nicht nur die verschiedenen Sehweisen zwischen ihm und uns gelegen, sondern auch die vielen unterschiedlichen Arten, ihn abzubilden. Die Bäume des Barock, die Bäume des Impressionismus, die Bäume des Symbolismus, die Bäume der Moderne und der Postmoderne, van Goghs Bäume, David Hockneys Bäume, Anna Bjergers Bäume, Peter Doigs Bäume, Vanessa Bairds Bäume. Aber auch die Bäume der Naturkundebücher, die Bäume der Bankreklamebroschüren, die Bäume der Computerspiele, die Bäume der Zeitungs- und Magazinfotografen, die Bäume der Natursendungen, die Bäume der Kinderzeichnungen.
»Viele hatten zuvor eine Eiche gemalt«, schrieb Olav H. Hauge in einem Gedicht. »Gleichwohl malte Munch eine Eiche.« Dieser Satz erfasst die Essenz in Edvard Munchs Arbeit, weil er so viel darüber sagt, warum er malte, woran er sich versuchte. Und seine Art, Bäume zu malen, kann einem so gut wie alles andere als Zugang zu seinem Werk dienen, denn Bäume malte er von seinem ersten Bild 1880 bis zu seinem letzten 1944, und angesichts jedes einzelnen von ihnen ist er in der Situation gewesen, die Deleuze beschreibt, befand er sich im Kampf zwischen Klischee und Möglichkeit, dessen Ergebnis das Gemälde ist.
Eines von Munchs ersten wirklich guten Bildern ist Garten mit rotem Haus von 1882, gemalt in dem Sommer, als er achtzehn war. Es ist klein, nur 23 x 30,5 cm, das Motiv ist ein sommerlicher Garten, üppige Laubkronen und Gras sind in Sonnenlicht getaucht, in vielen Schattierungen von Grün, mit einem roten Sommerhaus unter einem blauen Himmel ganz hinten, das in dem Gemälde einen Sog und auch eine Lust erzeugt, denn selbst wenn die Ambitionen bescheiden gewesen sein mögen und es vielleicht nur darum ging, das Motiv und die Freude über die Farben und das Licht zu beherrschen, zeigt es Wirkung; es ist schwer, dieses Bild zu betrachten, ohne sich zu freuen.
Ganz im Vordergrund, am linken Bildrand, steht ein entlaubter Baumstamm, es scheint ein alter Obstbaum gewesen zu sein, an manchen Stellen von minzgrünem Moos bedeckt, ansonsten hellgrau, wo er die Sonne reflektiert, dunkelgrau, wo er im Schatten steht. Daneben befinden sich eine graue Bank und ein im Schatten rostroter Tisch, beide sehen wackelig aus, und dahinter erstreckt sich im Sonnenlicht leuchtend eine Rasenfläche, umkränzt von dichtem Laub und überbordenden Blumenbeeten, gelb hinten an der Hauswand, drei betont rote Blumen am rechten Bildrand. Das Motiv und die Stimmung sind impressionistisch, die Ausführung ist schwerer und besitzt die Solidität des Naturalismus, allerdings ohne die gelegentlich fast hyperrealistische Detailwiedergabe des Naturalismus. Hier geht es vor allem um die Farben, und um die Tiefe.
Was war hier »das Gemälde vor dem Gemälde«? Welche Bilder hatte er im Kopf, bevor er zu malen begann, und welche Möglichkeiten sah er?
Wahrscheinlich war das Einzige, was er wirklich wollte, dem Bild einen Zusammenhalt zu geben, und das tat er auf der Basis dessen, was er in den zwei Jahren gelernt hatte, die er bis dahin malte, und der Bilder, die er gesehen hatte, in der Form, die für ihn natürlich zugänglich war, der Form des Realismus oder Naturalismus. Es gibt keine Spur von Nationalromantik in diesem Bild, zu der manche seiner früheren Gemälde mit ihren Birken und kleinen Bauern im Vordergrund gewisse Berührungspunkte haben. Munch malte niemals hohe Berge, niemals tiefe Täler, niemals Fjorde oder Landschaften, die auf andere Weise dramatisch waren. Auch hier geht es ihm nicht um etwas Grandioses, ihn dürfte eher das Unansehnliche angezogen haben, und die Schönheit oder der Charme darin. Wenn er zufrieden damit war, es überhaupt zu schaffen, diesen Garten wiederzugeben und den alten Obstbaum zu gestalten, wie er ihn sah, und keinen Grund erkennen konnte, den geltenden malerischen Gestaltungsmitteln zu widerstehen, sondern eher hart daran arbeitete, sie zu bewältigen, wie die Tiefe im Garten, das Volumen des Baumstamms, die Verbindungen zwischen dem Licht und den Farben, muss die Freude über die Farbe selbst oder die Begierde nach ihr zu irgendeinem Zeitpunkt die Oberhand gewonnen haben, denn sie ist es, die das Bild prägt, das Physische an der Farbe selbst eher als das, was die Farbe repräsentiert: das sonnenbeschienene Rot des Sommerhauses, das schattengeprägte Rot des Tisches, die drei Blüten, auch sie rot, mitten in einem See aus Grün.
Ich denke nicht, dass es möglich ist, ein solches Bild zu malen, ohne frohen Mutes, ohne voller Lebensfreude zu sein. Mag sein, dass ich naiv bin und es trotz allem möglich ist, aber mir gelingt es jedenfalls nicht, dieses Bild zu betrachten, ohne von seiner friedvollen Atmosphäre und seinem Farbhunger angesteckt zu werden.
Betrachten wir ein Bild, das er elf Jahre später malte, also als Neunundzwanzigjähriger, Sommernachtstraum. Die Stimme, das ebenfalls ein sommerliches Freiluftmotiv mit Bäumen als zentralem Bestandteil hat. Es ist in allen Aspekten so anders, dass es einem schwerfällt, sich vorzustellen, es könnte vom selben Mann gemalt worden sein. Das Bild zeigt eine weißgekleidete Frauengestalt, die mit dem Rücken an einen Baum gelehnt zu stehen scheint; hinter ihr liegt, zwischen den Baumstämmen, das Meer, über diesem, ungefähr in der Mitte des Bilds, hängt der Mond, gespiegelt in einer Säule im Wasser, und rechts davon sieht man vage Teile eines Boots. Das ist alles. Alle Bildelemente sind realistisch, wenn man damit meint, dass sie der sichtbaren Wirklichkeit angehören, aber sie sind so anders als die Elemente in dem sonnenbeschienenen Sommergarten gemalt, dass hier ganz offensichtlich etwas völlig Anderes auf dem Spiel steht, sowohl in der Malerei als auch thematisch. Der Waldboden im Vordergrund ist ein fast vollkommen ebenes dunkelgrünes Feld, das Ufer im Mittelgrund ist ein fast vollkommen ebenes weißes Feld mit einem roten Rand, und das Meer im Hintergrund ist ein vollkommen glattes, blaues Feld. Die Bäume sind flach, so gut wie ohne markiertes Volumen. Dem Bild fehlt es dadurch gänzlich an Tiefe, und es ist offensichtlich, dass der Bildraum kein realistischer Raum ist. Er lebt im Spiel zwischen den horizontalen Linien des Ufers und des Meers und den aufdringlichen, gitterartigen Vertikalen der Bäume, die von der Mondlichtsäule verstärkt oder vertieft werden. Eigentlich hätte dies dazu führen müssen, dass dieses Bild auf der Grenze zum Abstrakten und Dekorativen steht, wodurch es etwas wäre, was man aus der Distanz betrachtet, auf eine ganz andere Weise als den realistischen Gartenraum, der sein Leben in der Glaubwürdigkeit und im Wiedererkennen lebt. Aber so ist es nicht. Gegenwart und Pose der Frau lassen alle Elemente nicht aus dem Spiel sein, sondern ein anderes Spiel entstehen. Sie hat die Hände auf dem Rücken und lehnt gleichzeitig ihren Oberkörper ein wenig vor und sieht den Betrachter direkt an. Auf dem Bild ist sie allein, aber man empfindet es dennoch nicht als ein Bild von einer Frau allein am Meer, im Gegenteil, das Bild ist aufgeladen wie eine Bühne, alles an ihrer Pose und Körpersprache sagt einem, dass da noch jemand ist, dem sie sich zuwendet. Wenn man das Bild betrachtet, ist es unmöglich, nicht in diesen Charakter einzutreten und so direkt mit ihr konfrontiert zu werden. Ich bin es, den sie ansieht, ich bin es, zu dem sie sich vorbeugt. Und ich bin es, den sie ängstigt.
Ängstigt?
Was soll an ihr beängstigend sein?
Lese ich hier nicht etwas hinein, was ich über Munch weiß, seine Angst vor Intimität und seine Furcht davor, sich mit Frauen einzulassen, und übernehme es einfach, was mir nicht sonderlich schwerfällt, weil Angst vor Intimität und Furcht vor Frauen mir vertraute Phänomene sind?
Gut möglich.
Aber der Raum ist ohne Tiefe, so dass er sich nicht öffnet, und die Bäume stehen wie ein Gitter, sie sperren ab und schließen ein. Und in Munchs Bildwelt sind die Bäume und das Vertikale maskuline Phänomene, während das Meer und das Horizontale feminine sind.
Sie wendet sich an jemanden, der sie ansieht, und das Auffordernde an ihrer Pose, dieses Spiel für den, der sie sieht, macht sie zu einer sirenengleichen Gestalt. So verstanden öffnet sich ein Feld, in dem die Lust und der Untergang ebenbürtig sind.
Man hat das Gefühl, dass Munch in diesem Bild nicht nur die Frau gemalt hat, sondern auch den, der die Frau ansieht. Und dass sich das Bild deshalb verändert, je nachdem welche Erfahrungen der Sehende hat. Nun könnte man einwenden, dass dies für alle Bilder gilt, selbst für eines von einem Garten, aber dieses Bild ist in einer ganz anderen Weise konfrontativ, es fordert etwas, was eine Antwort verlangt. Es ist nicht so, dass der männliche Blick, mit dem ich dem Bild begegne, die Frau sexualisiert und sie dominiert, die Sache ist komplizierter, denn diese Frau ist frei, sie ist mit dem Offenen und Ungebundenen verknüpft, und sieht man von den offensichtlich erotischen Untertönen in diesem Bild ab, ist das Freie auch eine Wahl, vor die der Betrachter gestellt wird. Dadurch, dass die Wahl nicht im Bild getroffen wird, ist es außerdem voller Sehnsucht. Ja, als würde hier die Sehnsucht selbst abgebildet.
Doch was ist hier »das Gemälde vor dem Gemälde«? Welche Bilder hatte er im Kopf, bevor er malte, was stand ihm im Weg und welche Möglichkeiten sah er?