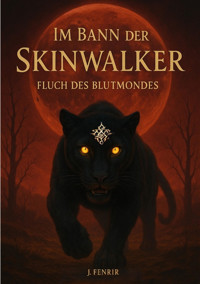
5,99 €
Mehr erfahren.
Der dritte Band der „Im Bann der Skinwalker“-Reihe knüpft an die Geschehnisse der vorherigen Teile an. Ein Blutschwur, der nicht gebrochen werden kann. Eine Liebe, die auf der Kippe steht. Und ein Feind, der im Schatten wartet. Kate hat alles riskiert – und verloren. Ein tödlicher Dolchstoß hat sie an den Rand des Abgrunds gebracht, und nun liegt sie regungslos in Christianos Armen. Während er um ihr Leben kämpft, lastet auf Leora ein dunkler Schwur, der sie von Kain trennt und sie unwiderruflich an den Feind bindet. Doch noch ist das Spiel nicht vorbei. Daemon ist nicht besiegt. Sein Plan reicht weiter, als irgendjemand ahnt – und während die Skinwalker um ihr Überleben kämpfen, bereitet er seinen nächsten Zug vor. Einer, der alles verändern wird. Wie viel kann ein Herz ertragen, bevor es zerbricht? Und was, wenn das größte Opfer noch bevorsteht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Im Bann der Skinwalker
Fluch des Blutmondes
1. Auflage,
© J. Fenrir – alle Rechte vorbehalten
Diese Geschichte bewegt sich in einem düsteren, erotischen Setting, das explizite Inhalte und Machtgefälle thematisiert. Bitte beachte dies, bevor du weiterliest.
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
Tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Zu erreichen unter: J. Fenrir, Im Huckschlage 5, 58675 Hemer, Germany.
Epilog
Es sind Wochen vergangen, aber die Zeit scheint stillzustehen. Kate liegt noch immer reglos da, ihre Augen geschlossen, ihre Atemzüge kaum wahrnehmbar. Ihr Körper, ein lebloses Relikt, das mich jeden Tag daran erinnert, wie wenig Kontrolle ich über das habe, was uns widerfahren ist.
Aber sie lebt. Irgendwie. Und das ist alles, was ich habe. Doch wie lange noch?
Leora geht oft an ihrer Seite auf und ab, ihre Augen leer, ihre Bewegungen mechanisch. Sie ist stark, aber diese Stärke ist zerbrochen, wie ein Glas, das zu oft gefallen ist und nie wieder ganz wird. Sie sieht mich nicht an, und das tut weh. Denn ich kann sie nicht berühren. Ich darf es nicht, wegen des Schwurs.
Es gibt Nächte, in denen ich sie fast zu spüren glaube. Ihre Nähe, ihre Wärme, als würde sie mich noch immer brauchen. Doch ich weiß, dass ich sie nicht retten kann. Nicht mehr. Denn meine Berührung würde sie töten. Und das wissen wir beiden.
Daemon hat uns beide in den Abgrund gezogen, aber was er mir angetan hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was er ihr genommen hat. Ich träume von den Momenten, als er sie mir entriss, als er sie berührte – und ich nichts tun konnte. Wie ich hilflos zusah, wie sie zerbrach unter seiner Gewalt, wie ihre Augen in jener schmerzhaften Erkenntnis funkelten, dass sie nicht mehr die war, die sie einmal gewesen ist. Und es war meine Schuld. Denn ich konnte sie nicht schützen.
Daemon hat mir nicht nur ihren Körper genommen. Er hat mir meine Seele geraubt.
Ich war ein Mann, der sich immer als stark sah. Der nicht vor den Herausforderungen der Welt zurückschreckte. Doch Daemon hat mir gezeigt, was wahre Zerstörung bedeutet.
Er hat mich erniedrigt.
Er hat mich gebrochen.
Er hat mir den Glauben an mich selbst genommen und mich in eine leere Hülle verwandelt.
Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel sehe, sehe ich nicht den Mann, der ich war. Ich sehe nur den Mann der zu schwach war die Liebe seines Lebens zu beschützen. Und das ist etwas, das ich mir niemals vergeben werde.
Ich frage mich oft, ob sie mich noch ansehen kann. Ob sie in meinen Augen noch den Mann sieht, den sie einst geliebt hat. Ob sie mich je wieder als den Mann sehen wird, der sie in ihren schlimmsten Momenten beschützen wollte.
Aber dann erinnere ich mich daran, dass es keine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle, ob sie mich noch liebt.
Es spielt keine Rolle, ob sie mich noch ansehen kann. Denn ich kann sie nicht berühren. Nicht so, wie ich es möchte. Nicht so, wie sie es verdient.
Der Schwur, den Daemon uns beiden auferlegt hat, ist ein unsichtbares Gefängnis, das uns trennt. Eine Kette, die uns auf ewig binden wird, aber uns gleichzeitig voneinander fernhält.
Manchmal träume ich von ihr. Wie sie mich anblickt, ihre Augen voller Tränen. Aber in diesen Träumen gibt es keine Nähe. Keine Umarmung. Kein Trost.
Nur das Wissen, dass ich sie verloren habe.
Dass ich sie immer verlieren werde, solange ich nicht den Mut finde, mich von ihr zu befreien.
Aber dann, an manchen Tagen, wenn der Wind durch die Bäume weht und die Sonne die Schatten auf den Boden malt, fühlt es sich an, als könnte ich mich ein Stück weit selbst wiederfinden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung.
Vielleicht gibt es noch einen Weg, aus diesem Gefängnis zu entkommen.
Vielleicht.
Ich bin Kain.
Gebrochen, ja.
Aber nicht ganz gefallen.
Nicht ganz.
Ich habe gesehen, was ich hinterlassen habe. Kain, gebrochen, verzweifelt, mit seiner Gefährtin, die ihn nicht mehr berühren kann – eine süße, unnahbare Frucht direkt vor seinen Augen. Zuvor gepeinigt, gebrochen, gezeichnet von meiner Hand. Und Kate? Sie hängt tot an der Wand, vielleicht längst entdeckt, vielleicht noch verborgen in der Finsternis.
Vielleicht hat Marcus den Kampf lange in Gang halten können, so das noch niemand nach ihr gesucht hat.
So oder so hatte es ihn nicht retten können, dass er an seinen eigenen Sieg geglaubt hat, blind für das, was unausweichlich war.
Christiano hat ihn gewiss besiegt – das stand nie in Frage. Nur Marcus selbst war töricht genug, zu glauben, es könnte anders sein. Aber was spielt es noch für eine Rolle? Es sind alles nur Risse in einem geschwächten Fundament. Sie konnten fliehen, ja. Diese verfluchte Lilien war bei ihnen. Doch es war genug. Es war ein Sieg. Kein vollständiger. Aber ein Sieg, der mich hierhergeführt hat.
Hier, an diesen Ort, an dem alles, was ich war, vergehen wird und etwas Neues entsteht.
Die Dunkelheit ruft mich. Tiefer als jede Stimme, lauter als jedes Geräusch. Sie ist nicht einfach nur Stille, sondern ein Echo aus längst vergangenen Zeiten, eine uralte Macht, die in den Schatten der Welt verborgen liegt. Sie flüstert in Lauten, die kein Ohr hören sollte, in einer Sprache, die kein Sterblicher verstehen kann. Und doch verstehe ich. Ich höre sie in den Wänden der Höhlen, in den toten Winkeln meines Geistes, in dem leeren Raum, den meine Siege zurückgelassen haben. Sie war immer da, wartend, lauernd, verborgen in den Rissen zwischen Zeit und Raum. Eine Kraft, die nur darauf gewartet hat, dass jemand kommt, um sie zu empfangen. Nun bin ich hier. Und sie ergießt sich in mich.
Zuerst war es nur ein Wispern, kaum mehr als ein sanftes Streichen über meine Sinne, eine süße Verheißung, wie der Duft von reifem Obst – trügerisch, vergiftet. Doch je länger ich ihr lauschte, je tiefer ich mich in die Schatten wagte, desto stärker wurde sie. Was einst ein Flüstern war, ist nun ein Strom, der mich mit sich reißt, ein Abgrund, der mich verschlingt.
Mit jedem Schritt auf diesem Pfad fällt das Alte von mir ab. Das Menschliche zerbricht wie morsches Holz, verpufft in der Schwärze, bis nichts mehr bleibt als das, was ich nun bin. Kein Mann, kein Sterblicher, kein Wesen aus Fleisch allein. Etwas anderes erhebt sich in mir, formt mich neu, strömt durch meine Adern.
Die Schatten sind nicht mehr bloß Finsternis. Sie bewegen sich, recken sich mir entgegen, schmiegen sich an meine Haut wie treue Diener, schlingen sich um mich wie eine zweite Existenz. Ich spüre, wie sie durch mich hindurchfließen, mich füllen, mich durchtränken mit etwas, das zugleich unstillbarer Hunger und unbegrenzte Macht ist. Ein Rausch, ein brennendes Feuer, das mich verschlingt und mich doch unermesslich stark macht.
Die Luft wird schwer. Die Welt um mich herum scheint sich zu verändern, als könne sie meine Anwesenheit nicht mehr ertragen. Steine beben, Wände atmen, und die Dunkelheit, die mich empfängt, ist nicht länger leer. Sie ist lebendig, pulsierend, durchtränkt von uraltem Wissen und unaussprechlicher Macht.
Macht sickert durch die Adern, durch die Haut, durch das Sein. Ein Fieber, ein Hunger, ein Rausch. Es giert, es zehrt, es füllt. Und mit jeder Füllung wächst die Leere.
Ich höre die Welt flüstern, leise, fast flehend. Sie spürt es. Sie weiß, dass etwas erwacht. Sie wehrt sich, warnt, versucht, sich zu entziehen. Doch es ist zu spät.
Denn es ist geschehen.
Und das Verhängnis kommt.
Kapitel 1
Es sind nun ein paar Wochen vergangen, seit dem Angriff. Kate liegt immer noch in Christiano Armen, regungslos, doch sie atmet. Ihre Wunde ist tief, und selbst nach all dieser Zeit kann ich das Bild nicht aus meinem Kopf bekommen. Sie sieht so zerbrechlich aus, als ob sie bei jeder Bewegung einfach zerbröckeln würde. Ich habe mich längst an die ständige Präsenz der Unruhe gewöhnt. Seitdem hat sich alles verändert. Lilien und Diane sind bei uns, und die Burg ist voller Menschen, deren Gedanken ich nicht immer durchdringen kann.
Diane hat sich in ihrem Zimmer bei Bronn eingelebt. Ich habe nichts dagegen. Sie hält sich meist zurück, spricht wenig, aber wenn sie spricht, dann tut sie es mit einer Klarheit, die nicht jeder versteht. Sie ist eine stille Beobachterin. Lilien, auf der anderen Seite, bewegt sich viel, wenn auch vorsichtig. Ich habe ihr ein Zimmer in der Nähe gegeben, damit sie jederzeit zu Diane kann. Was sie an den anderen interessiert, lässt sich schwer sagen. Sie ist freundlich, aber distanziert, fast ängstlich. Sie mag Kain und Leora, und die beiden scheinen sie ebenfalls zu mögen, was ich auch nachvollziehen kann. Leora hat eine Aura der Geborgenheit, die viele anzieht, während Kain – trotz seiner Stärke – eine gewisse Verletzlichkeit in sich trägt, die Lilien anscheinend spürt. Zudem kamen sie gemeinsam hier an und scheinen etwas gemeinsam durchgestanden zu haben, was sie verbindet.
Ich selbst halte die Stellung, wie es Christiano von mir verlangt hat. Der Plan war, dass er an Kates Seite bleibt, solange sie in diesem Zustand verharrt, und dass ich hier draußen dafür sorge, dass alles funktioniert. Wachen werden aufgestellt, Späher durchstreifen das Umland, und ich überwache alles. Ein Stratege muss immer die Fäden in der Hand halten, auch wenn er sich nach außen wie ein ruhiger Flusses zeigen muss. Doch innerlich bin ich ständig auf der Hut. Jeder Schritt, den ich mache, hat Gewicht.
Doch was mich wirklich beschäftigt, ist die Sache zwischen Leora und Kain. Diese verdammte Blutschwur-Geschichte. Ich verstehe den Fluch nicht ganz, auch wenn ich die Grundlagen kenne. Leoras Körper ist nun Daemons Stimme hörig, und Kain… er kann sie nicht mehr berühren. Nicht in der Weise, wie er es einst tat. Es frisst ihn innerlich auf, wenn ich es genau betrachte. Ich sehe es in seinen Augen, in seiner Haltung. Er zieht sich mehr und mehr zurück, als würde er sich selbst bestrafen.
Dabei hat er nichts falsch gemacht. Aber dieser Fluch, diese verdammte Magie, sie beginnt ihn zu zerstören. Etwas in ihm wird zerbrechen, und ich fürchte, wir werden alle zusehen müssen.
Ich sehe es ihm an, jedes Mal wenn er glaubt, niemand beobachte ihn. Diese angespannte Stille in seiner Haltung, der Blick, der zu Leora wandert und sich sofort wieder abwendet, als würde allein der Gedanke an Nähe ihn verbrennen. Kain war nie jemand, der Schwäche zeigt – nicht offen zumindest. Doch ich kenne ihn lange genug, um zu wissen, wann seine Fassade zu bröckeln beginnt.
Ich lasse ihn nicht alleine damit. Nicht jetzt, nicht in diesem Zustand.
Am Morgen finde ich ihn im Innenhof, allein mit dem Schwert, das er mehr aus Gewohnheit als aus Überzeugung schwingt. Die Bewegungen sind kraftvoll, präzise – aber leer. Automatisch. Ich trete an ihn heran, sage erst mal nichts. Er merkt es natürlich, ich spüre, wie seine Muskeln bei meiner Nähe für einen Moment anspannen. „Du kämpfst gegen etwas, das kein Schwert je zerschneiden wird.“ Er stoppt, senkt das Schwert, aber sieht mich nicht an. Nur ein leises, raues Lachen. Bitter.
„Hast du einen besseren Vorschlag, Taron?“
Ich zucke mit den Schultern, trete näher, meine Stimme bleibt ruhig, fast beiläufig. „Vielleicht solltest du endlich anfangen, nicht allein gegen alles zu kämpfen. Leora ist nicht dein Feind. Und dieser Fluch… er ist mächtig, ja, aber nicht unlösbar. Du weißt das.“ Er sieht mich jetzt. Und da ist dieser Ausdruck – verletzt, müde, wütend auf alles, was er nicht kontrollieren kann.
Ich sage es nicht laut, aber ich kenne das Gefühl. Die Ohnmacht, wenn jemand, der dir mehr bedeutet, als du je zugeben würdest, plötzlich unerreichbar ist. Vielleicht ist das der Grund, warum ich so hartnäckig bleibe. Weil ich weiß, was auf dem Spiel steht.
Also ändere ich meinen Ton. Weniger sachlich, direkter. „Wenn du zerbrichst, zieht das Kreise. Du weißt, wie viele auf dich zählen. Nicht nur ich. Nicht nur sie. Wenn du wirklich glaubst, dass sie dich weniger liebt, weil du sie nicht mehr berühren kannst – dann belügst du dich selbst. Und wenn du daran zerbrichst, hast du ihm genau das gegeben, was er wollte.“
Kain versteht sofort. Seine Kiefer spannen sich an, und ich sehe, dass es in ihm arbeitet.
Ich weiß, ich kann ihn nicht zwingen, darüber zu reden. Aber ich kann dafür sorgen, dass er nicht weiter in diesem Loch verschwindet. Also binde ich ihn ein. Immer öfter. Lasse ihn helfen bei den Patrouillenplänen, bei der Organisation der Wachwechsel, gebe ihm Aufgaben, die ihn fordern, die ihn ablenken. Nicht, um ihn zu beschäftigen – sondern um ihm das zurückzugeben, was ihm gerade entgleitet: Kontrolle. Einfluss. Bedeutung.
Schicke ihn zurück in seine Stellung als Christianos rechte Hand, Stück für Stück.
Und ich bleibe nah. Rede mit ihm, auch wenn es nur über banale Dinge ist. Teile kleine Beobachtungen, manchmal auch bissige Bemerkungen, weil ich weiß, dass genau das ihn aufweckt. Weil er auf meine Ironie reagiert, selbst wenn er genervt die Augen verdreht. Manchmal hilft ein Vertrauter schon ein wenig, und genau das bin ich für ihn.
Ich sitze auf der Mauer, die Beine über dem Abgrund, wie ich es manchmal tue, wenn der Druck mir zu eng wird. Der Wind trägt den Geruch von feuchtem Stein und harter Erde mit sich. Unten patrouilliert eine Wache, ihr Licht tanzt wie ein glühender Punkt durch die Dunkelheit. Über mir nur Wolken, kein Stern in Sicht. Mein Blick schweift über das Land, doch meine Gedanken hängen bei Kain. Bei Leora. Bei diesem verdammten Schmerz in seinen Augen, der ihn jedes Mal trifft wie ein Schlag, wenn er in ihre Nähe kommt. Es ist nicht nur der Fluch, der ihn quält – es ist die Nähe ohne Berührung, die Liebe ohne Möglichkeit, sie ihr bedingungslos ausschütten zu können. Diese ständige Spannung zwischen „ich will“ und „ich darf nicht“. Und es trifft mich härter, als ich zugeben will.
Ich habe nie jemanden an mich herangelassen. Nicht so. Nicht in der Tiefe, wie es Kain bei Leora getan hat. Ich wusste immer, dass Nähe eine Schwäche sein kann. Dass sie benutzt werden kann. Ich habe es gesehen – in Kriegen, in Intrigen, in den Augen derer, die etwas zu verlieren hatten.
Und ich? Ich hatte nie etwas zu verlieren. Nie jemanden. Es war eine Wahl, und sie war nie wirklich schwer.
Aber jetzt... sehe ich, was es kosten kann. Nicht das Alleinsein. Sondern das Gegenteil. Der Moment, in dem jemand dein Zentrum wird, dein Anker – und du nichts tun kannst, wenn dieser Anker dir entgleitet. Es ist nicht die Liebe, die gefährlich ist. Es ist die Ohnmacht, die sie mit sich bringt. Das Ausgeliefertsein.
Kain ist stark, stärker als die meisten. Und selbst ihn sehe ich zerbrechen, weil er sie nicht retten kann. Weil er nicht einmal bei ihr sein darf, ohne sie in Gefahr zu bringen.
Ich könnte das nicht. Ich werde das nicht.
Ich lehne mich zurück, die Hände hinter mir auf dem kalten Stein abgestützt. Der Wind reißt an meinem Mantel, als wolle er mich wachrütteln.
Ich bin nicht gemacht für diese Art von Bindung. Ich funktioniere am Rand. Im Schatten. Als Stratege, als Beobachter, als jemand, der Ordnung in das Chaos bringt – nicht jemand, der sich mitten hineinwirft, mit offenem Herzen und ungeschützter Brust. Ich kann es nicht zulassen, dass jemand mein Schwachpunkt wird. Ich bin nicht bereit, meine Entscheidungen mit Emotionen zu teilen, die mir die Klarheit nehmen würden, die ich brauche, um diesen Ort zu führen. Um ihn zu schützen. Vielleicht ist das kalt. Vielleicht sogar feige. Aber es ist der Preis, den ich wähle. Der einzige Weg, wie ich bestehen kann in dieser Welt voller Flüche, Kriege und verlorener Seelen.
Ich habe mich einmal gefragt, was ich verpasse. Jetzt weiß ich, was ich vermeide.
Der Weg zum Trainingsplatz führt mich durch den halb verwaisten Innenhof. Die meisten schlafen zu dieser Stunde, nur vereinzelte Wachen nicken mir zu. Ich gehe mit den Händen in den Taschen, der Wind ist kälter geworden, und in meinem Kopf hallt noch das Echo meiner Gedanken über Kain nach.
Doch dann sehe ich ihn – Bronn. Er steht mit bloßem Oberkörper am Rand des Platzes, schweißglänzend, die Haut übersät mit alten Narben und neuen blauen Flecken. Er schwingt das Übungsschwert mit der vertrauten Mischung aus roher Kraft und kontrollierter Wut. Ich beobachte ihn einen Moment. Er sieht besser aus. Fitter. Die Verletzung, die ihn vor Wochen noch kaum aufrecht stehen ließ, scheint kaum noch mehr als ein Schatten in seiner Bewegung zu sein.
„Na schau einer an“, sage ich, als ich näherkomme, meine Stimme wie immer trocken, „du siehst fast wieder aus wie ein brauchbarer Kämpfer. Ich war schon kurz davor, dich bei den Küchenjungen unterzubringen.“ Bronn dreht sich zu mir um, grinst breit, sein Blick blitzend vor Spott.
„Taron! Du lebst noch. Ich dachte schon, du bist mit deinen Listen und Plänen verschmolzen und führst jetzt Krieg gegen Papier.“ Ich hebe eine Braue. „Papier ist gefährlich. Schnitte brennen schlimmer als deine Laune nach dem Aufstehen.“
Er lacht, schwingt das Schwert ein paarmal locker hin und her, dann bleibt er stehen und schaut mich abschätzend an. „Was ist los? Kommst du runter, um ein bisschen zu reden oder willst du’s auch mal wieder spüren, wie’s ist, wenn man echtes Gewicht in der Hand hält und nicht nur Verantwortung?“ Ich seufze gespielt theatralisch, ziehe die Handschuhe aus und lege den Mantel ab. „Ich wusste, es war ein Fehler, dich lobend im Kopf zu erwähnen. Jetzt fühlst du dich gleich wieder unsterblich.“ „Na komm schon, Stratege.“ Bronn grinst noch breiter und wirft mir ein Holzschwert zu. „Reden kannst du später weiter. Jetzt zeig mir, ob du noch weißt, wie man sich bewegt, ohne dabei eine Karte zu falten.“
Ich fange das Schwert mit einem sicheren Griff, wie automatisch, und gehe ein paar Schritte auf ihn zu. Mein Blick ist ruhig, aber die Müdigkeit in meinen Schultern verflüchtigt sich langsam. Es ist ein vertrautes Gefühl, das Holz in der Hand, der lockere Stand, die Spannung zwischen zwei alten Kameraden.
„Wenn du mich am Ende wieder beschuldigst, unfair zu kämpfen, dann beschwer dich diesmal wenigstens nicht.
„Unfair ist es nur, wenn du gewinnst.“ Bronn grinst, geht in Position. Wir umkreisen uns. Die ersten Hiebe sind locker, wie ein Tanz unter Brüdern. Kein Blut, nur das Knacken von Holz, das Klatschen von Stößen, das gelegentliche Lachen, wenn einer von uns dem anderen beinahe das Schwert aus der Hand schlägt.
Für ein paar Minuten gibt es kein Fluch, keine Strategie, kein Gewicht auf meiner Brust. Nur Bewegung. Reflex. Die alte Sprache, die wir beide sprechen, ohne Worte.
Wir kämpfen eine Weile schweigend weiter, der Rhythmus festigt sich, wird schneller, intensiver. Bronn trifft knapp meinen Oberarm, ich kontere mit einem schnellen Stoß gegen seine Schulter. Er lacht, ich schnaube und wir stehen für einen Moment schwer atmend gegenüber, das Holzschwert in der Hand ruhend.
Ich drehe es spielerisch in der Hand, dann lasse ich meinen Blick zur Seite gleiten – dorthin, wo Diane manchmal steht, wenn sie zuschaut. Heute ist sie nicht hier. Aber der Gedanke genügt.
„Sag mal, Bronn…“, beginne ich, die Stimme betont beiläufig, während ich langsam im Kreis gehe, „markierst du jetzt öfter Frauen einfach so, oder war Diane eine Ausnahme?“ Er stoppt nicht sofort, führt noch eine halbe Drehung aus, dann bleibt er stehen und schaut mich mit zusammengezogenen Brauen an. „Wird das jetzt so ein Gespräch?“
Ich grinse nur schief. „Ein Gespräch unter Freunden, ja. Ich mein… es ist schon eine besondere Art von Aufmerksamkeit, jemanden auf diese Art vor dem Tod zu bewahren. Hat sie dir eigentlich dafür eine Ohrfeige verpasst?“
„Die hätte sie mir auch so verpasst.“ Bronn schnaubt, senkt das Schwert und wischt sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Aber da ist dieser Moment des Zögerns. Ganz kurz. Kaum sichtbar – wenn man ihn nicht so gut kennt wie ich.
Ich lasse das Grinsen langsam verblassen, werde ernster. Meine Stimme verliert das Neckische, wird ruhiger. „Wie sieht’s aus, Bronn? Du musstest sie nicht markieren. Nicht aus Pflicht. Du hast es getan, weil sie dir was bedeutet. Oder?“
Er sieht weg. Und das ist Antwort genug.
„Du weißt, wie sie ist“, murmelt er schließlich. „Sie ist… wie ein Sturm, der keine Richtung kennt. Störrisch, laut, gefährlich – und wenn du nicht aufpasst, frisst sie dich einfach mit Haut und Haar.“
Ich nicke langsam. „Ja. Klingt vertraut. Als würde ich über dich reden.“ Bronn wirft mir einen schiefen Blick zu, aber sagt nichts. „Sie ist dir ähnlicher, als du dir eingestehen willst“, fahre ich leise fort. „Und genau das macht euch beide so kompliziert. Zwei Köpfe, beide zu stolz, beide zu dominant. Ihr duldet keine Schwäche – nicht bei euch, nicht beim anderen. Und genau deswegen knistert es so sehr zwischen euch, dass ich manchmal denke, gleich fackelt das halbe Stockwerk ab.“ „Sie braucht keinen Schutz“, murmelt er. „Nein“, sage ich, „aber das heißt nicht, dass du sie nicht trotzdem beschützen willst.“
Er schweigt wieder. Die Stille ist schwer, aber nicht feindlich. Ich sehe, wie er mit den Gedanken ringt, mit sich selbst. Es ist kein Mann, der leicht spricht. Und schon gar nicht über Dinge wie das hier. Ich lasse ihn. Dränge nicht weiter.
„Sie ist kein Projekt. Kein Kampf, den du gewinnen musst. Sie ist jemand, der dich vielleicht genauso braucht, wie du sie – nur wird keiner von euch das zuerst zugeben.“
Bronn hebt das Schwert wieder an, sein Blick hat sich verändert. Nicht weich, nicht unsicher – aber tiefer. Als würde er jetzt kämpfen, um zu denken.
„Noch eine Runde?“, fragt er.
Ich nicke. „Klar. Vielleicht bring ich dir heute bei, wie man mit einer Frau redet, ohne zu grunzen.“
„Fang lieber an, schneller zu blocken“, knurrt er – und schlägt zu. Ich blocke seinen Angriff knapp, das Holz unserer Schwerter kracht hart aufeinander, und der Ruck zieht mir durch den Unterarm. Bronn drückt nach, testet, wie lange ich standhalte. Ich weiche aus, trete einen Schritt zur Seite, bevor ich wieder in Position gehe.
„Wenn du mit Diane so stur bist wie im Kampf, wundert’s mich nicht, dass sie dir regelmäßig die Stirn bietet“, murmele ich, während ich kontere. „Zwei Felsen, die aufeinander zu rennen. Keine Wunder, dass es Funken gibt.“
Bronn grinst, aber es ist ein schiefer, fast verbissen wirkender Ausdruck. „Sie lässt sich nichts sagen. Nicht von mir, nicht von irgendwem.“ „Und genau das gefällt dir.“
Er stoppt wieder, nicht vollständig, aber lang genug, dass ich sehe, wie der Satz bei ihm einschlägt. Er schaut mich nicht direkt an, starrt stattdessen irgendwo über meine Schulter ins Dunkel. „Ich hab niemanden markiert, um jemanden zu besitzen, Taron. Das weißt du.“
„Weiß ich.“ Ich senke das Schwert ein wenig. „Aber du hast es auch nicht getan, weil sie dir egal war.“
Er atmet schwer aus, als würde er den Kampf mit Worten fast schwerer finden als den mit Klingen.
„Sie hat mir keine Wahl gelassen. Sie wäre gestorben. Ich…“ Er unterbricht sich, der Gedanke stockt. „Ich konnte das nicht zulassen.“ Ich sehe ihn an, ruhig. Lasse Raum.
„Ich kenne dich, Bronn. Wenn’s dir wirklich nur um Pflicht gegangen wäre, hättest du es gar nicht erst in Erwägung gezogen.“
Ein leises Schnauben. „Verzieh dich mit deiner verdammten Menschenkenntnis.“
Ich lache, leise, aufrichtig. „Glaub mir, ich würd es manchmal auch lieber nicht sehen. Aber du hast’s getan. Weil sie dir was bedeutet. Und jetzt steckst du drin. Mitten im Sturm, den du nicht kontrollieren kannst.“ Er hebt das Schwert wieder, aber sein Stand ist anders – nicht mehr so hart, nicht mehr so abwehrend. „Und was soll ich tun? Ihr sagen, dass ich was fühle? Das wär, als würd ich versuchen, mit bloßen Händen Feuer zu zähmen.“
Ich drehe mein Schwert langsam in der Hand. „Vielleicht. Oder du verbrennst dich, ja. Aber vielleicht... vielleicht wär’s das erste Mal, dass du nicht gegen jemanden kämpfen musst – sondern mit.“
Stille. Nur unser Atem, das Knirschen unserer Schritte auf dem Boden. Dann hebt Bronn sein Schwert, diesmal nicht zum Schlag, sondern zum Gruß.
„Eines Tages wird sie mir den Schädel einschlagen, Taron.“ Ich hebe mein Schwert ebenfalls. „Dann kannst du ihr beim Heilen erzählen, dass du’s verdient hast.“
Ein kurzes, raues Lachen von ihm – und dann geht es wieder los. Schwert gegen Schwert. Freund gegen Freund. Nicht als Feinde. Sondern als Männer, die sich gegenseitig daran erinnern, dass selbst hinter Stahlherzen noch etwas schlägt.
Ich klopfe Bronn ein letztes Mal mit dem Schwertgriff gegen die Schulter – ein stummes Zeichen, dass das genug war für heute. Er nickt nur, sein Blick bleibt gedankenverloren, während ich mein Schwert ablege und den Mantel wieder überwerfe.
Der Weg zur Mauer ist mir vertraut. Ich gehe ihn fast jeden Abend. Dort oben ist es ruhig, der Wind spricht eine ehrlichere Sprache als die meisten Menschen hier unten. Die Nacht ist klar, kühl, der Himmel übersät mit Sternen, als hätte jemand tausend winzige Wunden in den Himmel geritzt und Licht dahinter gelegt.
Doch schon bevor ich die letzte Stufe erreiche, spüre ich, dass ich heute nicht allein bin.
Ein schmaler Schatten sitzt auf der Steinbrüstung, die Knie angezogen, den Blick nach oben gerichtet. Die langen Haare bewegen sich leicht im Wind, eine zierliche Gestalt, fast still wie ein Bild – aber lebendig. Wachsam.
Lilien.
Ich halte unwillkürlich einen Moment inne. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand Ruhe sucht – aber Lilien meidet andere, vor allem Männer, wo sie nur kann. Dass sie ausgerechnet hier oben sitzt, zu dieser Stunde, an meinem Ort der Stille... überrascht mich.
Ich trete nicht näher. Bleibe dort stehen, wo die letzte Stufe endet, einige Schritte entfernt. In sicherem Abstand. Ich will ihr keinen Grund geben, sich unwohl zu fühlen. Mein Blick wandert von ihr zum Himmel. „Ist klar heute Nacht“, sage ich leise, nur um die Stille zu durchbrechen, nicht um ein Gespräch zu erzwingen. „Fast zu klar.“ Keine Antwort. Nur ein kaum sichtbares Nicken. Sie hat mich gehört. Mehr erwarte ich nicht.
Ich setze mich auf die Mauer, weit genug entfernt, dass sie Raum hat – aber nicht so fern, dass es wie Desinteresse wirkt. Ich bin einfach da. Manchmal reicht das. Ich blicke zu den Sternen, lasse den Wind durch meine Gedanken streichen.
Einige Minuten vergehen. Die Stille ist nicht unangenehm – sie ist zart, fast zerbrechlich, wie eine Schneeflocke, die zu früh im Jahr fällt.
„Ist das dein Ort?“, fragt sie plötzlich, leise. Fast flüsternd. Ihre Stimme ist klar, aber vorsichtig, wie jemand, der etwas Wertvolles nicht zerbrechen will.
Ich brauche einen Moment, ehe ich antworte. „Ja. So etwas in der Art. Ich komm her, wenn alles zu laut wird.“ Sie nickt langsam. Dann, ohne mich anzusehen: „Ich wusste nicht… ich wollte nicht stören.“
„Du störst nicht.“ Meine Stimme bleibt ruhig, ehrlich. Keine Floskeln, keine übertriebene Freundlichkeit. Nur die Wahrheit. „Jeder braucht einen Ort wie diesen.“
Wieder Stille. Doch sie fühlt sich jetzt anders an. Nicht mehr zwischen zwei Fremden, sondern wie ein vorsichtiger Versuch, sich den Raum zu teilen – ohne Bedrohung, ohne Druck. Ich lehne mich leicht zurück, die Hände auf der kalten Steinfläche abgestützt.
Der Wind kühlt meinen Nacken, bringt den Geruch der Nacht mit sich – feuchtes Moos, Stein, etwas Rauch vom fernen Herdfeuer. Ich frage mich, wie lange sie schon hier sitzt. Ob sie hierher kam, weil sie dachte, niemand würde sie finden. Oder ob sie wusste, dass ich oft hier bin – und sich entschied, es trotzdem zu riskieren.
Ich drehe den Kopf ein wenig, sehe sie aus dem Augenwinkel an. Sie wirkt kleiner als sonst, zerbrechlicher in der Weite des Himmels über uns.
„Manchmal hilft es, den Himmel zu betrachten“, sage ich leise. „Er erinnert einen daran, wie klein das alles hier unten ist. Wie viel weiter alles gehen kann, als man gerade glaubt.“
Ein leises Geräusch – vielleicht ein Atemzug, vielleicht Zustimmung. Ich sage nichts mehr. Worte wären jetzt nur Lärm. Also sitze ich da, wie ein Schatten am Rand ihrer Welt.
Nach einer Weile höre ich sie leise einatmen, fast zögerlich, bevor ihre Stimme sich wieder in die Nacht mischt.
„Ich dachte, hier oben… würde mich keiner finden.“ Ihre Worte tragen keine Schärfe, keinen Vorwurf – nur Feststellung. Vielleicht eine Spur Unsicherheit.
Ich neige leicht den Kopf. „Das dachte ich früher auch. Und meistens stimmt’s sogar. Aber heute Nacht... haben wir wohl denselben Gedanken gehabt.“
Sie sagt erst nichts, und ich spüre fast, wie sie innerlich abwägt. Doch sie bleibt. Das allein ist Antwort genug.
„Du… bist oft still“, sagt sie dann vorsichtig.
Ein schmaler, fast unsichtbarer Schmunzler zieht an meinen Lippen. „Kommt drauf an, wen du fragst. Kain würde sagen, ich rede zu viel. Leora, dass ich zu wenig sage. Und Bronn… würde gar nichts sagen und mir nur diesen Blick zuwerfen.“
Ein kurzes, kaum hörbares Geräusch entweicht ihr. Ein Lufthauch. Vielleicht so etwas wie ein schüchternes Lächeln. Ich riskiere nicht, hinzusehen. Ich will es nicht verscheuchen.
„Du wirkst nicht... so wie die anderen Männer.“
Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Hauch.
Ich antworte nicht sofort. Nicht, weil ich nichts zu sagen hätte – sondern weil ich spüre, dass sie es ernst meint. Dass es sie etwas kostet, so etwas überhaupt auszusprechen.
„Vielleicht, weil ich nicht versuche, etwas von dir zu wollen“, sage ich schließlich ruhig. „Ich will dich nicht trösten, nicht retten, nicht festhalten. Ich will nur, dass du atmen kannst, ohne Angst.“ Wieder Stille. Doch sie ist weicher jetzt.
Nach einer Weile höre ich, wie sie sich bewegt – ganz leicht. Keine Flucht. Keine Panik. Nur ein Positionswechsel, wie jemand, der es wagt, sich ein kleines Stück zu entspannen.
„Diane sagt..., dass manche Wunden nie ganz heilen. Aber man lernt, mit ihnen zu leben.“
Ich nicke langsam. „Sie hat recht. Manche Dinge hinterlassen Spuren. Aber es macht einen nicht weniger… vollständig. Nur anders.“ Ein weiteres Nicken ihrerseits.
Ich sitze einfach da. Die Kälte der Steine dringt langsam durch die Kleidung, aber ich lasse sie. Es hat etwas Ehrliches, wenn die Nacht einem zeigt, dass man noch lebt, dass man noch fühlt. Selbst durch Kälte. Lilien sagt nichts mehr, und ich zwinge sie nicht dazu. Ihre Anwesenheit ist leise, aber sie trägt Gewicht. Nicht unangenehm – eher wie der Druck einer Narbe, die nicht mehr schmerzt, aber spürbar bleibt, wenn man sie berührt.
Sie bewegt sich wieder, diesmal ein wenig näher an die Brüstung heran, nicht in meine Richtung, nicht zu mir – aber weg von der Fluchtstellung. Ihre Beine baumeln nun über dem Rand. Ich sehe, wie ihre Finger sich fest in die Kante krallen. Als müsste sie sich selbst daran erinnern, dass sie nicht fällt.
„Ich hab früher immer gedacht, wenn ich jemanden an mich ranlasse…, dann verliere ich mich.“ Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Windstoß, aber klar. „Und mit ihm… Daemon… war es genau das. Ich war plötzlich nicht mehr da, nicht mehr ich.“
Ich sage nichts. Meine Finger ruhen ruhig ineinander verschränkt. Ich höre zu. Ganz. Ohne Urteil.
„Diane… sie hat mich nicht gefragt, ob ich reden will. Sie war einfach da. Ist es immer noch. Und Leora… sie streitet mit mir, damit ich mich erinnere, dass ich eine Stimme hab.“ Ein leises, fast schwermütiges Lächeln zieht mir über die Lippen. Das klingt nach Leora. Ganz genau so.
„Und Kain?“, frage ich sanft.
Lilien zögert. Dann: „Er ist wie ein Bruder den ich nie hatte. Bei ihm ist es leicht still zu sein, zu lächeln.“
Ich nicke langsam. „Dann such dir Menschen, die genau das mit dir machen. Die dich nicht auffressen wollen, sondern dir Raum lassen. So heilt man.“
Sie ist still. Ich weiß nicht, ob sie gerade zuhört oder gegen ihre eigenen Gedanken ankämpft. Vielleicht beides.
Nach einer Weile spricht sie wieder, leiser, fast wie ein Geständnis: „Du schaust mich nicht an, wie die anderen es tun. Nicht so, als wäre ich zerbrochen. Auch nicht wie… Besitz.“
Ich sehe noch immer nicht direkt zu ihr, aber ich spüre, dass ihr Blick auf mir ruht.
„Vielleicht“, sage ich ruhig „weil ich selbst weiß, wie es ist, aus Scherben zu bestehen.“
Eine lange, ruhige Stille legt sich wieder zwischen uns. Keine Angst mehr darin. Kein Misstrauen. Nur ein vorsichtiges, gegenseitiges Erkennen. „Danke, Taron“, flüstert sie.
Ein schlichtes Wort. Aber es trägt Gewicht.
Ich nicke nur. Ohne große Geste. „Wann immer du hier oben sein magst... mich störst du nicht. Es gibt genug Himmel zu teilen.“ Ein leises „Okay.“ Dann wieder Stille.
Ich bleibe noch eine Weile. Bis der Wind schärfer wird und ihre Schultern sich kaum merklich anspannen. Dann erhebe ich mich langsam, geräuschlos, damit sie sich nicht erschrickt.
„Ich lass dir den Himmel für heute. Schlaf gut, Lilien.“ Ich drehe mich nicht um, sehe nicht nach, ob sie mir nachblickt. Ich gehe einfach. So, wie ich gekommen bin.
Aber etwas hat sich verändert. Vielleicht nicht viel. Vielleicht nur ein Hauch.
Doch manchmal… beginnt Vertrauen mit genau so wenig. Die Treppen hinunter sind still. Die Burg schläft, bis auf vereinzelte Schritte von Wachen, die wie Schatten an den Wänden vorbeiziehen. Ich grüße niemanden. Nicht, weil ich unhöflich wäre, sondern weil Worte jetzt nicht mehr notwendig sind. Mein Schritt ist ruhig, gleichmäßig. Die Begegnung mit Lilien klingt noch in mir nach – wie ein leiser Akkord, der nicht ganz verklingt, aber auch nicht stört.
Mein Quartier ist schlicht, wie alles an mir. Kein überflüssiger Prunk, keine persönlichen Dinge, die mich binden oder mich weich werden lassen. Nur ein Raum. Schutz vor dem Außen. Ich schließe die Tür, lehne mich für einen Moment mit dem Rücken dagegen und lasse die Stille durch mich hindurchfließen.
Meine Kleidung lege ich ordentlich zusammen, wie immer. Rituale halten den Tag in Ordnung, geben Struktur, wenn Gedanken zu viele Wege nehmen könnten. Das Schwert kommt an seinen Platz – nahe genug, um es im Schlaf zu greifen, falls nötig. Alte Gewohnheit. Alte Narben. Das Bett ist kalt, als ich mich hinlege. Doch ich bin es gewohnt. Wärme ist kein Zustand, den ich suche. Sie kommt manchmal – selten – in Momenten wie heute Abend. Doch ich verlange nicht nach mehr. Ich drehe mich auf die Seite, blicke kurz zur Decke. Der Stein über mir ist vertraut. Uneben. Stark. Er trägt mehr als nur Gewicht. Ich atme ein. Langsam. Tief.
Und aus.
Kein Gedanke folgt dem nächsten. Keine Bilder. Keine Stimmen. Nur Dunkelheit.
Und dann umfängt mich die Nacht – wie ein Mantel aus Samt.
Der Morgen beginnt, wie er es immer tut – nicht mit der Sonne, sondern mit der Bewegung. Noch bevor das erste Licht über die Zinnen kriecht, spüre ich, wie der Tag mich weckt, nicht mit Sanftheit, sondern mit der festen Hand der Pflicht.
Meine Augen öffnen sich ruhig, ohne Hast. Ich bleibe einen Moment liegen, höre dem leisen Atmen der Festung zu – dem entfernten Schritt der ersten Wachen, dem dumpfen Grollen der Küche, wo Feuer entfacht werden. Es ist noch früh. Der Tag hat seine Form noch nicht gefunden. Ich richte mich auf, lasse die Kälte des Steins an meinen Füßen kurz aufsteigen, bevor ich in meine Kleidung schlüpfe. Die Bewegung ist automatisch, präzise. Tun, ohne denken zu müssen. Die Lederriemen meiner Rüstung ziehe ich fest. Keine vollständige Kampfmontur heute, aber genug, um ernst genommen zu werden. Die Burg ist ruhig, aber nicht sicher. Das ist sie nie.
Draußen liegt noch feiner Nebel über dem Hof, die Feuchtigkeit glitzert wie Staub auf dem Steinboden. Die Luft riecht nach kalter Erde und angebranntem Brot. Ich trete hinaus, lasse den Blick kurz über die Burgmauern gleiten. Zwei Späher melden sich mit einem knappen Nicken. Die Nacht war ruhig. Ich erwidere den Gruß stumm. Mein erster Weg führt mich zu den Wachen. Ich überprüfe die Besetzung der Mauern, frage nach dem Wechsel, lasse mir Berichte geben – keine besonderen Vorkommnisse, aber im Süden wurde Rauch am Horizont gesehen. Wahrscheinlich ein Wandertrupp oder Jäger, aber ich notiere es.
Danach: die Stallungen. Zwei Pferde brauchen neue Beschläge. Der Stallbursche ist übernächtigt, aber gewissenhaft. Ich sage nichts, aber meine bloße Anwesenheit reicht, damit er sich wieder aufrichtet. Ich lasse einen Späher aufbrechen, um das Rauchsignal zu prüfen – keine große Eskorte, aber vorsichtig genug.
Im Innenhof ist Bronn bereits am Trainieren. Schweiß glänzt auf seiner Stirn, die Bewegungen sind kräftig, wütend fast. Ich beobachte ihn kurz, sage jedoch nichts. Der gestrige Abend wirkt noch nach – in ihm wie in mir.
Diane und Lilien sitzen später im kleinen Innenhof, als ich vorbeikomme. Ich sehe sie nur aus der Ferne.
Leora ist in der Waffenkammer, wo sie sich mit zwei neuen Rekruten streitet. Sie korrigiert Haltungen, stellt Fragen, beißt sich durch. Ich lasse sie. Wenn jemand die neuen Kämpfer auf Linie bringt, dann sie – mit Feuer und Stolz.
Kain treffe ich vor der Halle. Er spricht nicht, als ich ihn sehe, aber unser Blick reicht. Ich nicke ihm zu. Er erwidert es, erschöpft. Er wirkt, als hätte er nicht geschlafen – die Schatten unter seinen Augen sprechen Bände. Ich frage nicht. Wir beide wissen, warum.
Zur Mittagszeit nehme ich mir ein Stück Brot, ein paar Trockenfrüchte. Essen ist Funktion, kein Genuss. Während ich esse, überfliege ich die Berichte: Vorräte reichen noch, aber wir müssen in drei Tagen jemanden zu den äußeren Höfen schicken. Ich mache mir eine mentale Notiz. Am Nachmittag: Training mit drei meiner Offiziere. Koordination, Disziplin, Reaktion. Ich gehe hart mit ihnen ins Gericht. Nicht, weil ich sie strafen will – sondern weil wir uns keine Nachlässigkeit leisten können. Sicherheit ist eine Kette. Bricht ein Glied, fallen alle. Gegen Abend beginne ich mit der Runden durch die äußeren Türme. Ich spreche mit den Spähern, überprüfe Sichtlinien, befrage die Grenzposten, wer in den letzten Tagen gekommen oder gegangen ist. Alles scheint ruhig. Zu ruhig? Vielleicht. Ich behalte es im Hinterkopf.
Der Tag endet wie viele andere – mit mir, oben auf der Mauer. Ich bemerke sie, noch bevor ich die letzte Stufe zur Mauer genommen habe. Ihre Silhouette zeichnet sich gegen den Abendhimmel ab – schmal, fast zerbrechlich im Licht der untergehenden Sonne, das den Horizont in goldene Glut taucht. Der Wind spielt sanft mit den losen Haaren, die sich aus ihrem Zopf gelöst haben, und ihr Mantel schlägt leise im Rhythmus der Böen.
Ich halte kurz inne, lasse meinen Blick einen Moment auf ihr ruhen. Es ist kein Beobachten im Sinne von Kontrolle. Eher ein stilles Wahrnehmen. Ein Erkennen.
Und dann gehe ich weiter. Langsam, gleichmäßig, sodass meine Schritte auf dem Stein nicht wie ein Eindringen klingen.
Sie merkt, dass ich da bin, lange bevor ich wirklich bei ihr stehe. Ihre Schultern versteifen sich kurz, fast unmerklich. Aber sie bleibt. Und das allein… zählt.
Ich bleibe auf Abstand, genau wie gestern. Dass sie wieder hier ist, spricht mehr als jedes Wort.
„Du hast deinen Platz gefunden“, sage ich leise, ohne Ironie, ohne Druck. Sie antwortet nicht sofort. Ihre Stimme kommt erst nach einem Moment, leise, beinahe vom Wind getragen:
„Es ist still hier… aber nicht leer.“
Ich nicke, auch wenn sie es nicht sieht. „Stille kann manchmal mehr sagen als jede Stimme.“
Sie sieht nicht zu mir. Ich sehe nicht zu ihr. Zwischen uns liegt ein stilles Einverständnis, eine Balance, die durch Blicke nur gestört würde.
„Diane meinte heute, ich soll lernen, mich wieder zu spüren. Aber das... das ist nicht so einfach, wie sie tut.“
„Diane vergisst manchmal, wie viel Mut der erste Schritt kostet“, sage ich ruhig. „Weil sie selbst durch Flammen geht, ohne sich zu ducken.“ Lilien schweigt einen Moment, dann: „Sie hat gesagt, du bist wie Stein. Außen hart. Innen… naja, da hat sie gestoppt.“
Ein leises, schiefes Lächeln huscht mir übers Gesicht. „Das klingt nach Diane. Sie lässt einem selten das letzte Wort – nicht mal in Gedanken.“ Diesmal entweicht ihr tatsächlich ein leiser Laut. Kein Lachen – eher ein leises, vorsichtiges Heben von etwas, das vielleicht einmal Leichtigkeit war.
„Und? Ist es wahr?“
Ich sehe jetzt doch zu ihr, kurz. Ihre Augen sind noch immer auf die Sterne gerichtet, aber sie fragt nicht im Spott. Nicht aus Misstrauen. Nur leise Neugier.
„Vielleicht“, antworte ich. „Stein schützt. Aber auch Stein speichert Wärme – wenn man ihm Zeit lässt.“ Ein Windstoß geht über die Mauer. Sie zieht ihren Mantel enger. Reflex. Selbstschutz.
Ich ziehe meinen ab und lege ihn, ohne ein Wort zu verlieren, ein Stück neben sie. Nicht direkt auf sie. Nicht zu nah. Einfach da. Ein Angebot. Kein Druck.
Sie blickt hinüber. Nicht sofort, aber dann doch. Und sagt nichts. Doch sie lässt ihn dort. Das reicht mir.
Wieder vergeht Zeit. Minuten. Vielleicht mehr. Worte brauchen hier oben keine Eile.
„Ich war nie allein“, sagt sie schließlich. „Aber ich war nie… gesehen.“ Ihre Stimme zittert nicht. Doch sie ist rau. Wie Sand, der über Wunden streicht.
Ich antworte nicht sofort. Lasse das Gewicht dieser Worte ihren Raum haben. Dann, leise: „Du bist nicht nur, was dir genommen wurde, Lilien. Du bist auch das, was du dir zurückholst.“
Wieder Stille. Tiefer diesmal.
Und dann: „Danke.“
Ich weiß nicht, ob sie mich meint oder die Mauer. Vielleicht beides. Vielleicht einfach das, was zwischen uns schweigt. Ich bleibe noch, bis die Sterne ganz sichtbar sind. Dann erhebe ich mich, leise.
„Ich bin morgen wieder hier“, sage ich schlicht. „Ich weiß“, sagt sie.
Und diesmal… klingt es wie ein Versprechen.
Der Morgen kommt erneut ohne Pomp, ohne Dramatik. Er schleicht sich in mein Zimmer wie ein alter Bekannter – wortlos, verlässlich. Ich bin wach, bevor das erste Licht durch die schmalen Fenster fällt. Der Tag beginnt wie ein alter Rhythmus, in den man ohne Mühe zurückfindet. Keine Träume haben mich geplagt, kein Schatten verfolgt mich aus der Nacht. Nur ein stilles Erwachen, getragen von der Gewissheit, dass mein Platz unverändert ist.
Ich kleide mich, ziehe die Stiefel fest, prüfe den Sitz der Lederriemen und verlasse mein Quartier. Auf dem Gang treffe ich Kain. Seine Haltung ist wie immer ruhig, aber die Müdigkeit steht ihm nach wie vor ins Gesicht geschrieben.
„Du siehst beschissen aus“, sage ich zur Begrüßung, die bei uns nicht weniger als Zuneigung bedeutet.
Er schnaubt trocken. „Und du redest wieder zu viel.“
Ein kurzes, schräges Grinsen huscht über mein Gesicht. „Ich versuche eben, mich deinem Kommunikationsstil anzupassen.“ Wir gehen ein Stück nebeneinander her, schweigend, wie wir es oft tun. „Leora ist heute früh raus. Ohne ein Wort.“
„Sie braucht Zeit“, sage ich ruhig. „Ich weiß. Aber zu wissen, warum hilft nicht, wenn man danebensteht und nichts tun kann.“
Ich sehe ihn an. „Du tust mehr, als dir klar ist.“
Er blickt mich von der Seite an. „Wieso sagst du manchmal solche Dinge?“
„Weil du sie hören musst.“
Er hält inne. Nicht körperlich – aber ich merke, wie er stockt. „Ich hasse das.“
„Was?“
„Wenn du recht hast.“
Wir lachen. Kurz. Ehrlich. Dann trennen sich unsere Wege – er geht zum südlichen Wall, ich zum Hof.
Der Tag vergeht wie der gestrige: Berichte, Wachen, Entscheidungen, kleine Befehle, wenige Worte. Ich bin überall ein wenig, nirgends lange. Doch überall bleibt mein Blick.
Gegen Abend zieht es mich wieder zur Mauer.
Ich bin diesmal der Erste.
Der Wind weht leiser als in den Nächten davor. Die Sonne ist noch nicht ganz untergegangen, der Himmel wechselt langsam von Blau zu Gold, mit feinen Schlieren, die sich wie Adern über die Weite ziehen. Ich setze mich an meinen gewohnten Platz. Rücken gerade, Hände auf den Knien. Ich brauche keinen Grund hier oben. Nur den Raum. Die Höhe. Die Distanz zum Lärm darunter.
Ich höre ihre Schritte, noch ehe ich sie sehe. Leicht. Vorsichtig. Aber nicht zögernd.
Lilien.
Sie bleibt kurz stehen, mustert die Mauer, mich, den Himmel. Dann setzt sie sich.
Dichter als zuvor.
Nicht nah. Noch immer ein Abstand. Aber diesmal… kein halber Meter wie sonst. Vielleicht eine Armlänge. Vielleicht weniger. Ich tue nichts. Sage nichts. Mein Blick bleibt auf dem Horizont. „Du bist früh dran“, sagt sie irgendwann. „Ich war neugierig, ob du heute auch kommst.“
Ein Moment Stille. Dann, leise: „Ich auch.“
Ich lasse das sacken. Es ist mehr als nur eine beiläufige Bemerkung. Es ist ein Eingeständnis.
Sie zieht die Beine an, umschlingt sie mit den Armen. „Diane meinte, Vertrauen ist wie Wurzeln. Man merkt erst, dass sie da sind, wenn man schon drinsteckt.“
Ich nicke langsam. „Klingt, als würde Diane langsam poetisch werden.“ „Oder alt“, murmelt Lilien.
Ich lache leise. Sie zuckt kaum merklich, aber nicht mehr wie ein scheues Tier. Eher wie jemand, der noch nicht weiß, ob sie wirklich mitlachen darf.
„Du wirkst ruhiger heute“, sage ich. „Ich bin es tatsächlich gar nicht“, gibt sie ehrlich zurück. „Aber… weniger laut im Kopf.“
Ich wende mich ihr kurz zu, nur mit dem Blick. „Das ist ein Anfang. Manchmal reicht das.“
Sie schweigt. Aber ich sehe, wie sich ihre Schultern entspannen.
„Weißt du“, sagt sie dann, „ich dachte früher immer, alle Männer wollen etwas. Immer. Jetzt… glaub ich, dass du einfach nur da bist.“ Ich sehe sie an. Ganz kurz. Dann wieder zum Himmel. „Manchmal ist Dasein das, was am meisten zählt.“ Der Wind zieht an uns vorbei, trägt den Tag davon. Lilien greift nach dem Mantel, den ich gestern hiergelassen habe. Legt ihn sich über die Beine.
Der Himmel ist inzwischen violett getönt, nur noch einzelne Goldfäden hängen wie zerrissene Schleier über dem Horizont. Die ersten Sterne blitzen auf – vorsichtig, wie sie selbst. Lilien schweigt eine Weile. Doch sie ist nicht mehr angespannt. Ihre Schultern ruhen nicht wie gestern wie ein eingeklemmtes Tier, das jeden Moment fliehen könnte. Sie sitzt einfach da. Mit meinem Mantel über den Beinen. Und ihrer Anwesenheit, die plötzlich nicht mehr wie eine Prüfung wirkt, sondern wie eine Wahl.
Dann höre ich ihre Stimme wieder. Zart. Fast wie ein Gedanke, der aus Versehen laut wurde.
„Du… fühlst dich nicht an wie die anderen.“
Ein Moment vergeht, als hätte sie selbst über ihre eigenen Worte erschrocken innegehalten.
Ich sage nichts. Drehe den Kopf nicht, bewege mich nicht. Ich will es ihr lassen, dieses fragile Etwas, das sie da hingelegt hat – wie eine Blüte, die sich langsam gegen die Kälte wehrt.
„Ich meine… nicht schlecht. Nur...“
Sie zögert. Faltet ihre Hände ineinander.
„Du willst nie zu nah. Das ist… angenehm. Irgendwie.“ Ich antworte nicht gleich. Nicht, weil mir nichts einfällt, sondern weil ich das Gewicht ihrer Worte nicht mit vorschnellen Sätzen beschädigen will. Dann: „Vielleicht bin ich einfach zu müde für Masken.“ Ein Hauch von Ironie schwingt mit, aber nur wie eine alte Gewohnheit, nicht wie eine Mauer.
Sie schaut nicht direkt zu mir, aber ihre Stimme ist klarer, wenn auch immer noch leise.
„Oder du hast keine nötig.“
Ich spüre, wie sich etwas in meiner Brust hebt – kein Stolz. Kein Schmerz. Eher… eine Ahnung von etwas Weichem, das ich lange nicht zugelassen habe.
„Ich hab meine Kanten wie jeder andere.“
„Aber du zeigst sie nicht, um zu verletzen,“ sagt sie sofort. Und dann, fast erschrocken, leiser: „Ich glaube, das ist selten.“
Ich sehe sie jetzt kurz an. Ihr Blick ist immer noch auf die Sterne gerichtet, als könne sie die Verantwortung ihrer Worte besser ertragen, wenn sie sie nicht in mein Gesicht legen muss.
„Vielleicht ist es selten“, sage ich. „Aber bei dir… muss man nichts beweisen.“
Sie zieht den Mantel etwas höher. Keine Angstbewegung – eher ein Suchen nach Halt.
„Ich glaube, ich mag das an dir.“
Zaghaft. Unsicher.
Aber ehrlich.
Ich nicke langsam. Sage nichts.
Weil nichts zu sagen, manchmal das Richtige ist. Die Stille zwischen uns zieht sich weiter, nicht unangenehm, sondern eher vertraut. Der Wind nimmt zu und weht ein paar lose Strähnen aus ihren Haaren. Sie schiebt sie hinter ihr Ohr, eine Bewegung, die so selbstverständlich wirkt, dass ich fast den Atem anhalte. Es ist diese Art von Unbeschwertheit, die sie sonst immer meidet – aber jetzt ist sie da, fast greifbar, fast spürbar.
Schließlich breche ich die Stille. Leise, vorsichtig, aber mit einer Frage, die mir nicht mehr aus dem Kopf geht.
„Hast du über Dianes Worte nachgedacht?“
Sie zuckt kaum merklich mit den Schultern, als würde sie den Gedanken beiseiteschieben, ohne ihm wirklich Gewicht zu geben. Doch dann lässt sie ein leichtes Schmunzeln die Lippen berühren. „Du meinst, dass du wie ein Stein bist?“ Ihre Stimme klingt fast gespielt, aber da ist ein Funken von Neugier, den ich nicht übersehen kann. „Ich habe darüber nachgedacht… und ja, sie hat recht, irgendwie. Du bist wirklich wie Stein. Aber nicht der, der blockiert, sondern der, der alles aushält. Der nicht einfach bricht.“ Sie sieht mich nicht an, sondern starrt weiterhin in den Dämmerhimmel, als würde sie die Worte vorsichtig abwägen.
Ich muss lächeln, unwillkürlich. Diese Art von Humor – trocken und dennoch ein bisschen mehr – trifft mich genau. „Stein, also. Vielleicht ein wenig härter, als es nötig wäre, aber...“ Ich lasse den Satz im Raum hängen, nicht wirklich als Kritik, sondern eher als Anstoß zum Nachdenken. „Diane hat dir aber auch geraten, dich wieder zu spüren...“
Sie blickt nun kurz zu mir, ihre Augen ein flüchtiger, schüchterner Blick, der sofort wieder in den Himmel wandert, als wolle sie die Worte entziehen, bevor sie zu schwer werden.
Doch ich merke, dass sie etwas in mir erkennt, das nicht von den anderen kommt – diese Mischung aus Direktheit und Zurückhaltung, die nicht mit dem üblichen Schutzschild anderer Menschen zu vergleichen ist.
„Ich habe nicht vergessen, was sie gesagt hat“, sagt sie, ihre Stimme diesmal etwas leiser, fast nachdenklich. „Ich denke nur... manchmal ist es leichter, sich selbst zu vergessen, als sich zu spüren. Wenn man fühlt, dann ist das wie ein Sturm, der einen überrollt. Und wenn man aufhört, zu fühlen... dann ist man ruhig. Sicher.“ Sie schließt die Augen für einen Moment, als ob sie sich dabei in ihre eigenen Gedanken zurückzieht. „Aber vielleicht sollte ich mich daran erinnern, was es heißt, zu fühlen. Was es bedeutet, nicht nur zu überleben, sondern zu leben.“
Als sie schweigt, öffne ich meinen Mund, nicht mit einer Antwort, die sie schon erwarten könnte, sondern mit einem Gedanken, der langsam in mir reift.
„Es muss kein Sturm sein“, sage ich leise. „Man kann sich auch etwas Ruhiges suchen, etwas Sanftes, um zu fühlen.“
Ich drehe mich langsam zu ihr, meine Stimme ruhig, so wie die Nacht, die sich um uns legt. „Manchmal hat das Leben mehr zu bieten als nur den Wind, der einen in den Sturm reißt. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Der Moment, in dem du spürst, dass du da bist. Ein Atemzug. Ein Blick. Das Gefühl von Wärme, das du nicht erzwingen musst. Das ist genauso stark wie jeder Sturm, nur auf eine andere Weise.“ Ich merke, wie ihre Augen sich ein kleines Stück weiter öffnen, als würde sie das, was ich sage, für sich selbst einordnen. Noch nicht ganz begreifen, aber ein Teil von ihr beginnt, die Möglichkeit in sich zu tragen.
„Es ist nicht immer leicht, das zu erkennen“, sage ich, „aber manchmal sind es gerade die ruhigen Momente, die mehr von uns verlangen. Wenn wir uns erlauben, wirklich zu fühlen, ohne dass alles um uns herum tobt, dann... dann lernen wir, wer wir wirklich sind.“
Sie sieht mich an, und ich erkenne das kleine Funkeln in ihren Augen – nicht herausfordernd, sondern eher neugierig, ein Stück weit verspielt. Ihre Lippen zucken leicht, als würde sie mit sich selbst ein kleines Lächeln verbergen.
„Und hörst du eigentlich auf deine eigenen Ratschläge?“, fragt sie schließlich, ihre Stimme trägt einen Hauch von Belustigung, der gleichzeitig eine leise Schärfe verbirgt.
Der Blick, den sie mir zuwirft, ist kein Angriff, aber er lässt mich für einen Moment innehalten. Sie hat mich erwischt, auf eine Art, die fast zu präzise ist.
Ich schnaube leise und drehe meinen Blick wieder zum Horizont. „Ich denke, die meisten Ratschläge sind leichter zu geben als zu befolgen“, antworte ich dann, ein schiefes Lächeln auf den Lippen, das nicht ganz von Humor getragen wird, sondern eher von einer unbestimmten Melancholie. „Aber ja, vielleicht sollte ich öfter auf sie hören. Könnte mir nicht schaden.“
Sie dreht ihren Kopf leicht, als würde sie über meine Worte nachdenken, und in ihrem Blick liegt etwas, das ich nur schwer einordnen kann. Es ist nicht Mangel an Vertrauen, eher ein stilles Abwägen, ein vorsichtiges Messen, was sie von mir hören kann und will.
„Vielleicht solltest du das wirklich“, sagt sie dann, ihr Ton weicher, aber nicht weniger nachdrücklich. „Denn, wenn du es ernst meinst, was du sagst... dann sollte auch der, der diese Worte spricht, bereit sein, sie zu leben.“
Da ist etwas in ihrer Stimme, das nicht nur eine simple Rückfrage ist. Es ist mehr eine leise Herausforderung, die unter der Oberfläche schimmert – die Erinnerung daran, dass wir oft nicht anders sind als die, denen wir unsere Ratschläge anbieten.
Der Abend zieht sich langsam über die Burg, und der Himmel verliert sich zunehmend in dunklen Tönen, bis nur noch die wenigen Sterne und der schwache Mond Licht in die Dunkelheit streuen. Die Mauer wird ruhiger, der Wind trägt die Kälte der Nacht heran. Ich bleibe noch eine Weile da sitzen, ohne etwas zu sagen, während Lilien sich schließlich erhebt und mit langsamen Schritten in Richtung der Treppen geht. Sie hält kurz inne, als sie bemerkt, dass ich noch immer auf den Horizont starre, dann verschwindet sie in der Dunkelheit, ohne ein weiteres Wort zu sagen.
Ich atme tief ein, der kalte Luftzug fühlt sich angenehm kühl an, fast reinigend. Irgendwie beruhigend, das Gefühl von Distanz und doch Nähe. Dann stehe ich auf, gehe die wenigen Stufen hinab und mache mich auf den Weg zu meinem Quartier.
Der Weg zu meinem Zimmer ist still. Der Rest der Burg hat sich schon zur Ruhe begeben, und die Nacht dringt in die Hallen wie ein sanftes, aber unausweichliches Dunkel. Ich ziehe mich aus, lege mich in mein Bett und schließe die Augen. Doch der Schlaf will nicht kommen, nicht sofort. Gedanken wirbeln durch meinen Kopf, Bruchstücke von Gesprächen, die mich immer wieder beschäftigen. Die Worte von Lilien hallen nach, ebenso wie das, was sie von mir sagte, und ich frage mich, wie weit wir beide wirklich bereit sind, uns zu öffnen.
Der nächste Morgen ist so unaufgeregt wie der gestrige Tag. Die Sonne ist bereits aufgegangen, und ich erwache ohne ein Geräusch, ohne Drang, sofort in Bewegung zu geraten. Der erste Blick fällt auf das Fenster – das spärliche Licht der Morgensonne kämpft sich durch die schweren Vorhänge, wirft schmale Lichtstreifen in den Raum. Ich strecke mich, atme tief ein und ziehe mich dann an, den Tag vor mir spürend. Das Frühstück ist wie immer kurz und pragmatisch. Keine langen Gespräche, keine unnötigen Worte.
Der Brunnen liegt still im Innenhof, von Sonnenstrahlen durchbrochen, die durch die offenen Wolkenlücken fallen. Das Wasser darin spiegelt flüchtig das Gesicht des Mädchens wider, das davorsteht – Mira. Klein, zierlich, mit großen Augen, die heute mehr fragen als sie je aussprechen würde.
Sie hält einen Tonkrug in den Armen, der für sie viel zu schwer wirkt. Ihre kleinen Finger klammern sich an die rauen Griffe, der Rand schneidet beinahe in ihre Haut.
„Taron?“ Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Hauch, vorsichtig, beinahe ehrfürchtig.
Ich bleibe stehen, nehme mir einen Moment, dann hocke ich mich vor sie hin, sodass wir auf Augenhöhe sind. Der Tonkrug schwankt in ihren Händen. Behutsam nehme ich ihn ihr ab und stelle ihn auf den Brunnenrand, wo er sicher steht.
„Sie kämpft.“ Meine Stimme ist ruhig, ein wenig wärmer als sonst. „Und so wie ich Kate kenne, wird sie bald wieder aufwachen.“ Ein flüchtiges Lächeln huscht mir über die Lippen. „Mach dir keine Sorgen, kleine Löwin.“
Ihr Blick sucht mein Gesicht, so als wolle sie darin einen Beweis finden, eine Bestätigung, die ihre Angst vertreibt. Sie nickt langsam, zögerlich, aber sie versucht, mir zu glauben. Will stark sein. Wie Kate. Wie Diane. Wie die, zu denen sie aufsieht.
Ich reiche ihr den Krug zurück. „Jetzt bring das besser zu deiner Mutter, bevor er wieder kippt.“
Sie schiebt sich den Henkel über den Arm, macht einen kleinen Knicks – halb kindlich, halb instinktiv – und huscht davon. Ich sehe ihr einen Moment hinterher, dann wende ich mich ab und ziehe weiter.
Auf dem Übungsplatz hallt das metallische Klirren von Holzwaffen gegen Rüstungen. Junge Rekruten schnaufen, ihre Bewegungen noch kantig, ungeordnet. Joran steht dazwischen, korrigiert mit geübtem Blick die Haltung eines Jungen, dessen Schwertgriff mehr nach Strohhalm aussieht als nach Stärke.
Am Rand, wie ein alter Baum im Sturm, steht Garrik mit verschränkten Armen. Seine Stirn in Falten, die Stimme ein brummender Groll. „Zu lasch“, knurrt er, als ich an ihm vorbeigehe.
Ich werfe ihm einen trockenen Blick zu. „Dann zeig’s ihm.“ Sein Schnauben ist Antwort genug – und gleichzeitig die stille Zustimmung, dass er es gleich tun wird. Garrik ist zu alt, um sich beweisen zu müssen, aber nicht zu alt, um einem Jungen die Stirn zu bieten.
Ich lasse das Übungsgelände hinter mir, während mir die Wärme des Sonnenlichts auf den Schultern liegt. Mein nächster Halt ist der Wehrgang.
Die Steine knirschen unter meinen Stiefeln, während ich die schmalen Stufen nach oben nehme. Der Wind ist kräftiger hier oben, trägt bereits die feuchte Schwere von Regen mit sich.
Aedric steht am Geländer, die Augen schmal, den Blick in die Ferne gerichtet. Seine Haltung ist ruhig, angespannt nur im Detail. Er sieht mich nicht an, als er spricht.
„Nichts Verdächtiges.“
Ich trete neben ihn, lasse meinen Blick über die Felder schweifen, über Wälder, Hügel, Wege, die sich im dunstigen Licht verlieren. „Gut“, antworte ich, während ich mich an das Geländer lehne. Der Wind spielt mit meinem Mantel, weht mir den vertrauten Geruch von Erde, Holz, Eisen – und nun: Regen – entgegen. Die Burg lebt. Wacht. Atmet.
Als ich mich vom Wehrgang löse, lasse ich meinen Blick noch einmal über das Land streifen – nichts Ungewöhnliches, keine Bewegung am Waldrand. Aber ein inneres Ziehen bleibt. Kein konkreter Verdacht. Eher… Instinkt. Und Kain.
Ich finde ihn schließlich am Waffenständer nahe dem hinteren Übungsplatz. Er ist allein, mustert wortlos ein Schwert, das er gar nicht wirklich zu sehen scheint. Seine Schultern hängen tiefer als sonst, und selbst seine Präsenz – sonst so kontrolliert, so klar – wirkt heute wie durch ein Netz aus Schatten gezogen.
Ich trete neben ihn, sage erst einmal nichts. Lasse den Moment atmen. Dann: „Komm mit. Spähtrupp. Nur du und ich.“
Kain blinzelt, sieht mich aus dem Augenwinkel an. „Jetzt?“, fragt er leise. Ich nicke. „Jetzt.“
Er stellt das Schwert zurück, greift nach seinem eigenen, und ohne ein weiteres Wort folgen wir dem Pfad hinaus, durch das Nordtor, in die Wälder, die uns wie immer einen stummen Empfang bereiten. Eine Weile gehen wir schweigend. Es ist keine unangenehme Stille – eher eine, die sich zwischen zwei Männern ausbreitet, die einander kennen, wie man das nur durch geteilte Gefahren, geteilte Narben tut. Doch heute ist diese Stille schwerer. Und ich weiß, dass ich sie nicht ewig zulassen kann.
„Du siehst aus, als hättest du letzte Nacht mit deinen Gedanken gerungen und verloren.“ Ich werfe ihm einen kurzen Seitenblick zu. Meine Stimme ist ruhig, wie immer, aber mit einem Hauch von etwas, das man wohl nur als Besorgnis erkennen würde, wenn man mich gut kennt.
Kain antwortet nicht sofort. Tritt einen Ast zur Seite, fährt sich mit der Hand durchs Haar.
„Ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, Taron“, sagt er schließlich. „Sie ist da… aber nicht wirklich bei mir. Ich kann sie nicht berühren. Nicht halten. Nicht… helfen. Und ich weiß, dass es nicht schlimmer werden sollte, aber es fühlt sich an, als würde es das.“
„Du hältst dich noch, weil du es gewohnt bist, alles allein zu tragen.“ Ich gehe neben ihm weiter, prüfe nebenher die Spuren am Waldboden, halte den Blick aber nie ganz von ihm fern. „Aber das hier, Kain… das ist nichts, was man alleine schultern muss. Nicht du. Nicht sie.“ Er schnaubt leise. „Und wenn ich sie verliere, obwohl sie direkt vor mir steht?“
„Dann erinnerst du sie. Daran, wer du bist. Wer sie ist. Und dass du sie liebst mit Haut und Haar. Dass ihr stärker seid als das.“ Er bleibt stehen. Ich auch. Zwischen den Bäumen ist es still, selbst der Wind scheint für einen Moment zu lauschen.
„Du sagst das so leicht.“
Ich sehe ihn direkt an. „Weil ich es nicht sagen würde, wenn ich es nicht ernst meinen würde.“
Eine Pause. Dann leiser, fast wie ein Eingeständnis: „Du erinnerst mich daran, warum ich nie jemanden so nahe an mich herangelassen habe, Kain. Und das meine ich nicht als Vorwurf. Sondern als Erkenntnis.“





























